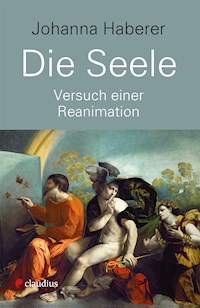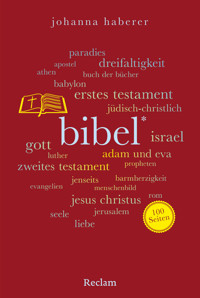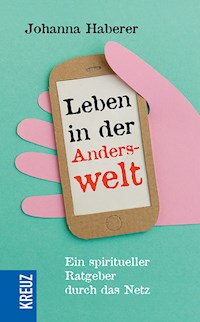
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kreuz Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Informationsinstrument, Spielkonsole, Quatschbude, Kaufhaus und vieles andere mehr: Das Netz ist die digitale Anderswelt, vertraut – und doch ganz anders. Schneller, direkter sind die Möglichkeiten zur Partizipation, ich kann mich in Jetztzeit beteiligen, widersprechen oder mitdiskutieren. Neu sind leider auch die Möglichkeiten, Menschen bis in ihre intimsten Räume zu orten und zu verfolgen. Das Leben der anderen wird in nie dagewesener Weise durchsichtig. Das Leben in der digitalen Kommunikationsgesellschaft wird zugleich in nie da gewesener Weise undurchsichtig. Was macht das mit uns, mit unserem Denken, unserer Wahrnehmung, unseren Wahrheiten und unserer Wahrhaftigkeit, unseren Bindungen? Johanna Haberer bringt anhand der alten Begriffe Wahrheit, Glauben und Vertrauen Licht in die Unübersichtlichkeit. Sie fragt nach den Machtstrukturen in der digitalen Welt und ermuntert zur mündigen Teilhabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Johanna Haberer
LEBEN in der Anderswelt
Ein spiritueller Ratgeber durch das Netz
Foto: © privat
Die geborene Münchnerin Johanna Haberer studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Theologie. Nach Stationen u.a. bei der Evangelischen Funkagentur (efa), als Redakteurin bei EIKON, Chefredakteurin des „Sonntagsblattes – Evangelische Wochenzeitung für Bayern“ war sie Rundfunkbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit 2001 ist Johanna Haberer Professorin für Christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist Mitglied in der Datenethikkommission der Bundesregierung.
© Kreuz Verlag GmbH, Freiburg im Breisgau 2019
Alle Rechte vorbehalten
www.kreuz-verlag.deUmschlag: griesbeckdesign.de
E-Book-Erstellung: NagelSatz, Reutlingen
ISBN (PDF) 978-3-946905-75-2
ISBN (E-Pub) 978-3-946905-76-9
ISBN (Print) 978-3-946905-24-0
1. Kapitel
Von der Christlichen Lebenskunst in codierten Zeiten. Oder: Die Religion der Nummern
Die Namen könnt ihr vergessen. Das ist nur Ballast. Was bedeutet schon ein Name, aber eine Nummer ist immer ernst – und genau. Ihr seid Nummern geworden. Verstanden?
Josef Lánik[1]
Es geht um unsere Seele in diesem Buch. Es geht um unsere Wahrnehmung der Welt, unsere Orientierung darin, um Wahrheit und Lüge, um Liebe und Hass, um Aufmerksamkeit und Anerkennung, um Mitleid und Empathie, um Macht und Widerstand. Es geht um unsere Spiritualität und um Religion. Es geht um unser Menschsein, wie wir es kannten.
Es ist merkwürdig, dass von den Religionsvertretern Deutschlands, Europas und Amerikas, also der jüdisch-christlichen Kultur westlicher Prägung, noch kein Aufschrei kam. Oder wenigstens eine intellektuelle Kraftanstrengung unternommen wurde, um zu beschreiben und zu begreifen, was die Digitalisierung unserer Welt, ihre totale Durchdringung durch Algorithmen, ihre vermessene Vermessung aller Lebensbereiche, ihre Umwandlung in ein ewiges Vergleichen für unser Zusammenleben bedeutet – für unsere Kommunikation, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, ja das Gelingen unseres Lebens.
Wir Menschen und Christen müssen zeitnah Anstrengungen unternehmen, um zu begreifen, warum unsere Gesellschaften erodieren, woher der Hass kommt und die Wut und die Lust, den Mitmenschen übel nachzureden, sie zu beobachten, zu kommentieren oder sie gar mit „Scheiße-Stürmen“ zu überziehen.
Die sogenannte „Digitalisierung“ und in deren Gefolge die „Mediatisierung“[2] unserer Welt hat so viele Gesichter, wie es Lebensbereiche gibt. Sie ist zu einer Art Skelett unserer Gesellschaft geworden. Es ist kein Zahlungsverkehr mehr denkbar, kein Behördengang, kein Autokauf, keine Finanzverwaltung oder Versicherung und keine Bibliothek, auch keine Kirche – ohne die verarbeiteten persönlichen und unpersönlichen Daten.
Und auch unsere Kommunikation, ob dienstlich oder privat, läuft über digitale Netze. Wir, die wir mit Handy und Laptop unterwegs sind, hinterlassen den ganzen Tag über Spuren, auf denen wir von programmierten Spähern – beauftragt von Geheimdiensten oder digitalen Datenstaubsaugern – verfolgt und vermessen werden können. Denn die codierte Welt will um der Sicherheit willen mein Verhalten analysieren, will wissen, was ich denke und tue und denken und tun werde und wenn möglich vorausplanen, wie ich handeln werde. Die Regierungsorganisationen entschuldigen ihre schier unstillbare Neugierde mit dem Argument der Sicherheit, die Datenverkäufer tun dasselbe um der Rendite willen. Sie scannen und ranken uns, damit wir zielgerichtet und fokussiert Adressaten ihrer Werbung werden.
Denn hinter den Kulissen auf irgendwelchen Datenbanken sorgen Algorithmen dafür, dass wir einen Kredit bekommen oder nicht, eine Wohnung mieten können oder eben nicht, ob wir gesellschaftlich angepasst sind oder eben nicht.
In China hat man in Sachen Digitalisierung die Maske der totalen Überwachung mit dem Ziel der totalen Vereinnahmung fallen lassen. Hier formt sich das Netz zu einem totalitären staatlichen Normierungs- und Anpassungssystem.
Die Bürgerinnen und Bürger sammeln über digitale Verrechnung sogenannte „Sozial-Kredite“ für staatlich angepasstes Wohlverhalten an. Von der Menge der Pluspunkte hängt es ab, ob eine Bürgerin einen bestimmten Job bekommt oder ein Auto, ob er oder sie heiraten oder einen Mietvertrag unterschreiben kann. Die digital benoteten Bürger müssen in ihrem Wohlverhalten gegenüber einem totalitären System mit den anderen wetteifern, um der herrschenden Klasse zu gefallen.
Und es könnte sein, dass dieses chinesische Modell sich am Ende des Kampfs der Bürger und Bürgerinnen um die Transparenz der Datenverwendung durchsetzt. Es verdichten sich die Indizien – jetzt Anfang 2019 –, dass Google, um in China – ein Land, das Google wegen der Zensur vor Jahren verlassen hat – wieder seine Dienste anbieten zu können, nun eine beschränkte Version auf den Markt bringt. Die Sonderausgabe von Google wird, so heißt es, in der Volksrepublik bestimmte Internetseiten und Suchbegriffe sperren, in denen es unter anderem um Menschenrechte, Demokratie, Religion und friedliche Proteste geht.[3]
Dort kann man sehen, was man hier in Europa verhindern muss: die Normierung des Menschen durch den lebenslangen Zwang, in einem Wettbewerb zu stehen, dessen Regeln die Machthaber gemacht haben und nicht das Individuum oder die Gesellschaft.
Der französische Philosoph der Macht, Michel Foucault, hat in diesem Zusammenhang von der „disziplinierenden Macht“ und der „Kontrollmacht“ gesprochen; ein ganzes Volk wird als eine Art Klassenzimmer behandelt einschließlich Benotung und Versetzung. Auch die anderen Dimensionen von Macht, die Foucault nennt, werden in der digitalen Registrierung verwirklicht: Die „Bio-macht“, die Macht über Sexualität, Bewegungsfreiheit und Wohnort, realisiert sich in der digitalen Überwachung des Bewegungsprofils, in den Partnerschaftsbörsen und der automatischen Einordnung der Bürger und ihrer finanziellen Möglichkeiten, bis hin zu den Gesundheitsdaten, die von den Versicherern sehr wahrscheinlich eines Tages regelhaft eingefordert werden.
Die sogenannte „Pastoralmacht“ ergänzt die netzwerkartige Kontrolle über Menschen und Bürgerinnen dadurch, dass die Bürger (siehe auch China) zu der Überzeugung gebracht werden, all diese digitale Kontrolle sei nur zu deren eigenen Sicherheit und grundsätzlich zu seinem und ihrem Besten und zum Besten des Kollektivs.
Foucault hat dieses Phänomen schon vor über 40 Jahren in einer Vorlesung mit dem Titel „Die Verteidigung der Gesellschaft“[4] in Worte gefasst. Er schreibt dort: „Die Macht wird ausgeübt, zirkuliert, bildet Netze.“ (S. 45) Und an anderer Stelle schreibt er: Die Macht entfaltet sich im Medium von „Wissen, Beobachtungsmethoden, Aufzeichnungstechniken, Untersuchungen und Forschungsverfahren und Verifikationsapparaten“ (S. 49). Foucault, dieser französische Philosoph und Soziologe, der lebenslang über die Frage nachdachte, wie in Gesellschaften Macht ausgeübt wird und wann man von der totalen und totalitären Macht sprechen könne, formulierte die Sätze über die Netzwerke der Macht 30 Jahre vor den Gründungen von Facebook und Google. Er verbreitete eine Ahnung von der Macht, in deren Hände sich Menschen gern und freiwillig begeben und die dann ihre unsichtbare und (un)heimliche Arbeit der Anpassung und Normierung beginnt, die auch immer Sanktionen impliziert.[5]
Wer gehört dazu, wer hat die meisten Follower, wer die meisten Freunde und Likes, oder wer ist ausgeschlossen, wenn er oder sie sich nicht in den Netzwerken bewegen? Jaron Lanier, ein Informatiker und Musiker, einer der Vordenker des Internets und Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hat seine Meinung über die Macht der Netzwerke total geändert. Er, der in den Feuilletons gerne „Tech-Guru“ und Vordenker des Internets genannt wird, beendet heute seine Streitschrift gegen die sozialen Netzwerke, indem er den (pseudo-)religiösen Charakter dieser Technologie entfaltet und von der dieser Technik innewohnenden „Spiritualität“, dem „Glauben“, dem „Himmel“ und der Macht über das menschliche Leben spricht (Kap. S. 177–196). Er zeigt auf, welche ungeheure Deutungshoheit, welch machtvolle Logiken die Wahrnehmungsanordnungen der großen Netzwerke auf unsere Weltanschauung, unser Fühlen und Denken und Erfahren ausüben. Er fordert – immer in der strengen Unterscheidung der Potentiale der neuen Technologie und ihrer derzeitigen politischen Organisation und ökonomischen Weltmachtstellung – eine Reformation dieser Technologie, die er ungeniert mit Luthers Reformation vergleicht.[6]
Und das alles hat natürlich mit Religion zu tun, mit der gewachsenen, der erzählten, gepredigten und erlittenen Religion und ihrem Menschenbild. Denn es geht um meine Originalität und meine Kraft, um meine Liebe und meinen Geist. Es geht um die Würde meiner persönlichen Erfahrungen. Es geht um den Gott, der mich sieht gegen den Algorithmus, der mich durchschaut. Es geht darum, wie ich angesehen werde und wie ich mich in der Folge selbst verstehe.
Es geht um die Wahrnehmung – wie ich wahrnehme und wie ich wahrgenommen werde – und die Deutung meines Lebens. Es geht um die Einordnung meiner Biografie, die wir Christinnen und Christen letztlich bei Gott geborgen wissen.
Nein, liebe Leserin, lieber Leser, es geht in diesem Buch nicht um Technik-Bashing. Es geht auch nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger kirchlicher Würdenträger den altbekannten Gestus des Mahnens und Warnens einzunehmen. Ich würde diese Zeilen nicht schreiben, wenn ich nicht eine leidenschaftliche Bewunderin dieser federleichten Technologie wäre, die das Potential besitzt, ganze Länder aus dem Elend zu holen und Menschen aller Länder, Geschlechter und Hautfarben miteinander zu verbinden.
Alle Bürger, die Politik und die gesellschaftlichen Institutionen – auch die Kirchen und Gewerkschaften – haben das Internet Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bei seinem ersten Siegeszug durch die Büros und Haushalte gefeiert. Es erleichtert und beschleunigt die Kommunikation und weckte damals unter den Christen die Hoffnung auf eine „Protestantisierung“ der christlichen Religion durch eine neue Beteiligungs- und Debattenkultur.
Heute ist unser ganzes Leben – individuell und gesellschaftlich – beinahe völlig abhängig von dieser Technik geworden, die in in den Händen einiger weniger globaler Unternehmen liegt, die ihre Marktmacht ständig vergrößern und zu denen es im Augenblick keine Alternative gibt.
Die Regeln, nach denen wir einsortiert und womöglich manipuliert werden, sind so subkutan und intransparent, dass es von christlicher Seite gilt, die Machtfrage zu stellen im Pathos der Barmer Erklärung[7], die genau diese Machtfrage in sechs Thesen 1934 in aller Schärfe auf den Punkt bringt: „Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften.“ Bis heute sind diese Thesen in allen Fragen nach der Macht über mein Leben – die Navigations- und Deutungsmacht – erkenntnisleitend (siehe letztes Kapitel).
Und wir müssen uns klar machen, dass die neuen technischen Infrastrukturen, die die digitale Kommunikation ermöglichen, uns nicht nur mit Strom oder Wasser versorgen, nicht nur Verkehrsanbindungen organisieren oder die Müllabfuhr.[8] Die neuen weitweiten Infrastrukturen navigieren unser Bewusstsein. Organisieren unsere Peergroups. Und sie sind in der Hand von aktiengetriebenen Monopolisten, deren Macht je länger je mehr konkurrenzlos wird. Die Kirchen sind Global Player. Sie sind – gemeinsam mit den anderen global verbreiteten Religionen und zusammen mit den Vereinten Nationen – dazu in der Lage, die Fragen nach den vermessenen Machtansprüchen der großen Netzwerke und Datenkraken mit internationaler Autorität zu stellen.
Das Thema ist so unsichtbar und zugleich gewaltig, dass es in die Dimension der Entwicklungen gehört, denen man im Leben selten begegnet. Was sagst Du, wenn Dich Deine Kinder und Enkel fragen: „Warum hast Du nichts getan gegen die Vermessung der Menschen und die Monetarisierung seiner Daten? Warum hast Du nichts gesagt, als Menschen zu Nummern wurden? Warum hast Du nichts getan, als die Menschen zum Produkt und Objekt der digitalen Erzieher wurden, während Du zugleich irrtümlicherweise glaubtest, Du wärest frei wie nie?“
Die Entwicklungen der digitalen Gesellschaft zu analysieren, ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart, da sind sich die Zeitanalytiker einig. Die Folgen der Segmentierung der Gesellschaften, deren Radikalisierung und die dumpfe Gereiztheit, die aus der hermetischen, algorithmisch navigierten Kommunikation erwächst, die kann man in diesen Tagen, in denen übers Netz organsierte Volksaufstände von rechts und links in Europa auf die Straße gehen, gut besichtigen.
Eine Untersuchung digitaler Entwicklungen bewegt sich zwischen zwei Polen: einerseits der Beobachtung, dass die meisten Phänomene, die die digitale Welt vorantreibt – zum Beispiel Globalisierung, Partizipation oder Individualisierung –, altbekannt und auch solche der analogen sind und andererseits der Einsicht, dass all diese Phänomene unter den aktuellen informationstechnologischen Bedingungen eine neue Qualität erhalten.
Deshalb ist eine gewisse Ratlosigkeit festzustellen, mit der die Geistes- und Sozialwissenschaften der hybriden Entwicklung des digitalen Wandels begegnen. In seinem posthum erschienenen Werk stellt der Soziologie Ulrich Beck beispielsweise die These auf, weder „Wandel“ noch „Veränderung“ seien die rechten Begriffe, um die sich gegenwärtig vollziehenden Prozesse zu benennen: Er spricht sich für den Terminus „Metamorphose“ aus.[9] Und der Jerusalemer Historiker Yuval Noah Harari spricht gar von einer neuen Religion, nämlich der „Data-Religion“.[10] Er prophezeit den neuen Menschen, der in seiner Symbiose mit dem Computer final glücklich und womöglich unsterblich werden könnte, auch wenn er dann nur noch wenig von dem an sich hätte, was wir heute menschlich nennen. Auch er erkennt den religiösen Charakter dieser Netzwerke, weil sie das Potential haben, die gewachsenen Religionen zu verdrängen, indem sie sämtliche Wertmaßstäbe neu bestimmen und in der Lage sind, neue religionsähnliche Deutungsmuster und Sinnzusammenhänge aufzustellen.
Der Technikphilosoph Luciano Floridi schlägt vor, die Transformation der Kommunikation, der Gesellschaften und der Personen in (anthropologische) Termini zu fassen, wie „Raum“, „Zeit“ oder „Identität“.[11] Wir erleben und bewegen uns anders als zuvor in Raum und Zeit und wir beginnen uns über die Jahre – so behauptet er – als sogenannte Informationsorganismen („Infoorgs“) zu bewegen, als Spiegelgeschöpfe einer Technologie, die uns gesellschaftlich einordnet und rankt, und wir – wir machen ein Spiel mit, das wir in seiner Fähigkeit, uns zu normieren, gar nicht bemerken. Auch Floridi prophezeit eine Neujustierung der Menschen und der Gesellschaften.
Um die neuen Technologien zu verstehen und die Dimensionen ihrer Auswirkungen zu begreifen, bemüht der Diskurs eine Reihe von Analogien: Der theologische und kulturgeschichtliche Diskurs versteht den Kommunikationswandel während der Reformation als Medienphänomen und begründet diese Perspektive mit der bedeutenden Rolle des Buchdrucks, der diese aus kommunikationsstrategischer Sicht entscheidend vorangetrieben habe.[12] Relevant wird diese Analogie zwischen der Reformation als Medienphänomen und der Digitalisierung durch ihren Blick auf intendierte wie nicht intendierte Folgen für politische und gesellschaftliche Konsequenzen der Reformation (auch Lanier verweist auf die quasi religiöse Einflussnahme der Netzwerke und fordert eine Reformation).
Der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Nicholas Carr vergleicht den gesellschaftlichen Wandel durch die Digitalisierung mit der Erfindung der Elektrizität. Diese neue, im wahrsten Sinn des Wortes erhellende Technologie habe Gesellschaften an den unterschiedlichsten Stellen absolut verwandelt. Grundlegend neu organisierten sich beispielsweise wirtschaftliche Produktionsprozesse: Spät-, Nacht- und 24-Stunden-Schichten etablierten sich. Aktivitäten ließen sich nun unabhängig von der Tageszeit planen. Das Zusammenleben der Menschen, die Rhythmen von Geselligkeit und Familienleben wandelten sich genauso wie das Verhältnis von Zeit und Raum durch neue Möglichkeiten der Mobilität, ganz abgesehen von der generellen Beschleunigung der individuellen Lebenserfahrung.[13]
Eine weitere Analogie ist durch eine sehr ambivalente Haltung zur Digitalisierung charakterisiert. Der deutsche Soziologe und führende Intellektuelle Harald Welzer vergleicht sie mit der Erfindung der Atomkraft.[14] Wie digitale Technologien sei Atomenergie global verbreitet und weise – als sogenannte „saubere“ Energie – viele Vorteile auf. Unbedacht bleiben würden dabei deren verheerendes Destruktionspotential und deren Spätfolgen, die oft nicht differenziert genug durchdacht würden, wie es auch bei der Digitalisierung der Fall sei.