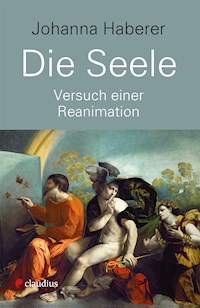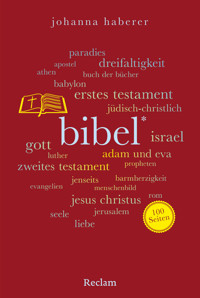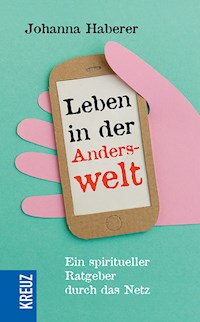8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die digitale Revolution hat unser Denken dramatisch verändert. Wir betreten mit dieser Technik einen neuen Lebensraum, in dem herkömmliche Regeln nicht gelten und die Gesellschaften lernen müssen, neue Normen auszuhandeln. Der Umgang mit Texten und anderen traditionellen Autoritäten verändert sich, und damit auch ethische Fragestellungen aus christlicher Perspektive. Zum Beispiel: Wer ist mein Nächster?
Es wird ein langer Weg, bis die herkömmliche Wissenschaft von Gott diesen neuen Lebensraum nach theologischen Kriterien einordnen und deuten kann. Dieses Buch möchte einen Anfang machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
JOHANNA HABERER
DIGITALE THEOLOGIE
Gott und die Medienrevolution der Gegenwart
Kösel
Copyright © 2015 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: Weiss Werkstatt München
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-16133-0
www.koesel.de
INHALT
Die Weltverbesserungsutopie
Die digitale Welt – neuer Lebensraum mit alten Mustern?
Biblische Einsichten
Beteiligung und Befähigung
Öffentlichkeit und Transparenz
Gemeinwohl und Gemeinschaft
Verpflichtung und Kontrolle
Reformatorische Aufbrüche
Von der allgegenwärtigen Kirche zur Diskursgesellschaft
Zugang zur kulturellen Masterurkunde
Flugblätter: Mediale Performances
Die Helden der neuen Medienwelt
Öffentlichkeit neu definiert
Cleaning Programm oder »Wormser Edikt«
Autokorrektur fehlt
Luther, Gatekeeper für ein neues Zeitalter
Das vervielfältigte Ich
Lost in Cyberspace
Personal Computer wörtlich genommen
Die Geburt der virtuellen Kommunikation
Martin Luther und das gottoffene Ich
Martin Buber und das Ich im Raum-Zeit-Netz
Dietrich Bonhoeffer und das fragmentierte Ich
Marshall McLuhan und das erweiterte Ich
In der neuen digitalen Welt
Religiöse Sprachspiele
Heilsversprechen oder digitale Ideologie
Gewinn und Verlust menschlicher Fähigkeiten
Verflachung des Denkens
Multiple Identitäten
Digitale Moral
Führe uns in Versuchung: Sirenenserver
Was ist heute Verrat?
Aufmerksamkeit, ein unsteter Gast
Lob der Sinnlichkeit
Freiheit und Abhängigkeit
Wer ist mein Nächster?
Geheimnisse als Netzwerke des Vertrauens
Vom Spiel als Ursprung der Freiheit
10 Gebote für die digitale Welt
Du brauchst dich nicht vereinnahmen zu lassen
Du sollst keine Unwahrheiten verbreiten
Du darfst den netzfreien Tag heiligen
Du musst ein Datentestament machen
Du sollst nicht töten
Du brauchst keine ›schwachen Beziehungen‹ eingehen
Du sollst nicht illegal downloaden
Du darfst nicht digitalen Rufmord betreiben
Du hast Verantwortung für persönliche Daten anderer
Du gestaltest die Gesellschaft, wenn du dich im Netz bewegst
Anhang
Verwendete und weiterführende Literatur und Internetverweise
Anmerkungen
Die Weltverbesserungsutopie
Meine Tochter Maria und ich haben uns seit Jahren über die Konsequenzen der Digitalisierung unterhalten. Sie ist eine »Digital Native«, eine, die in die vernetzte Welt hineingeboren ist, aufgewachsen mit Computer und Handy und den Möglichkeiten, an vielen Orten zugleich zu sein. Als Zeugin ihres Heranwachsens habe ich gesehen, wie unübersichtlich eine digitale Sozialisation verläuft und wie ungeheuer die Einflussfaktoren dieser digitalen Technologie auf die Entwicklung der Vorstellungswelten junger Menschen sind.
Heute hat sie sich abgenabelt. Von mir, aber auch von dieser Technologie. Sie hat sich Regeln auferlegt, wie sie mit den digitalen Potenzialen umgeht. Maria ist Philosophin und Sozialwissenschaftlerin und arbeitet derzeit über digitale »Citizenship« und die demokratischen Revolutionen, die IT und die digitale Welt hervorgebracht haben. Für sie ist das Netz heute ein Instrument wie das Telefon, das allerdings durch seine globale Verbreitung auch politisch virale Auswirkungen haben kann.
Für mich als Theologin stellen sich mit dieser neuen Technik auch spirituelle Fragen. Denn ist es nicht auch eine Frage der Religion, wie Menschen sich in der Welt verorten? Und stellt die Digitalisierung nicht eine neue Welt, einen neuen Lebensraum dar? Ich frage mich: Können alte und ganz alte religiöse Einsichten über den Menschen helfen, um sich in der neuen digitalen Welt zurechtzufinden? Während ich das schreibe, marschieren russische Truppen in die Ukraine, beschießen sich radikale Islamisten und orthodoxe Juden im Gazastreifen, ziehen schwarzvermummte Krieger auf dem Weg zu einem Gottesstaat marodierend durch Syrien und den Irak, köpfen junge Europäer und machen mit den Bildern auf YouTube Propaganda für eine vorgestrige Lebensform. Man hat den Eindruck, das Virus eines politisch-religiösen Wahns verbreitet sich weltweit – unterstützt durch die neuen Verbreitungsmöglichkeiten.
Ich bin der Überzeugung, dass diese Auflösung politischer Strukturen und diese Radikalisierung nichtstaatlicher Gruppen nicht nur mittelbar mit den globalen Auswirkungen der Digitalisierung im Zusammenhang stehen. Manche Kulturen sind durch den Anschluss ans Netz vom Steinzeitalter in die Moderne gesprungen und nutzen diese Technologie für ihren erbitterten Widerstand gegen die moderne Welt – ein Paradox.
Die neuen digitalen Kommunikationstechnologien verändern die Strukturen unserer Welt in einer Weise, die wir noch gar nicht absehen können. Wir versuchen, die Phänomene mit den Worten der alten Welt zu beschreiben, und spüren, dass wir damit scheitern. Denn natürlich gab es Mobbing schon immer, aber welche neue Qualität hat ein Shitstorm mit Tausenden Followern bei Twitter? Natürlich gab es schon immer Partnerschaftsvermittlungen, was aber bedeutet es für die Partnerbeziehungen, mit zehn oder zwanzig möglichen Partnern permanent virtuell im Kontakt zu bleiben?
Das Thema der digitalen Gesellschaft wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Technologie- und Wirtschaftskreisen vorangetrieben, in denen es um den Ausbau von Infrastruktur und die Überwindung globaler Handelsgrenzen ging. Es wurde exklusiv unter Computerexperten und Nerds verhandelt, die sich für pragmatische Problemlösungen interessierten, nicht aber für die sozialen Folgen dieser Technologie. Die kulturellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen haben noch nicht einmal mit der Gründung der Piratenpartei begonnen, obwohl man am vorläufigen Scheitern dieser Partei beobachten konnte, wie über Jahrhunderte erworbene demokratische Strukturen und Institutionen durch die Basisideologie des modernen Computertechnikmilieus infrage gestellt wurden.
Stück für Stück arbeitete sich die digitale Welt in den Alltag der Menschen in der westlichen Kultur vor: die Computer auf die Arbeitsplätze, die Tablets in die Fernzüge, die Mobilfunkhandys in die Schulhöfe.
Schritt um Schritt arbeitet sich die Technologie auch in das Zeitbudget der Menschen. Die Computernutzung hat bei jungen Menschen inzwischen die Radio- und Fernsehnutzung überholt. Bis zu fünf Stunden verbringen sie vor dem Computer: in sozialen Netzwerken, beim Spielen, Streamen oder beim Surfen.
Langsam wird deutlich: Wir haben es mit einer Medienrevolution zu tun, die die menschliche Kommunikation so tiefgreifend verändert, wie dies in der Geschichte des Abendlandes nur die Erfindung des Buchdrucks und die damit verbundene Enthierarchisierung und Neuformatierung der Kommunikation getan hat.
Nach der anhaltenden Netzeuphorie treten in den vergangenen Jahren auch Kritiker der digitalen Netzkultur auf und enthüllen die Visionen der Internetfirmen und den Preis, den Gesellschaften, Staaten und Individuen für die globale Vernetzung letztlich bezahlen, wenn sie nicht unverzüglich gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Gruppen an neuen Konventionen für die neue Welt arbeiten.
Die Reformation vor fünfhundert Jahren, die mit der neuen Technik auch die Idee der Partizipation etablierte und mit der theologischen Formel vom »Priestertum aller Getauften« die öffentliche Kommunikation revolutionierte, glaubte an das Ende der alten Welt und an einen völligen Neuanfang. Auch die digitale Revolution war und ist verbunden mit der Utopie, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was dies mit Gott zu tun hat und was wir dabei gewinnen und verlieren, davon handelt dieses Buch.
Ich will darüber schreibend nachdenken als evangelische Theologin, Journalistin und nicht zuletzt als Predigerin des Evangeliums von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich weiß mich dabei zugleich mit vielen katholischen Mitchristen eins. Denn die Reformation gehört nicht den Protestanten, sie ist ein Teil unserer gemeinsamen kulturprägenden Geschichte des christlichen Abendlandes – in Licht und Schatten.
Die digitale Welt – neuer Lebensraum mit alten Mustern?
Viermal in der Menschheitsgeschichte hat sich unser Leben durch Erfindungen oder – vielleicht besser – Entdeckungen grundlegend kulturell verändert: Als wir das Sprechen lernten, lernten wir zu lügen, als wir das Schreiben lernten, lernten wir zu planen, mit dem Buchdruck lernten wir das Kritisieren, und mit dem Internet lernen wir, uns miteinander zu vernetzen. Wir überwinden heute medial Raum und Zeit, die Grenzen der Länder und des Leibes. Wir lernen neue Sprachen und neue Worte, wir leben in neuen Horizonten und in einem neuen Takt. Wir denken neu, wir arbeiten neu, wir lernen anders, wir begegnen uns anders.
Die digitale Technik verändert unseren Alltag, wie die Erfindung des elektrischen Lichts im 19. Jahrhundert das Arbeiten, das Zusammenleben und den Tagesrhythmus sowie den Wechsel von Tag und Nacht für die Menschen veränderte, und sie verändert unser Denken, wie nur die Entdeckung der Gnade Gottes für jedermann in der Reformation, Hand in Hand mit der Technik des Buchdrucks, genauer: der Erfindung der beweglichen Lettern, ein neues Zeitalter, die »Gutenberg-Galaxis« einläutete:
Der Buchdruck neigte dazu, die Sprache von einem Mittel der Wahrnehmung zu einer tragbaren Ware zu verändern. Der Buchdruck ist nicht nur eine Technologie, sondern selbst ein natürliches Vorkommen oder Rohmaterial wie Baumwolle oder Holz oder das Radio; und wie jedes Rohmaterial formt es nicht nur die persönlichen Sinnesverhältnisse, sondern auch die Muster gemeinschaftlicher Wechselwirkung.1
Diese Ära des Buches – abgelöst von einem kurzen Jahrhundert-Intermezzo der elektronischen Massenmedien wie Radio und Fernsehen – geht nun auf in der Galaxis des Netzzeitalters, in dem idealerweise jeder Mensch erreichbar ist für jeden und jeder mit jedem in Kommunikation treten kann und wo die Speichervolumina für Daten aller Art unermesslich werden.
Dass jeder Mensch potenziell für den anderen erreichbar und verstehbar sein könnte, ist ein geradezu mythischer Bruch mit der traditionellen Weltwahrnehmung des abendländischen Kulturkreises. Denn die Bibel, das heilige Buch der Juden und Christen und ein Masterdokument für unsere Kultur, erzählt in einer seiner berühmtesten Geschichten, der Geschichte vom Turmbau zu Babel, wie Gott die Kommunikation der Menschheit unterbricht, weil er in der Option gegenseitiger Verständigung die Gefahr der Hybris, der Selbstüberschätzung, erkennt.2 Die Menschen wollen einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, damit sie sich »einen Namen« machen.
Dass wir Menschen Himmelstürmer sind, dass wir in einer »Vertikalspannung« (Sloterdijk) leben, davon erzählt schon die biblische Urgeschichte, in der die Verfasstheit des Menschengeschlechts reflektiert wird. Nach biblischer Analyse muss die Menschheit davor bewahrt werden, sich selbst zu überheben. Der Mensch muss gestoppt werden in seiner Urenergie, die ihn dazu treibt, sein zu wollen wie Gott und damit das Menschengeschlecht zu zerstören.
Die babylonische Verwirrung, Gottes Unterbrechung menschlicher Kommunikation, spiegelt die Erfahrung, dass Menschen auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Sprachen sprechen und sich deshalb nicht verstehen können. Das Versprechen, die Urerfahrung der Unmöglichkeit, menschliche Kommunikation zu heilen, und die Trennung der Menschen durch eine gemeinsame Sprache zu überwinden, gibt die neue Netztechnik: nichts Geringeres als ein technikbasiertes Pfingsten, die Überwindung des Traumas von Babel. Die Netztechnik speist diese Vision biblischen Ausmaßes, dass der Tag kommen wird, an dem mittels Glasfaserkabeln und Übersetzungssoftware die Menschheit sich vernetzt, verständigen und ins Göttliche erweitern kann.
Marshall McLuhan, der Vater der Medienwissenschaften, hat den Begriff der »Medien« so umfassend begriffen wie wir, die Nutzer des Netzes, ihn heute erfahren. Medien sind für ihn nicht einfach Übertragungstechniken, sondern sie haben einen anthropologischen Kern, der in die Dimensionen der Selbstdefinition und des Selbstbewusstseins des Menschen reicht: Medien sind Instrumente der Ich-Erweiterung, die in der Rückkoppelung auf die Menschen und ihre Wahrnehmung prägenden Einfluss nehmen. Die digitale Technik aber repräsentiert bei den Optionen der Ich-Erweiterung einen qualitativen Sprung. So ermöglicht die neue digitale Kommunikationstechnik die Ich-Erweiterung ins schier Unermessliche. Der Traum von der Erweiterung des Ich, vom unbegrenzten Kommunizieren und vom grenzenlosen Gedächtnis: das ist das Versprechen der digitalen Ära.
Ist das gefährlich oder nicht vielmehr großartig? Oder keines von beidem? Sind diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten per E-Mail, Twitter, Facebook, Google und Co. einfach nur alltägliche Gebrauchswerkzeuge für künftige Generationen, die beherrschbar sind?
In jedem Fall sind wir, die wir an dieser Medienrevolution teilhaben, Zeitzeugen eines tiefgreifenden kulturellen Wandels, dessen Ende und Ziel noch nicht abzusehen sind. Wir erleben, wie sich unsere Identitäten neu konstruieren, wie sich Hegemonien neu definieren, wie sich Nationen in neue Konstellationen begeben, wie Kriege neuartig und ganz anders geführt werden, wie ganze Kontinente und ihre Bewohner kleinteilig überwacht werden und wie die verlässlichen Institutionen unserer Gesellschaft unterhöhlt werden und wie auf Treibsand verrutschen.
Wir betreten mit dieser Technik nicht nur ein neues Zeitalter, wir betreten einen neuen Lebensraum, den wir in einer Art »Naturzustand« vorfinden, wo herkömmliche Regeln nicht gelten und die Gesellschaften lernen müssen, neue Regeln auszuhandeln. Viel Zeit wird ihnen nicht bleiben, die Macht der technischen Monopolisten einzugrenzen. Auf vielen Ebenen ist dieser neue Lebensraum eine Herausforderung für theologisches Wahrnehmen und Durchdringen, zumal die Erfinder und Kommentatoren dieser Technologien selbst mit theologischem Vokabular wie I-GOD oder »die heilige Kirche Google« kokettieren.
Vom Menschen Gott zugeschriebene Eigenschaften wie Allwissenheit und Allgegenwart werden nun globalen Wissenssuchern wie Google zugerechnet, die algorithmisch Suchanfragen profilieren und priorisieren. Die Rolle Gottes als dem, der die innersten Geheimnisse eines Menschen kennt, ja der uns besser kennt als wir uns selbst, wird abgelöst durch Überwachungs- und Abhörtechnologien, die in die intimsten Räume eindringen und von denen wir im schlimmsten Fall eines Tages auch die Deutung und Einordnung unseres Lebens entgegennehmen werden sowie die Prognosen unserer künftigen Entwicklungen und Entscheidungen.
Diese Technologien eröffnen einen neuen Umgang mit Texten und anderen traditionellen Autoritäten, sie verwandeln unseren Ethos, also unsere weltanschauliche Innenausstattung, sie verändern die ethischen Fragestellungen in christlicher Perspektive: zum Beispiel die Frage, wer mein »Nächster« sei. Und sie zwingen uns, neu über das Verhältnis von Leib und Seele, von Anwesenheit und Abwesenheit, von Erinnern und Vergessen, von Öffentlichkeit und Geheimnis nachzudenken.
Es wird ein langer Weg sein, bis die herkömmliche Wissenschaft von Gott, die ein so altes Wissen über Medialität und Medien bewahrt, diesen neuen Lebensraum in allen seinen unbekannten bzw. veränderten Phänomenen beschreiben und nach theologischen Kriterien einordnen und deuten kann. Hier soll ein Anfang damit gemacht werden. Im Blick auf die Schriften des Neuen und des Alten Testaments, die als Weltkulturerbe die Visionen menschlicher Kommunikation zutiefst geprägt haben, sollen Modelle erkannt werden für den Umgang mit dem neuen digitalen Kommunikationsraum.
Mit Blick auf die große Medienrevolution vor 500 Jahren, die die Reformation ermöglichte, beschreibe ich im Folgenden Muster des kulturellen Wandels, der, gewollt oder ungewollt, unter dem reformatorischen Leitgedanken der Gnade und der Freiheit in völlig neue Denk- und Deutungsräume führte. Vielleicht können wir – in Analogie und Differenz – daraus lernen für das neue Zeitalter, das die Überwindung von Babel verspricht: die Heilung der gebrochenen menschlichen Kommunikation.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!