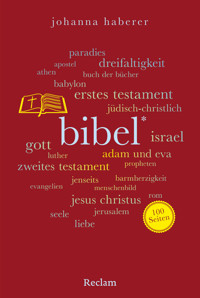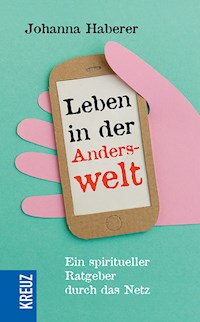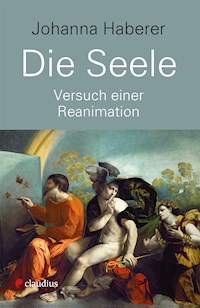
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die jüngste Pandemie-Erfahrung hat die physische Verletzlichkeit des Menschen in den Vordergrund gerückt. Doch wer sorgt sich um die Seele? Weder die Naturwissenschaft und noch weniger die digitale Welt schenken ihr Beachtung. Sollen wir künstliche Intelligenz als anthropologisches Vorbild nehmen? Oder stellt sich die Frage nach dem Menschsein jetzt, in diesen Zeiten, ganz neu? Die Autorin ruft dazu auf, das „Reden von der Seele" als ein Konzept der Geschöpflichkeit in all seinen kreativen, kreatürlichen und auch ambivalenten Dimensionen wiederzuentdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright © Claudius Verlag, München 2021
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München
Umschlagbild: © akg-images / Erich Lessing
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2021
ISBN 978-3-532-60082-5
INHALT
Cover
Titel
Impressum
In einem Wort die ganze Welt
Vom Erlöschen der Seele
Die Spur der Worte
Selbstgespräche
Die Ausbeutung der Seele
Die Sprache der Computer
Menschen haben Seelen und keinen Code
Dataismus – die neue Gnosis
Verteidigung des Menschen
Lob des Körpers
Ein Wort macht eine lange Reise
Die Seelen der Apostel
Seele und Schuld
Seele in Choral und Liturgie
Das betende Tier
Heute von der Seele reden
Anmerkungen
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
Eichendorff
In einem Wort die ganze Welt
Mit der Seele ist es wie mit dem Waldelefanten.
Unzählige Bäume und andere Pflanzen des Regenwaldes nutzen diesen kleinen rundohrigen Elefanten als Transporttier für ihre Samen. Der Elefant frisst die Früchte des Waldes und scheidet die unterschiedlichsten Samen wieder aus. So trägt er sie in entfernte Regionen und verbreitet sie überall hin. Auf diese Weise bleibt der Regenwald am Leben. Sterben die Waldelefanten aus, stirbt auch der Regenwald.
In den Ökosystemen unserer Sprache macht das Wort Seele nichts anders als der Waldelefant.
Die Naturwissenschaften sagen: Eine Seele gibt es nicht. Oskar Wilde formuliert es in seinem Märchen „Der Fischer und seine Seele“ so: „Was nützt mir meine Seele? Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht berühren. Ich kenne sie nicht“.1
Stimmt: Wir können die Seele nicht sehen, sie nicht berühren, nicht wiegen und nicht messen. Trotzdem gibt es ein Wort für sie – in allen Sprachen der Welt. Die Seele ist eine globale Idee.
Und trotzdem: In den Wörterbüchern der Naturwissenschaften und der Medizin, der Neuro- und Kognitionswissenschaften, und auch denen der Psychologie ist das Wort „Seele“ ausgestorben.
Sogar in der wissenschaftlichen Theologie versucht man neuerdings, diesen Begriff zu vermeiden, wohl um an die empirischen Wissenschaften anschlussfähig zu bleiben. Selbst in Bibelübersetzungen probiert nun mancher, den Begriff „Seele“ zu umgehen oder zu ersetzen.
Stellt sich die Frage: Ist diese Entwicklung schlimm?
Ist es nicht ganz normal, dass Worte aus der Mode kommen?
Ich denke, eine Sprache ohne Seele trägt zu einer allgemeinen inneren Verarmung bei. Ob sie das schlimm finden, überlasse ich Ihnen. Ich möchte dem Gedanken nachgehen, was wir verlieren, wenn wir eine seelenlose Sprache entwickeln.
Denn: Wenn wir die Seele aus Denken und Sprache entfernen, weil sie überflüssig erscheint, irreführend oder unklar, so gehen gleichzeitig ungezählte Denksysteme und Gedankenfiguren zugrunde, die mit der Idee einer Seele zusammenhängen. Ein geistiges Artensterben setzt ein. Es vertrocknen jahrtausendealte Theorien über das, was den Menschen ausmacht, im Verhältnis zu sich selbst, zur Mitwelt. Zu Gott.
Sie haben es bestimmt schon gemerkt: Dieses Buch ist ein konservatives Projekt. Ein Projekt zur Arterhaltung. Ein Plädoyer zur Rettung der „Seele“. Ein Plädoyer für eine Nachhaltigkeit des Denkens. Das Plädoyer für eine Rückholung. Eine Re-Animation in des Wortes ureigener Bedeutung.
Denn nicht nur die Seele ist vom Aussterben bedroht. Auch andere Begriffe, die mit ihr eng verwandt, ohne sie vielleicht gar nicht denkbar sind, sind bedroht: Hingabe zum Beispiel oder Glückseligkeit, Barmherzigkeit, Trost und Treue. Hinter jedem dieser Worte eröffnen sich Welten von Annahmen darüber, was der Mensch ist und sein kann, was ihm guttut oder schadet, was er braucht, wonach er sich sehnt.
Für unseren inneren Reichtum und die Nachhaltigkeit unseres Nachdenkens und Fühlens brauchen wir Begriffe, die in der Geistesgeschichte vernetzt sind, wie die Wurzeln der Urwaldbäume. So wie den der Seele.
Wir begegnen ihm in der Philosophie der Antike und in allen Religionen. Das Wort ist Jahrtausende alt und zuhause in Liedern und Gedichten, in Liturgien und Gebeten. Und es wohnt überall dort, wo Menschen nach dem Sinn ihres Lebens fragen und nach Gott. Das Wort für Seele kann japanisch tama oder mitama heißen oder jiva auf Sanskrit, chinesisch Po' oder auch Hun, die Hauchseele. Roho oder mizimu auf Suaheli.
So vielfältig der Begriff in allen Sprachen, so vielfältig die Vorstellungen davon, was die Seele ausmacht, tut und bewirkt. Hält sie den Körper am Leben? Ist sie jenes Prinzip, das Vögel fliegen lässt, Wölfe jagen und Nashörner angreifen? Lässt das Prinzip Seele die Osterglocken blühen und Birken grünen, Menschen weinen und mitleiden und lieben? Oder beschreibt Seele ausschließlich die menschliche Fähigkeit, über sich selbst nachzusinnen, sich zu erinnern und die Zukunft auszumalen?
Womöglich geht unsere Seele auch auf Reisen: Nachts, wenn wir schlafen, macht sie Ausflüge und funkt uns groteske und absurde, wunderliche und wunderbare Bilder zu.
Vielleicht beschreibt „Seele“ auch das, was von uns bleibt, wenn wir den Container unseres Körpers verlassen. Manche Religionen glauben, die Seele steige dann zu Gott empor, kehre förmlich nach Hause zurück. Andere glauben, Seelen versammeln sich bei ihren Ahnen. Wieder andere sind der Überzeugung, die Seele suche sich nach dem Tod ihres Körpers immer wieder eine neue irdische Heimstadt. Je nachdem, wie sie im alten Leben bestanden hat, dann in einer Maus, einem Adler, einem Bettler oder einer Königin.
Schon die unfassbar kunstfertigen Höhlenmaler der Cro-Magnon-Zeit vor 25.000 Jahren haben die Seele gemalt. In der Höhle von Lascaux zum Beispiel zeichneten unsere Vorfahren einen toten Menschen mit einem Vogelkopf und neben diesem Toten (der offenbar von einem Bison angegriffen worden war) ragt ein Stab empor, auf dessen Spitze ein kleiner Vogel sitzt, im Begriffe, sich in die Lüfte zu schwingen.2
Bis heute schaffen Künstler ungezählte Bilder, um die Seele einzufangen: eine junge Frau, ein Säugling, ein Vogel, ein Schmetterling, der sich aus seiner Verpuppung befreit. Oder elementar: die Seele als Wind, als Hauch, Feuer, Licht, Wasser oder Rauch. Sie streicht vorbei, lodert und leuchtet. Macht sich bemerkbar als Schatten, Spiegelbild, Klang. Der Seele haftet stets etwas Unfassliches, Wandelbares, Luftiges und Flüchtiges an. Wenn wir von Seele sprechen, meinen wir das Prinzip Leben, Weiterleben, Überleben. Und die Fähigkeit des Menschen, über sich hinauszuwachsen und zugleich verhaftet zu sein im Netzwerk der Geschöpfe.
Mit dem Begriff der Seele beschreiben wir auch die Spannung zwischen unserer unrettbaren Leiblichkeit und unserer rettungslosen Sehnsucht nach Transzendenz. Unser unaufhörliches Streben nach einem anderen Leben und nach einem Gott. Visionen und Träume, Fantasien und Utopien, all das findet Ursprung und Heimat in dem Spielraum, den wir Seele nennen. Sie ist bei jedem Menschen einzigartig wie der Fingerabdruck, das Ohr oder die Iris.
Die Seele ist das, was uns Menschen als Geschöpf unter Geschöpfen ausmacht. In manchen Kulturkreisen gibt es bis heute die Angst, die Seele könnte verloren gehen, wenn jemand auf ein Foto gebannt wird. Offenbar haben wir geradezu archaische Reflexe, um unsere Seele zu schützen.
Das Aussterben des Gedankensystems rund um die Seele begann mit dem Philosophen, Mathematiker und Aufklärer René Descartes. Mit dem Satz „Ich denke, also bin ich“ wurde er berühmt. Das Gehirn war für ihn das Zentralorgan des Menschen, den er sich ein bisschen wie eine Maschine vorstellte. Diese Spur ist bis heute erkennbar in den Computerwissenschaften, die das Gehirn als Modell für Computernetze denken – und den Menschen als Programm. Mit Descartes begann die Geistesgeschichte systematisch damit, das Seelenleben zuzubetonieren oder auszuradieren.
Andere, neue Worte wurden gefunden („Person“, „Persönlichkeit“, „Ich“, „Selbst“), um den Menschen zu beschreiben, der nun sein eigener Mittelpunkt wurde und darin einzigartig und eigenartig. Nicht länger ein „Geschöpf“, dem etwas (die Seele) von außen eingehaucht werden musste. Heute kann man das menschliche Gehirn in vielen seiner Funktionen beschreiben, zum Teil auch simulieren. Aber kann man mit „Person“, „Selbst“ oder mit „Ich“ die Idee der Seele wirklich ersetzen?
Die politische Philosophin und Mystikerin Simone Weil schreibt 1952 in „Schwerkraft und Gnade“:
Die vollkommene Freude schließt eigentlich das eigene Empfinden der Freude aus, denn in der ganz von ihrem Gegenstand erfüllten Seele ist auch nicht der kleinste Raum mehr verfügbar, um „ich“ zu sagen.3
Seele – ist das womöglich mehr als Ich, Person oder Persönlichkeit? In der Theologie stand das Wort Seele immer für die Unverfügbarkeit des eigenen Lebens, stand für das Leben als Gabe und Geschenk. Es könnte daher sein, dass wir gerade dabei sind, unsere Seele zu verkaufen. Denn die Digitalisierung hat uns nicht nur Amazon beschert, Wikipedia und die Google-Suchmaschine, ohne die man sich das Leben gar nicht mehr vorstellen kann. Sie ist auch dabei, unsere Gefühle, Empfindungen, Meinungen und Ansichten zu vermessen und zu beeinflussen. Mit Hilfe digitaler Logiken werden wir erfasst und errechnet, wir bekommen zu sehen, was der Algorithmus uns sehen lassen will, wir bekommen mitgeteilt, was ein Computer für richtig hält und wir bekommen gesagt, diese Rechenmaschinen seien schneller, präziser, effizienter und letztlich besser als wir selbst – ihre Schöpfer, die Menschen. Rechenmaschinen empfehlen, welche Wege wir mit dem Auto nehmen, was wir essen, kaufen und denken sollen. Es gibt einen Club von Wissenschaftlern, die heute schon davon träumen, irgendwann Gehirne auf Datenträger zu speichern, den lästigen Körper hinter sich zu lassen und in den digitalen Raum zu entschwinden. Auf ewig und damit unsterblich.
Die Vorstellung von der Seele aber – und alles, was an Bedeutungen in diesem Wort haust – widerspricht der Logik von 0/1-Entscheidungen. Seele ist ein Wort des Widerstands gegen die Kontrolle über das Empfinden. Denn: Von der Seele reden heißt, die leibliche Existenz bejahen, heißt Spannungen aushalten, dem Menschen Gutes und Großes zutrauen, heißt, die menschliche Kraft der Sehnsucht, der Vision und der Erfindung bewundern, heißt: gut vom Menschen denken, weil er ein gottgewolltes Geschöpf ist.
Von diesem Geschöpf singt im Alten Testament der Psalm 8:
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. (Psalm 8,4–6)4
Wir wissen, was wir mit den neuen Techniken der Digitalisierung und der Vernetzung gewonnen haben. Die Frage ist jetzt: Was verlieren wir, wenn wir den Menschen als Modell für den Computer betrachten? Und: Welcher Reichtum an religiösen, geisteswissenschaftlichen, philosophischen und poetischen Welten wird mit dem kleinen Wort Seele untergehen?
Vom Erlöschen der Seele
Als der Schriftsteller Hermann Hesse zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einer Indienreise zurückkehrt, schreibt er Reiseerinnerungen nieder, in denen er seiner Bewunderung für die östlichen Kulturen Ausdruck verleiht. Im Vergleich zu ihnen hadert er mit der Seelenvergessenheit des Westens, die Hesse mit der Religiosität der Menschen zusammendenkt.
Er schreibt 1914:
Schließlich aber ist doch ein menschlicher Eindruck der stärkste. Es ist der der religiösen Gebundenheit all dieser Millionen Seelen. Der ganze Osten atmet Religion, wie der Westen Vernunft und Technik atmet. Primitiv und jedem Zufall preisgegeben scheint das Seelenleben des Abendländers, verglichen mit der geschirmten, gepflegten, vertrauensvollen Religiosität des Asiaten, er sei Buddhist oder Mohammedaner oder was immer. Dieser Eindruck beherrscht alle anderen, denn hier zeigt der Vergleich eine Stärke des Ostens, eine Not und Schwäche des Abendlandes, und hier fühlen sich alle Zweifel, Sorgen und Hoffnungen unserer Seele bestärkt und bestätigt. Überall erkennen wir die Überlegenheit unserer Zivilisation und Technik, und überall sehen wir die religiösen Völker des Ostens noch ein Gut genießen, das uns fehlt und das wir eben darum höherstellen als jene Überlegenheiten. Es ist klar, dass kein Import aus Osten uns hier helfen kann, kein Zurückgehen auf Indien oder China, auch kein Zurückflüchten in ein irgendwie formuliertes Kirchenchristentum. Aber es ist ebenso klar, dass Rettung und Fortbestand der europäischen Kultur nur möglich ist durch das Wiederfinden seelischer Lebenskunst und seelischen Gemeinbesitzes. Ob Religion etwas sei, das überwunden und ersetzt werden könne, mag Frage bleiben. Dass Religion oder deren Ersatz das ist, was uns zutiefst fehlt, das ist mir nie so unerbittlich klar geworden wie unter den Völkern Asiens.5
Hesse schreibt diese Worte nieder am Vorabend des ersten Weltkriegs. Die Industrialisierung hat sich in Europa ausgebreitet, die Ingenieurskunst einen rasanten Fortschritt angeschoben. Der Kohleabbau, die Stahlproduktion, die aufstrebende Automobilindustrie und die Waffenindustrie werden zu Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung. Deutschland ist hochgerüstet, ebenso die anderen europäischen Länder. Es raucht und stampft in den Zentren der Industrie.
Das Milieu der Arbeiter hat sich in politischen Parteien definiert und es regt sich der Zweifel bei europäischen Intellektuellen, ob mit der anwachsenden Macht der Maschinen nicht auch die Seelen der Menschen verloren gehen könnten. Hesse beschreibt die Seele als einen Ort, in dem Zweifel, Sorge und Hoffnung wohnen und er träumt vom Wiederfinden der „seelischen Lebenskunst“ und des „seelischen Gemeinbesitzes“. Im Westen vermisst er eine „geschirmte, gepflegte und vertrauensvolle Religiosität“. Der erste Weltkrieg mit seinen Millionen Toten scheint dann wie ein Beweis für den gigantischen kollektiven Verlust, der mit dem Erlöschen der Seele einhergeht.6
Ein knappes Jahrzehnt später, 1922, rechnet der linke Autor Ernst Toller in seinem Stück „Die Maschinenstürmer“ mit dem Maschinenzeitalter ab. Der Plot verlegt die Debatte ins Jahrhundert zuvor: Die Textilarbeiter Nottinghams sollen 1815 im Aufkommen des Frühkapitalismus durch Maschinen ersetzt werden. Zwei Arbeiterführer mobilisieren die Massen: Jimmy Cobbett predigt Verhandlungen und einen politischen Weg, um die Arbeitsverhältnisse zu verändern. John Wible dagegen setzt auf Gewalt und Zerstörung der Maschine. Ein wahnsinniger Ingenieur, dessen Seele über dem Bau der Maschinen zerstört wurde, tritt auf und verkündet die Macht der Maschinen über die Menschen.
Ingenieur auf der Brücke mit irrer Gebärde:
Hihuhahaha. Ich aber sage euch, die Maschine ist nicht tot … Sie lebt! Sie lebt …
Ausstreckt sie die Pranken, Menschen umklammernd krallend die zackigen Finger ins blutende Herz …
Hihuhahaha … Hihuhahaha
Gen die umfriedeten Dörfer wälzen sich stampfende Heere …
Hindorren die Gärten, verpestet vom schweflichen Hauch
Und es wachsen die steinernen Wüsten, die kindermordenden
Und es leitet ein grausames Uhrwerk die Menschen
In freudlosem Takte …
Ticktack der Morgen … Ticktack der Mittag … Ticktack der Abend …