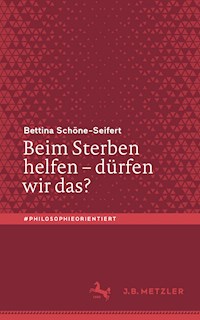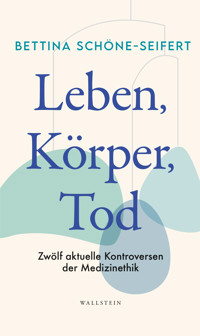
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Suizidhilfe, Optimierungsmedizin, Demenzverfügungen: Worüber wird da gestritten? Mit welchen Argumenten? Was überzeugt? Medizinethik zum Mitdenken und kleine Geschichten zum Einsteigen. Der Umgang mit den Möglichkeiten moderner Medizin geht uns alle an. Die Medizinerin und Philosophin Bettina Schöne-Seifert behandelt zwölf aktuelle Streitthemen – darunter Suizidhilfe, Demenzverfügung, Organspende, Leihmutterschaft und KI-Medizin. Stets eingeleitet von einer fiktionalen Kurzgeschichte folgen sachliche Hintergrundinformationen, bevor es um die eigentlichen Kontroversen geht. Was sind die strittigen Fragen? Wie lauten die Argumente? Was überzeugt? Abgerundet wird der Band durch grundsätzliche Überlegungen zur Selbstbestimmung, zum Paternalismus und zum Gemeinwohl in der Medizin. Starke Meinungen und Fazit-Vorschläge der Autorin, die Mitglied des Deutschen Ethikrats war, laden zum Nachdenken und zum Abwägen ein. Bettina Schöne-Seifert bietet Medizinethik zum Mitdenken und als eine Herausforderung. Das zugänglich und verständlich geschriebene Buch wendet sich nicht nur an Fachleute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Schöne-Seifert
Leben, Körper, Tod
Zwölf aktuelle Kontroversen der Medizinethik
Bettina Schöne-Seifert
Leben, Körper, Tod
Zwölf aktuelle Kontroversen der Medizinethik
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2025
Wallstein Verlag GmbH
Geiststr. 11, 37073 Göttingen
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Marion Wiebel, Wallstein Verlag
ISBN (Print) 978-3-8353-5961-1
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8937-3
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8938-0
Inhalt
Vorwort
KAPITEL 1
Demenz: Darf ich über mein späteres Ich verfügen?
KAPITEL 2
Organspende: Wie bloß regeln?
KAPITEL 3
Optimierungs-Medizin: Warum denn nicht?
KAPITEL 4
Dein Bauch gehört dir? Embryonen-Ethik
KAPITEL 5
Hilfe beim Suizid: Eine ärztliche Aufgabe?
KAPITEL 6
Kügelchen & Co: Alternativmedizin unter Beschuss?
KAPITEL 7
Nahrungsverzicht und Fütterverbot: Zulässige Sterbewege?
KAPITEL 8
Triage: Dürfen Zahlen zählen?
KAPITEL 9
Kinder unterm Regenbogen: Was spricht denn dagegen?
KAPITEL 10
Hirntot, herztot, mausetot: Todesverständnis à la carte?
KAPITEL 11
Impfen: Darf man dazu zwingen?
KAPITEL 12
Ärzte oder Künstliche Intelligenz: Wem kann man vertrauen?
Grundsätzliches I: Patientenautonomie
Grundsätzliches II: Paternalismus in der Medizin
Grundsätzliches III: Gemeinwohl in der Medizin
Dank
Literaturverzeichnis
Vorwort
Niemand will krank sein und niemand möchte Medizin in Anspruch nehmen müssen. Wir sind froh, dass es sie gibt, aber besonders froh, wenn wir selbst und unsere Nächsten sie gar nicht brauchen. So gesehen halten die meisten Menschen auch zu Fragen der Medizinethik einen gewissen Abstand. Das kann sich schlagartig ändern, wenn Krankheiten oder auch nur Krankheitsrisiken auftreten. Es kann sich aber auch ändern, wenn man anfängt, Medizinethik als einen nicht ganz unwichtigen Teil unseres Lebens, unserer Kultur und unseres Umgangs miteinander zu verstehen. Dazu soll dieses Buch beitragen.
Behandelt wird eine Auswahl aktueller Fragen der Medizinethik. Viele von ihnen kreisen um Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten und darum, wie man diesen zentralen Wert moderner Medizinethik interpretieren, begründen, abwägen und begrenzen sollte. Ausgeklammert habe ich hingegen fast alle Fragen der medizinischen Verteilungsgerechtigkeit sowie Fragen zur Handhabung von Forschung, Fortschritt und Qualität; und schließlich Fragen, die sich auf neuartige Eingriffsmöglichkeiten beziehen – etwa in der Genetik, der synthetischen Biologie oder der Neurotechnologie. Das alles wäre Stoff für eine weitere Abhandlung.
Der erste Teil des vorliegenden Buchs behandelt zwölf konkrete und aktuelle Streitfragen. Diese Kapitel haben immer denselben Aufbau: Am Anfang steht eine fiktionale STORY. Danach folgen der faktische Hintergrund und die ethische Kontroverse. Abschließend formuliere ich mein Fazit. In der Schilderung der Kontroversen bringe ich meine Meinung deutlich zum Ausdruck. Das kann für manche Leser provozierend sein. Aber das Buch erfüllt auch dann seinen Zweck, wenn meine Sichtweisen zurückgewiesen, dafür aber die Fallgeschichten als lesenswert, die Hintergründe als erhellend und die Darstellungen der Kontroversen als klärend empfunden werden.
Der zweite Teil des Buches liefert nachträglich ein wenig Theorie zu grundlegenden Fragen, wie sie im Hintergrund der konkreten Kontroversen stehen: zu Fragen nach Selbstbestimmung, Paternalismus und Gemeinwohl. Dieser Teil des Buches kann unabhängig von den ersten zwölf Kapiteln zur Vertiefung des Hintergrundwissens gelesen werden.
Übersprungen werden können auch die nachfolgenden einleitenden Überlegungen.
Dies ist, wie gesagt, ein Buch über Fragen der Medizinethik. Was ist damit gemeint? Hier eine kleine Begriffsklärung:
Moral liefert Maßstäbe und Anweisungen für gutes oder richtiges Handeln. Dabei geht es zumeist um Handeln, das die Interessen und Anrechte anderer Menschen berührt. Wir alle wissen: Moral ist in vieler Hinsicht strittig, wandelbar, ergänzungsbedürftig – nicht zuletzt im Lichte neuer Erkenntnisse, Handlungsmöglichkeiten oder Bewertungen.
Ethik wird im Folgenden als das (in erster Linie: handlungsorientierende) Nachdenken und Stellungnehmen zu Fragen der Moral verstanden: als Theorie der Moral.
Medizinethik meint also das Nachdenken und Stellungnehmen zu Fragen, wie wir mit Krankheit, Sterben und moderner Medizin umgehen sollten.
Über Medizinethik ist in den letzten 50 Jahren sehr viel geschrieben worden. Einerseits nämlich stellen sich durch die Fortschritte der Medizin und durch die Weiterentwicklung anderer Aspekte unseres Lebens etliche realistische und zum Teil drängende Neulandfragen, die früher geradezu zur Science-Fiction gezählt hätten. Andererseits sind unsere moralischen Vorstellungen vom richtigen Leben und Sterben deutlich vielstimmiger und weniger autoritätsbestimmt geworden. Das bietet den Rahmen für mancherlei Kontroversen.
Dieses Buch hebt sich von der medizinethischen Fachliteratur ab, die sich an ein Fachpublikum richtet. Aber natürlich bieten die vielen klugen Gedanken meiner Kolleginnen und Kollegen die unverzichtbare Grundlage für die Fragestellungen und Argumente, die ich aufgreife und diskutiere. Abheben will ich mich auch von der großen Menge der Ratgeberliteratur mit ihren Fragen wie: Was sage ich zum Suizidwunsch eines Nahestehenden? Wie verfasse ich eine Patientenverfügung? Wie soll ich mit einer Krebsdiagnose umgehen?
Dieses Buch nimmt also eine Position jenseits von wissenschaftlicher Fachliteratur und Ratgeberliteratur ein. Es soll das Nachdenken über medizinethische Fragen ins Alltagsleben holen. Denn medizinethische Fragen gehören in unseren Alltag, weil wir alle eines Tages Patientinnen und Patienten werden oder dies bereits sind. Auch sind wir fast alle Angehörige von Patienten und Patientinnen und überdies Mitglieder einer Gesellschaft, deren Krankenversorgungssystem immer wieder vor neuen Herausforderungen und Entwicklungen steht. Auf diese Weise geht Medizinethik uns alle etwas an. Deshalb sollte man ihre Fragen und Antworten nicht allein Fachleuten oder Politikerinnen und Politikern überlassen oder auf das bisher Übliche setzen und auf eigene Intuitionen.
Von hier an verzichte ich in diesem Buch auf gendersensible Sprache mit Doppelformen oder typografischen Markierungen. Als Autorin vertraue ich darauf, dass man mir das Mitdenken aller Geschlechter auch so abnimmt. Dieses Mitdenken ist mir wichtig.
Als ich in den 1980er Jahren anfing, Vorträge oder Vorlesungen über Medizinethik zu halten, schienen mir zwei Vorbemerkungen unverzichtbar: erstens ein Hinweis darauf, dass sich eine deutsche Medizinethikerin immer der nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen bewusst sein müsse. Zweitens die Warnung, dass meine Zuhörer von der Medizinethik keinesfalls persönliche Lebenshilfe erwarten dürften.
Die erste Bemerkung sollte erkennbar machen, dass ich sensibel sei für die tiefen Spuren, welche die nationalsozialistischen Gräueltaten für alles künftige Räsonieren über Medizinethik hinterlassen haben. Sensibel dafür, dass man im Land der Täter des Nazi-Regimes nicht unbelastet über Euthanasie oder Eugenik reden kann. Schon gar nicht in den 1980er Jahren, in denen die zähe und langsame Aufarbeitung dieser Verbrechen gerade erst eingesetzt hatte. Zugleich allerdings haben Kritiker von Sterbehilfe oder von elterlich gewünschten vorgeburtlichen Gentests ihre Positionen allzu oft damit zu begründen versucht, dass diese Praktiken in der Nähe der Nazi-Verbrechen lägen oder zu ihnen zurückführen könnten. Die Zeiten solcher Vereinfachungen und Unterstellungen sind inzwischen vorbei, zum Glück.
Die zweite Bemerkung – Medizinethik könne keine Lebenshilfe (im Sinne von Lebensorientierung) leisten – halte ich aus heutiger Sicht für falsch. Sie war damals Ausdruck meiner Hilflosigkeit und Nichtzuständigkeit für die persönlichen Belastungen, mit denen die in Rede stehenden Entscheidungen im Leben einhergehen können. Aber in ihrer Verallgemeinerung ist diese zweite Bemerkung arrogant und auch töricht, weil sie verkennt, dass Lebensorientierung auch in Nachdenken bestehen kann, nicht zuletzt im Nachvollziehen ethischer Pro- und Kontraargumente. Lebensorientierung kann aus der Einsicht erwachsen, dass die Dinge klar oder auch gar nicht klar liegen; dass man sich durch ein bestimmtes Handeln nicht schuldig macht; dass bestimmte moralische Traditionen schlicht überholt sind. Natürlich kann Ethik sich nicht anmaßen, den psychischen oder sozialen Dimensionen beispielsweise einer Abtreibung oder eines Entschlusses zum Sterbefasten gerecht zu werden. Lebenshilfe hat jedoch verschiedene Quellen – und Ethik kann durchaus dazu gehören. Dabei verstehe ich Ethik, wie oben eingeführt, vornehmlich als ein Unterfangen der Vernunft, bei dem es um die Überzeugungskraft von Argumenten geht. Dass sich dabei auch Emotionen und Intuitionen einstellen, ändern oder verfestigen, ist unbenommen. Dazu gleich mehr.
Die hochgradige Akademisierung der Diskussion ethischer Kontroversen ist eine neuzeitliche Entwicklung. Während antike Philosophen oder mittelalterliche Kirchenväter sich an gebildete Laien wandten, sprechen die vielen Experten, die heute über ethische Fragen nachdenken und schreiben, vorwiegend miteinander und nicht mit der großen Zahl von Betroffenen und Interessierten. Die Argumentation ist eminent kleinteilig und voraussetzungsreich geworden und die Fachsprache ist für Außenstehende oft unverständlich. Wer etwa könnte ohne Weiteres etwas anfangen mit dem »Aggregationsproblem« in der Triage-Debatte oder mit dem »Potenzialitätsargument« in der Kontroverse um Embryonenschutz? Damit man mich nicht missversteht: Das Analysieren von Begriffen, das Zergliedern von Fragestellungen und das Delegieren komplexer Ethikfragen an Experten und Gremien ist wichtig und folgerichtig angesichts der unübersichtlich vielen Fragen und möglichen Antworten. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bestimmte Fragen und Antworten mit Gewinn auch wieder an die Betroffenen zurückgespielt werden sollten.
Natürlich gibt es bereits vielfältige Versuche, dies zu tun: so in Talkshows und Podcasts, in öffentlichen Sitzungen des Deutschen Ethikrats und nicht zuletzt im schulischen Ethikunterricht. Das vorliegende Buch reiht sich hier als eigenständiger Beitrag ein. Es will Verständlichkeit ohne Verlust an Komplexität leisten und Rationalität ohne Verlust an emotionalen Untertönen. Dieser letzte Punkt scheint mir noch eigens erwähnenswert. Über die Frage, ob Vernunft oder Gefühle unsere moralischen Urteile erzeugen und erzeugen sollten, gibt es unter Gelehrten eine jahrhundertelang währende Debatte. Mehrheitlich meint man heute, dass beides im Spiel ist und sein sollte. Gerechtigkeitsempfinden, Entsetzen oder Beschämung können Haltungen vermitteln und moralisches Handeln zur Selbstverständlichkeit werden lassen, können uns aufrütteln und zum Nachdenken und Widersprechen bringen. Vernunft hingegen kann neue Probleme in ältere Zusammenhänge stellen, Begründungen und Stimmigkeiten prüfen, Hintergrundannahmen identifizieren oder in Frage stellen. Aber auch wenn das Ideal moralischer Überzeugtheit darin gesehen werden kann, Intuitionen und Argumente in Einklang zu bringen, wäre es wirklichkeitsfremd, die Vernunftleistungen zu überschätzen.
Gerade in letzter Zeit scheint sozialwissenschaftlich wieder mehr in den Blick zu geraten, wie verbreitet, ja ausschlaggebend für menschliches Handeln und Wohlbefinden der Konsens, also der Bereich mit anderen geteilter Annahmen ist. Selbstbewusstsein, soziale Geborgenheit und soziale Zugehörigkeit werden auch dadurch hergestellt, dass wir uns im Einklang mit anderen wissen. Ob dies nun in Glaubensgemeinschaften, in Parteien, in sozialen Gruppierungen oder in bestimmten sozialen Schichten erfolgt: Die festigenden Effekte können zum Teil daraus resultieren, dass man gemeinsame Werte und Normen gerade nicht diskutiert, sondern für ›gesetzt‹ hält. Oder daraus, dass man lieber gewisse unhinterfragte Differenzen hinnimmt, als Grundsatzfragen zu stellen. Wie problematisch solche Gruppenautorität allerdings sein kann, erleben wir in Zeiten politischer Radikalisierungen und digitaler Parallelwelten. Auch die Medizinethik kann an unaufgeklärten Stellvertreterfronten leiden. Vernunftgeleitete Kritik an Prämissen ist immer Aufklärung im besten Sinne. Auch das sollte in diesem Buch sichtbar werden.
Der zweite Teil des Buchs ist abstrakter, theoretischer und kürzer. Er behandelt einige strittige Aspekte der philosophischen Debatten über Selbstbestimmung, Paternalismus und Gemeinwohl. Ich habe mich dabei auf Fragen konzentriert, die für die Medizinethik von Bedeutung sind. Daher gibt es zwischen dem praktischen und dem theoretischen Teil eine Reihe von Querverbindungen, denen man aber nicht nachgehen muss. Auch und gerade im Theorieteil kann ich meine Fragen nicht erschöpfend diskutieren und möchte vor allem zum Mitdenken einladen.
KAPITEL 1
Demenz: Darf ich über mein späteres Ich verfügen?
DIE STORY: Margota
Als er sie kennenlernt, ist Margota eine immer noch schöne Frau, mit 85 Jahren und einer fortgeschrittenen Altersdemenz. Ihr sanft-spöttischer Blick aus großen Augen berührt ihn. Klare, einnehmende Gesichtszüge.
Bei ihrer ersten Begegnung sitzt sie aufrecht in zerwühlten Kissen und starrt ihn an. Man hat ihm, dem neuen Praktikanten im Pflegeheim, Margota neben drei anderen Patientinnen zum »Essenanreichen«, für die »Hygiene« und »auch sonst« zugeteilt. »Das kriegst du schon hin!« Sie trägt ein fleckiges Nachthemd und ein altmodisches, dreireihiges Perlen-Collier. Ihre Anmutung ist selbstsicher, aber ihre Hörgeräte scheinen nicht zu funktionieren. Er stellt sich lautstark als Praktikant vor, der ihr beim Frühstück helfen wolle. Sie reagiert nicht. Als er sich bemüht, ihr ein Lätzchen umzubinden, stößt sie wortlos seine Hand weg. Dann eben ohne Lätzchen. Er versucht, ihr die Tülle einer Schnabeltasse mit Kamillentee und die Weißbrotwürfel mit Marmelade in den Mund zu bugsieren. Denkt, man hätte ihn ruhig besser vorbereiten können.
Im Lauf der nächsten Wochen lernt er tastend, sich mit Margota zu unterhalten: beim Füttern und Waschen, beim Herumschieben im Rollstuhl, beim Sitzen an ihrer Seite. Er siezt sie. Wenn sein Dienstplan es erlaubt und sie es zulässt, massiert er ihre Hände oder sie blättern gemeinsam in ihren Fotoalben. Manchmal erzählt er ihr von kleinen Begebenheiten, und sie murmelt Kommentare, lacht oder verzieht das Gesicht. Oder er stellt Fragen, und sie spricht daraufhin zu ihm: oft desorientiert und verwirrt, aber dann in einzelnen Punkten auch wieder passend, witzig, anspruchsvoll formuliert. Zu solchen kleinen Inseln erhaltener Zusammenhänge gelangen sie, wenn sie an zeitlose Themen rühren und wenn es ihr gut geht. Öfter noch verständigen sie sich ohne Worte: mit Blicken, mit einem Streicheln.
Margota kann sich nur noch unbeholfen bewegen, daher der Rollstuhl. Wenn niemand Zeit für sie hat, wird sie in einen der Gemeinschaftsräume geschoben, im Jogginganzug. Dort läuft das Kinder-TV. Es gibt große Grünpflanzen, FIMO-Knete und andere Heimbewohner. Die meisten von ihnen tragen ebenfalls Jogginganzüge, manche auch Bademäntel. Aus Margotas Fotoalben, ihren Rede-Inseln, der Patientenakte und dem gelegentlichen Tratsch im Schwesternzimmer setzt sich in ihm ein löchriges Puzzle zusammen: Sie hat, für ihre Generation noch ungewöhnlich, Berufstätigkeit und Muttersein vereinbaren können. Viele Jahre lang ist sie Direktorin einer Gesamtschule gewesen. Zu ihrem Leben gehörten ein Ehemann und eine Tochter, zwei Enkel, Freunde, Kammermusik und Reisen. Es gibt schöne Bilder von ihr: ernsthaft, elegant, lachend. Dann die Demenz-Diagnose vor vier Jahren, die Heimeinweisung vor zwei Jahren, der Tod ihres Mannes vor einem Jahr. Jedes Wochenende Besuch von der Tochter, häufig auch von den Enkeln. Die alle hat er selbst nie getroffen, weil er an den Wochenenden nicht arbeiten muss. Aber die anderen im Team sind voller Anerkennung.
Vier Monate später, in den nächsten Semesterferien, arbeitet er wieder im Pflegeheim. Seine erste Frage im Schwesternzimmer gilt Margota. Ja, sie sei noch hier, ihre Demenz fortgeschritten, ihr Gesamteindruck eher fröhlich. Sie wird ihm, wie er es erbittet, erneut zugeteilt. Als er an ihr Bett tritt, dämmert sie vor sich hin. Sie scheint dünner geworden, ihre Haut spannt sich leicht gelblich über den Wangenknochen.
In den folgenden Wochen versucht er, ihre kleinen Routinen wieder aufzunehmen. Margota scheint ihm entrückter. Er kann sie seltener erreichen, seltener zu einem Lächeln, zum Reden oder Brabbeln bewegen. Das Füttern dauert länger. Aber zugleich zeigt sie keine Anzeichen von Angst, Aggression oder Verzweiflung. Auch nicht, wenn er danach sucht.
Am dritten Montag dieses Praktikumsblocks findet er weder Margota noch ihr Bett in ihrem Zimmer. Sie sei auf der Pflegestation, sagt man ihm, zur Behandlung einer akut aufgetretenen Lungenentzündung. Zehn Tage Penizillin über einen Tropf, eine vorübergehend gelegte Ernährungssonde, gute Heilungsaussichten. Nein: Besuchen könne er sie nur in seiner Freizeit, er werde dringend an anderer Stelle gebraucht. Noch am selben Nachmittag geht er nach Dienstschluss zu ihr hinüber. Sie liegt in einem hellen Zimmer mit vier Krankenbetten.
Er kann nicht sagen, ob Margota ihn erkennt. Sie hat eine Nasensonde im Gesicht, die mit Pflaster an den Wangenknochen fixiert ist; ihre Hände stecken in weichen Fäustlingen; am Kopfende piepst ein Monitor, am Bett hängt ein Beutel mit Urinkatheter-Anschluss. Sie stöhnt leise vor sich hin und wirkt unruhig. Er setzt sich auf die Bettkante und beobachtet eine resolute Krankenschwester, die einen Kontrollgang von einer Patientin zur anderen macht. Einer jeden streicht sie leicht über Hand oder Arm und nickt zufrieden. Als sie zu ihnen tritt, deutet er fragend auf Margotas Handschuhe. »Sie hat sich schon zweimal die Sonde rausgezogen. Die wieder reinzufummeln, ist unangenehmer für sie, als diese Wattehandschuhe es sind.« Bevor er geht, flüstert er Margota ein paar Koseworte ins Ohr, die ihm draußen auf dem Heimweg ein wenig peinlich sind.
Am Tag darauf wacht er mit Kopfschmerzen auf, hat Fieber und muss sich krankmelden. Erst eine knappe Woche später kann er wieder arbeiten. Im Dienstzimmer herrscht helle Aufregung, weil mehrere Pflegekräfte und Praktikantinnen nach ihm krank geworden sind. Er beginnt mit seinem heute doppelten Pensum an Füttern, Wickeln, Anziehen, Rollstuhlschieben und wagt es vorerst nicht, nach Margota zu fragen. In ihrem alten Zimmer liegt eine andere Dame. Bei seinem Dienstschluss sind alle, die er ansprechen könnte, beschäftigt, und so geht er zögernd auf die Pflegestation hinüber. Dort sind alle vier Betten belegt – keines durch Margota. Ihm wird ein wenig blümerant, wie seine Großmama es genannt hätte, und er muss sich überwinden, den diensthabenden Pfleger anzusprechen. »Krankenhaus«, sagt der knapp, die Lunge habe nicht mehr richtig mitgespielt.
Fünf Tage später, der Krankenstand hat sich deutlich gebessert, können sie sich im Dienstzimmer eine gemeinsame Kaffeepause leisten. Jemand hat Geburtstag: selbstgebackener Kuchen, den sie am Tisch essen. »Sowas war vor zehn Jahren noch normal – und es war wichtig, oder? Heute trinken wir Kaffee im Vorbeilaufen und schlingen im Stehen was hinunter«, sagt irgendjemand. Sie nutzen die Zeit für einen Austausch über ihre Patienten. Die erste Info: Margota sei vorgestern im Krankenhaus an Lungenversagen gestorben. »Wie gut für sie«, »wie traurig«, »wie richtig« hört er. Die Tochter sei dabei gewesen. Ausgerechnet er bekommt den Auftrag, Margotas Sachen zusammenzupacken. Ein Spind im Keller, eine Kiste im Stationsschrank. Am Abend will die Tochter kommen und alles abholen. »Mach’s mit Taktgefühl«, sagt man ihm. »Peinliches, Überflüssiges und ganz Unansehnliches gleich aussortieren.« Er nickt. »Und lass dir ruhig etwas Zeit«, schiebt die Stationsleiterin nachdenklich hinterher.
Er setzt sich auf den Fußboden eines kleinen Nebenzimmers, in das er alle Sachen getragen hat. Vier Stunden Zeit für seinen Abschied von Margota. Noch einmal blättert er durch die Fotoalben. Keine Beschriftungen, aber sorgfältig eingeklebte Bilder. Wie sympathisch ihr Mann wirkt, wie klug sie selbst. Immer hatte er übersehen, dass sie offenbar auch einen Hund besaßen – war es auf allen Bildern derselbe? Er schmeißt Q-Tipps weg, feucht gewordene Kukident-Tabletten, Einlagen, eine Sonnenbrille mit gebrochenem Bügel und zwei arg zerschlissene Nachthemden. In die Tochter-Kiste kommen die Jogginghosen und die Fotoalben, ein Schmuckkästchen und das Perlen-Collier, das sie bei ihrer ersten Begegnung getragen hatte. Dazu Adiletten, ein Bademantel und ein Portemonnaie mit einem 10-Euro-Schein und einem Foto ihrer Enkel.
Beim Weitersortieren findet er ein Kuvert mit der Kuli-Aufschrift »Patientenverfügung«. Der Umschlag ist nicht verschlossen, darin zwei doppelseitige Formblätter mit mehreren Freitext-Feldern, alles sorgfältig mit handschriftlichen Druckbuchstaben ausgefüllt. Unterschrieben vor dreieinhalb Jahren, flüssig in grüner Tinte:
Bei mir wurde vor wenigen Monaten eine Demenz diagnostiziert.
Wenn sie fortschreitet und ich nicht mehr urteilsfähig bin, möchte ich an jeder hinzukommenden Krankheit sterben dürfen, indem man sie nicht behandelt: zum Beispiel keine Wiederbelebung bei Herzstillstand, keine Blutwäsche bei Nierenversagen, keine Antibiotika bei Entzündungen. Bitte! Immer nur Schmerzlinderung. Wenn ich nicht mehr essen und trinken möchte, bitte keinen Zwang, keine Sonden und keinen Tropf anwenden. Kein Krankenhaus, auch nicht vorübergehend. Das ist meine persönliche Vorstellung von Würde. Ich schreibe dies bei noch vollem Verstand. Bitte!
Ich hatte ein glückliches Leben, werde noch immer geliebt und umsorgt. Ein Verdämmern in schwerster Demenz möchte ich für mich und meine Liebsten, wenn irgend möglich, vermeiden.
Er rennt ins Dienstzimmer. Wartet, bis die Stationsleiterin kommt und reicht ihr die Patientenverfügung. »Warum?«, fragt er beinahe tonlos. »Wusstet ihr das nicht?« »Doch«, antwortet sie mit fester Stimme. »Und wir haben es uns damit nicht leicht gemacht. Setz dich doch einen Moment, wenn du magst. Ich habe damit gerechnet, dass du kommst.« Er sackt auf den nächsten Stuhl, sie schließt die Tür und nimmt ihm gegenüber Platz.
»Irgendwann nach Margotas Einzug bei uns brachte ihr Mann diese Patientenverfügung, die man anfänglich mitzugeben vergessen hatte. Ich erinnere mich noch gut: Er war älter als sie, sehr besorgt und sehr überfordert. Damals war von körperlichen Krankheiten bei Margota noch keine Rede. Sie musste nur auf Schritt und Tritt überwacht werden – das ging zuhause einfach nicht mehr.
Bald nach seinem Tod wurde sie bettlägerig und bekam eine Lungenentzündung. Wir haben damals im Team beraten, wie sehr wir … also, wie verbindlich ihre Verfügung noch für uns oder für sie wäre. Mit unseren beiden Ärzten, mit der Pfarrerin und natürlich mit der Tochter. Einig waren wir uns, dass sie in ihrer Demenzwelt nicht überwiegend unglücklich oder leidend schien, im Gegenteil. Das war doch auch noch so, als du sie kennengelernt hast, oder? Daher wäre eine simple Penizillinbehandlung ohne Frage richtig gewesen, hätte sie nicht diese Verfügung gehabt.«
Sie streicht sich müde ein paar Haarsträhnen aus der Stirn. »Diese Verfügung nun aber war, wie soll ich sagen, von einer anderen Person verfasst und begründet worden als von der gegenwärtigen Margota. Die nämlich versteht ja gar nicht mehr, was sie früher, eher abstrakt, über Würde und angemessenes Leben und Sterben gedacht hat. Warum sollten diese damaligen Vorstellungen dann jetzt noch der Maßstab für unseren Umgang mit ihr sein? Es schien irgendwie … ja: formalistisch und unmenschlich. Davon war am Ende auch Margotas Tochter überzeugt. Sie wurde also behandelt, mit raschem Erfolg. Und genauso haben wir dann auch jetzt, bei der zweiten Lungenentzündung, wieder entschieden. Verstehst du das?«
Er schweigt, wiegt den Kopf und wischt sich eine Träne aus den Augen.
Hintergründe und Fakten
Patientenverfügungen (speziell für Demenz)
Die moderne Medizin hat, besonders seit den 1960er Jahren, immer mehr Möglichkeiten zur Lebensrettung entwickelt: wirksame Medikamente, maschinelle Wiederbelebung, künstliche Beatmung und Ernährung, Blutwäsche und vieles mehr. So segensreich diese Maßnahmen für die Betroffenen meist sind, gilt das doch nicht in allen Fällen. Daher verweigern manche Patienten ihre Zustimmung zu solchen Maßnahmen. Zudem machen immer mehr Menschen Gebrauch von einer Patientenverfügung: für mögliche oder absehbare zukünftige Fälle, in denen sie – vorübergehend oder dauerhaft – nicht mehr entscheidungsfähig sind. Oder sie ermächtigen vertraute Personen, dann als ihr Sprachrohr zu dienen. Auf beiden Wegen können sie mögliche spätere Behandlungsmaßnahmen nach ihren Wünschen untersagen oder begrenzen. Etwa seit der Jahrtausendwende sind diese Instrumente der vorausgreifenden Selbstbestimmung in Deutschland gesellschaftlich breit akzeptiert und grundsätzlich rechtsfest.
Ein Ausnahmeproblem können jedoch Verfügungen aufwerfen, die speziell auf eine fortgeschrittene Demenz abzielen. Eine solche »Demenzverfügung« kann ein eigenes kleines Schriftstück sein oder ein Zusatz zu einer umfassenderen Patientenverfügung. In der Regel verbietet darin der Verfasser bestimmte oder alle lebenserhaltenden medizinischen Behandlungen, zumeist für diejenige Demenzphase, in der er seine »Angehörigen nicht mehr wiedererkennt« oder in seinen Kompetenzen vergleichbar eingeschränkt ist.
Das angesprochene Ausnahmeproblem entsteht immer dann, wenn der von einer solchen Anweisung betroffene Patient (zu dessen fortgeschrittener Demenz zum Beispiel eine Lungenentzündung hinzukommt) auf seine Umgebung gleichwohl »lebensfroh« wirkt. So, dass man ihn ohne eine Verfügung, die das verbietet, selbstverständlich mit einem Antibiotikum behandeln würde, in aller Regel ohne nennenswerte Belastung. Ein solcher Konfliktfall, bei dem eine früher verfasste Verfügung (Past Directive) den gegenwärtigen Interessen (Present Interest) entgegensteht, wird in der internationalen Debatte als PDPI-Fall bezeichnet: ein hilfreiches Kürzel, das auch ich im Folgenden verwende. Mit Blick auf diesen Sonderfall verlangen nicht wenige Stimmen, die Demenzverfügung aus ethischen Gründen zu missachten. Diese kritische Sichtweise hat inzwischen ihre Spuren auch im juristischen Schrifttum und in ausdrücklichen Positionierungen von Fachgesellschaften hinterlassen. Wie viele PDPI-Fälle es wirklich gibt und wie sie am Ende geregelt werden, ist unbekannt. Die STORY handelt von einem solchen Konflikt.[1]
Demenz
Demenz ist eine inzwischen so verbreitete Krankheitsgruppe, dass jeder in Umrissen weiß, worum es dabei geht. Nach medizinischem Fachverständnis ist Demenz der Oberbegriff für ein massives Schwinden geistiger Fähigkeiten, das – über unterschiedliche Entstehungswege – durch ein Absterben von Nervenzellen verursacht wird. Eine Demenz geht über altersbedingte Tüdeligkeit erheblich hinaus:
In ihrem Verlauf kommt es auch zu einer zunehmenden Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Sprache, des Auffassungs- und Denkvermögens sowie der Orientierung. Somit erschüttert eine Demenzerkrankung das ganze Sein des Menschen – seine Wahrnehmung, sein Verhalten und sein Erleben. (Bundesministerium für Gesundheit 2024, o. S.)
Die häufigsten Demenz-Formen sind die Alzheimer-Erkrankung, die etwa 70 % aller Demenzen ausmacht, und die gefäßbedingte Demenz mit anteiligen 15 %. Für beide nimmt das Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter dramatisch zu. Deswegen redet man oft auch von Altersdemenzen: Wer älter als 90 Jahre wird, hat ein Demenzrisiko von über 30 %. So steigt mit unserer zunehmenden Lebenserwartung auch die absolute Zahl der Betroffenen.
Gegenwärtig wird diese Zahl für Deutschland auf 1,8 Millionen, weltweit auf 55 Millionen geschätzt. Für das Jahr 2050 rechnet man in Deutschland mit 2,8 Millionen, global mit etwa 150 Millionen Betroffenen – falls es bis dahin noch immer keine durchschlagende Möglichkeit gibt, Demenzen zu verhindern oder zu heilen. Zumindest gegenwärtig ist dies die traurige Wahrheit: Trotz gigantischer Forschungsbemühungen versteht man noch immer nicht, wie eine Demenz entsteht und wie man sie verhindern, aufhalten oder umkehren kann.
Demenzerkrankungen werden in (mindestens) drei Verlaufsstadien unterteilt, die unterschiedlich lange andauern und mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen einhergehen. In der Anfangsphase kommt es zu Ausfällen des Kurzzeitgedächtnisses, der Wortfindung oder bei der Bewältigung komplexerer Alltagsaufgaben. Im mittleren Stadium benötigen die immer orientierungsloser werdenden Patienten dauerhafte Unterstützung. In der Spätphase werden sie auch in körperlicher Hinsicht vollständig pflege- und begleitbedürftig, schließlich permanent bettlägerig. Einwilligungsfähig sind die Betroffenen in der Regel im ersten und häufig auch noch in Teilen des zweiten Stadiums, wobei hier spezifische Unterstützung erforderlich werden kann. Im fortgeschrittenen Stadium erkennen die Patienten weder ihre Angehörigen noch können sie Anweisungen ihrer eigenen Patientenverfügung aus früheren Tagen verstehen oder nachvollziehen.
Demenzkranke sterben zwei bis 20 Jahre nach ihrer Diagnosestellung. In Deutschland wird etwa die Hälfte aller Demenzpatienten bis zuletzt von Angehörigen oder Pflegediensten zu Hause betreut. Die übrigen sterben zu etwa gleichen Teilen im Krankenhaus oder Pflegeheim. Ein erheblicher Teil der pflegenden Angehörigen fühlt sich stark belastet oder überfordert.
Die gesamtgesellschaftlichen Kosten durch Demenzerkrankungen – auch dieses Faktum ist einschlägig und seine Angabe sollte nicht als herzlos verstanden werden – wurden für 2019 global auf 1,3 Billionen US-Dollar, für Deutschland 2020 auf rund 83 Milliarden Euro geschätzt. Und sie steigen.
Demenz und Lebensfreude
Emotional zeigen Demenzpatienten ein großes Spektrum an Reaktionen und Symptomen. Sehr viele werden, zumal ab dem mittleren Stadium, misstrauisch, ängstlich, aggressiv oder ruhelos. Sie können unter Depressionen oder Wahnvorstellungen leiden, werden später oft zunehmend teilnahmslos. Solche emotional belasteten Verläufe scheinen zu überwiegen, wobei die Datenlage schwer zu erheben ist. Aber in jedem Fall gibt es durchaus auch Patienten, die überwiegend oder streckenweise zufrieden wirken und sich an verschiedenen Dingen freuen können, etwa an vertrauter Musik, alten Fotos oder einfachen Tätigkeiten, am Essen oder an liebevollen Berührungen.
Über das subjektive Wohlbefinden eines anderen Menschen lässt sich generell aus der Außenperspektive nur unter Vorbehalt urteilen. Bei Demenzkranken ist das oft besonders schwierig. Die beste Annäherung erfolgt hier durch das gemeinsame einfühlende Urteil von Nahestehenden und Pflegenden.
Mit Blick auf eine eigene zukünftige Demenz wäre es also sachlich falsch, einen durchgängigen Leidensweg zu erwarten. Selbst bei fortgeschrittener Erkrankung kann es Phasen von überwiegender Zufriedenheit geben, die sich als indirekter Ausdruck eines »Lebenswillens« auslegen lassen. Hier beginnt die ethische Kontroverse.
Die Kontroverse
Umrisse
Begonnen hat diese Debatte bereits vor etwa 50 Jahren und ist unter Fachleuten auch als Dresser-Dworkin-Disput bekannt. Seit damals nämlich bestreitet die US-Juristin und Medizinethikerin Rebecca Dresser vehement die durchgängige Autorität von Demenzverfügungen, während ihr Kollege Ronald Dworkin bis zu seinem Tod 2013 ebenso leidenschaftlich die Gegenposition vertreten hat. Und mit ihnen seither jeweils viele andere. Eine zentrale Rolle in Dworkins Überlegungen spielte die halbfiktive Alzheimer-Patientin Margo. Diese Dame, so hatte ein Medizinstudent in einer prominenten medizinischen Fachzeitschrift berichtet, sei zu seiner eigenen Überraschung »trotz oder vielleicht aufgrund« ihrer weit fortgeschrittenen Demenz »unbestreitbar einer der glücklichsten Menschen«, die er je kennengelernt habe. Dworkin konstruierte daraufhin den Fall, dass die fröhliche Margo lebensbedrohlich erkranke – zum Beispiel an einer Lungenentzündung –, dass sie jedoch in gesunden Tagen mit einer Patientenverfügung jede lebenserhaltende Behandlung eindeutig untersagt habe. Damals habe sie im Fall einer zukünftigen schweren und irreversiblen geistigen Umnachtung ausdrücklich nicht mehr weiterleben wollen. Nun jedoch, als fröhlich-dementer Patientin, sei ihr die früher verfasste Verfügung vollständig fremd geworden. Sie verstehe weder das Was noch das Warum ihrer damaligen Anweisung. Und da sich eine Lungenentzündung meist ohne nennenswerte Belastung durch ein Antibiotikum heilen lässt, würde man Margo natürlich damit behandeln, wenn sie nicht grundsätzlich anders verfügt hätte. Also ein paradigmatischer Fall von past directive versus present interest, wie ich das oben genannt habe. Ein solcher PDPI-Fall unterscheidet sich deutlich von jenen viel üblicheren Fällen, in denen behandlungsverbietende Patientenverfügungen auf Zustände leidvoller oder bewusstloser Einschränkungen treffen – also keine »Lebensfreude« entgegensteht.
Speziell für PDPI-Fälle macht nun die eine Seite (mit Dresser) geltend, es sei ethisch nicht vertretbar,
[…] einen Menschen, der gerne lebt und unschwer zu retten wäre, aufgrund einer Verfügung sterben zu lassen, mit der er keinerlei subjektiven Zusammenhang mehr hat, von der er nicht das Geringste weiß oder auch nur begreifen könnte und die seinen heutigen Interessen so fernsteht wie die exzentrische Neigung eines beliebigen Dritten. (Merkel 2004, S. 304)
Dworkin hingegen (und mit ihm eine Vielzahl anderer) erklärt:
Wenn ich in zurechnungsfähigem Zustand entscheide, dass es in meinem Interesse wäre, im Fall hochgradiger und irreversibler Demenz nicht weiterzuleben, würde es einen unzumutbaren moralischen Paternalismus bedeuten, wenn eine Person, die mir gegenüber eine Fürsorgepflicht hat, sich meinem Willen widersetzen würde. (Dworkin 1994, S. 322)
Es geht also um die Autorität einer Demenzverfügung in PDPI-Fällen. Und für beide Seiten – pro Autorität und contra Autorität – geht es dabei zugleich um zentrale Fragen von Würde, Selbstbestimmung und Menschlichkeit. Nur eben jeweils anders verstanden. Die eine Seite möchte unbedingt das Leben der fröhlich-dementen Patientin (Margo2) vor der Verfügung der gesunden Margo1 in Schutz nehmen. Die Gegenseite pocht darauf, dass die vorausgreifende Selbstbestimmungshoheit der noch gesunden Margo (Margo1) sich grundsätzlich auf alle Zustände verlorener Urteilsfähigkeit erstreckt und dass sie manchen Menschen gerade mit Blick auf eine fortgeschrittene Demenz wichtig ist. Wer hat da recht?
Motivationen für eine Demenzverfügung
Gehen wir, um zu einem Urteil zu kommen, zunächst dieser subjektiven Wichtigkeit nach. Wer im Voraus verfügt, ihn bei einer fortschreitenden Demenz nicht am Leben zu erhalten, kann dafür vier Gründe haben: 1) die Angst vor einem künftigen Martyrium, 2) das Vermeiden einer aus jetziger Sicht unwürdigen Lebensphase mit voranschreitender geistiger Eintrübung und extremer Hilfsbedürftigkeit, 3) die Schonung der eigenen Angehörigen, 4) die Schonung gesellschaftlicher Ressourcen.
Beweggrund 1) kann mit Blick auf PDPI-Fälle nicht recht punkten. Ihr Charakteristikum besteht ja gerade darin, dass die Betroffenen aus unvoreingenommener Außenperspektive lebensfroh oder gar »glücklich« erscheinen – wie eben die Dame Margo in Dworkins Fallbeispiel. Grund 4) überzeugt vor allem als Zusatzargument zu Gründen 2) und 3), welche gewiss die meisten Verfasser einer Demenzverfügung motivieren. Hier mit den Worten des verstorbenen kanadischen Historikers Norman Cantor:
Wenn ich wünsche, dass mein Leben bei verlorener Urteilsfähigkeit möglichst rasch zu einem Ende kommt, dann nicht etwa aus Angst vor Leid oder Belastungen. Sondern auf dem Boden meiner persönlichen Sicht, dass ein kognitiver Verfall für mich mit unerträglicher Entwürdigung und Degradierung verbunden wäre. Denn es ist für mich von entscheidender Bedeutung, die Erinnerungen, die meine Liebsten nach meinem Tod an mich haben werden, zu formen und das Lebensbild des vitalen und kritisch denkenden Individuums zu erhalten, das zu kultivieren ich mich immer bemüht habe. Zudem ist mir wichtig, für meine Familie und meine Freunde keine emotionale, physische oder finanzielle Last zu werden, selbst wenn sie diese Lasten willig tragen würden. (Cantor 2018, S. 16, Übersetzung BSS)
Was sagt die Gegenseite dazu? Sie kann die skizzierte Sicht als intellekt- und kontrollfixiert abtun, und dies nicht ganz zu Unrecht. Sie kann konstatieren, dass in einer humanen Gesellschaft die Menschen gegenseitig akzeptieren sollten, dass Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit zum Leben dazugehören – auch dies mit einem gewissen Recht. Aber kann sie diese Überlegungen dazu nutzen, den Anspruch auf Selbstbestimmung auszuhebeln, wie wir ihn einander doch auch in anderen Zusammenhängen einräumen? Auch abwegige oder widersprüchliche Wertvorstellungen in eigener Sache verdienen am Ende so lange Respekt, wie sie nicht die Belange anderer Menschen verletzen.
Ist Margo noch dieselbe?
Just an dieser Stelle kommt ein möglicher anderer Einwand ins Spiel: Margo2, so das Jemand-Anderer-Argument, sei nicht mehr dasselbe Individuum wie die Verfasserin der früheren Verfügung. Deren Autorität sei damit zuständigkeitshalber erloschen. Das klingt bedeutungsschwer und so, als ginge es hier letztlich um eine eindeutige philosophische Fachdiagnose. Doch das ist weit gefehlt. Wohl ist unstrittig, dass die Persönlichkeit von Margo2 sich gegenüber derjenigen von Margo1 immens verändert hat. Das genau ist hier ja der springende Punkt. Aber ob – und wenn ja, in welchem Sinn und mit welchen Konsequenzen – Margo2 jemand anderer ist als Margo1, wird auch von Philosophen uneinheitlich beantwortet. Zudem ist hier die Begriffs- und Argumentationslage ausgesprochen verwirrend.
So meinen manche Ethiker, Margo2 sei durch den Abbau ihrer geistigen Fähigkeiten einschließlich ihres Erinnerungsvermögens nicht mehr die Person Margo1 und dürfe daher nicht von deren Wünschen »tyrannisiert« werden (Position A). Andere meinen, dass Margo2 in ihrer schweren Demenz zwar nicht mehr als Person weiterexistiere, wohl aber als Individuum, für das Margo1 sich im Voraus legitimerweise verantwortlich fühle (Position B). Andere wiederum insistieren, dass Margo1 und Margo2 durchaus dieselbe Person seien. Daraus folgern die einen, es gebe an der Autorität der Demenzverfügung nichts zu rütteln (Position C), während andere darauf dringen, die Verfügung gleichwohl zu ignorieren (Position D). Letztere tun dies mit Verweis auf die kognitive und psychische Entfremdung, die Margo2 von Margo1 und deren Wertvorstellungen trenne.[2]
Wie erklärt sich diese Vielstimmigkeit und was lernt man aus ihr? Erklären lässt sich das Kuddelmuddel von Positionen mit der Unschärfe und Uneinheitlichkeit, mit der die Begriffe Person und Derselbe-Sein verwendet werden. Zugleich aber scheint es für die konträren ethischen Überzeugungen und Intuitionen über vorausgreifende Selbstbestimmung gar nicht primär ausschlaggebend, wie ein späteres dementes »Ich« begrifflich am überzeugendsten einzuordnen ist. Statt also weiter in das Dickicht begrifflicher Vorklärungen einzudringen, sollten wir die verschiedenen ethischen Intuitionen, die in dieser Debatte anklingen, mustern und direkter abklopfen.
Einer solchen Überzeugung nach ist das Nichtbefolgen von Margos Demenzverfügung ein Akt von übergriffiger Fremdbestimmung und damit schlicht unzulässig. Doch Fremdbestimmung ist nur dann eindeutig moralisch abzulehnen, wenn sie an die Stelle legitimer Selbstbestimmung tritt. Und gerade dies ist für den PDPI-Fall ja strittig. Ebenso wenig Klärung schafft die These, wer im PDPI-Fall die Autorität einer Demenzverfügung ablehne, bestreite damit zugleich die Autorität aller Patientenverfügungen. Auch das geht zu schnell: Wer Margos Demenzverfügung nicht befolgt sehen möchte, will damit das »Glücklichsein« der späteren Margo schützen – ein Aspekt, der bei anderen Patientenverfügungen entfällt.
Zukunftsplanung
Vielversprechender ist es, das Phänomen persönlicher Zukunftsplanung im größeren Zusammenhang anzuschauen. Zukunftsvorkehrungen, die das eigene spätere Ich betreffen, werden wohl von allen Menschen unternommen. Dabei kann es um so alltägliche Dinge wie Essensvorräte gehen oder um so komplexe Dinge wie das Planen einer Auswanderung. Mal geht es ums Übermorgen, mal um das spätere Alter. Mal um mehr oder weniger spielerische Hoffnungen (etwa: auf eine Sportler-Laufbahn), mal um Klugheitsstrategien zur finanziellen Absicherung (Beispiel: Versicherungen), mal um fundamentale Wertvorstellungen (Beispiel: Treueschwüre).
Unser Fokus muss sich nun auf solche Zukunftsvorkehrungen richten, die das spätere Ich einengen – zumindest von außen betrachtet. Auch hierfür gibt es viele Beispiele, die üblich sind und allgemein gewürdigt werden: Jedes Versprechen, das man einem anderen gibt, engt zugleich den eigenen späteren Entscheidungsspielraum ein. Denn wer ein Versprechen später bricht, macht sich damit im Regelfall moralisch angreifbar. Auf rechtlicher Ebene gilt dasselbe für einmal geschlossene Verträge: Auch sie muss man unabhängig davon einhalten, ob sie dem späteren Ich noch gefallen. Selbstbindung als Teil von Zukunftsplanung ist also gang und gäbe.
Was aber, wenn die einengende Selbstbindung später widerrufen wird, weil ihre einstige Motivation entfällt? Angenommen, jemand hat ein Zölibatsgelübde abgelegt oder lässt die Hälfte seiner monatlichen Einkünfte an Greenpeace überweisen oder hat einem Freund finanzielle Unterstützung versprochen. Und weiter angenommen, die dahinterstehenden Faktenkenntnisse oder Wertvorstellungen ändern sich: Der Priester fällt vom Glauben ab, Greenpeace wird aus Sicht des Förderers unseriös, der Freund entpuppt sich als mieser Charakter. Niemand würde es aus ethischer Sicht kritisieren, wenn die Selbstbindung daraufhin aufgelöst würde – auch dann nicht, wenn die Gründe weniger nobel wären, als hier angenommen. Denn, so die ethische Begründung dafür, dass man sich jederzeit anstandslos aus Selbstbindungen lösen darf: Jeder Mensch muss frei sein, seine Überzeugungen, Werturteile und Wünsche im Laufe des Lebens zu ändern. Die Fachleute sprechen da vom Recht auf Präferenzänderung.
Und genau dieses Recht führen manche Kritiker auch gegen die Autorität von Margos Demenzverfügung ins Feld: Sie habe ihre Wertvorstellungen in eigener Sache geändert; an die Stelle ihrer früheren Maßstäbe – Verlust ihrer Würde, Schonung ihrer Angehörigen – sei eine Art kindlicher Zufriedenheit mit ihrem durch die Demenz eingeschränkten Horizont getreten. Also sei ihr medizinisches Betreuungsteam, moralisch gesehen, ebenso wenig an ihre Verfügung gebunden, wie die Kirche den Zölibat des abtrünnigen Priesters einklagen dürfe. Aber wird bei diesem Argument nicht ein zentraler Punkt übersehen? Macht es nicht einen entscheidenden Unterschied, ob Überzeugungen, etwa ein Bekenntnis zum Zölibat, revidiert werden oder ob sie erlöschen, ohne ersetzt zu werden? Margo, so müsste man doch wohl sagen, hat ihre Vorstellungen von Würde am Lebensende nicht geändert, sondern schlicht verloren. Aber kommt es darauf an?
Kritische Interessen
Hier wird eine Unterscheidung hilfreich, die Ronald Dworkin in seinen wegweisenden Ausführungen zum Demenzverfügungs-Problem eingeführt hat: die zwischen kritischen Interessen und Erlebnisinteressen (wobei wir uns auf die positiven Interessen beschränken können). In die zweite Rubrik fallen dann alle Interessen, die sich auf Gefühls- und Sinnesfreuden richten. In die erste Rubrik hingegen gehören unsere wertebezogenen Vorstellungen davon, wie wir leben wollen, wer wir sein wollen, wie wir in Erinnerung behalten werden möchten. Die fröhliche Margo2, so könnte man dann sagen, führt offensichtlich ein Leben mit positiven Erlebnisinteressen, auch wenn dies gänzlich andere sind, als Margo1 sie geschätzt hat. Die kritischen Interessen von Margo1 hingegen, in deren Dienst sie damals ihre Demenzverfügung formuliert hat, sind in ihrem Denken und Bewerten ausgelöscht. Damals aber waren sie ausdrücklich auf diese geistig eingeschränkte Zukunft gemünzt.
Wenn nun etwa ein kritisches Interesse am Zölibat durch ein anderes kritisches Interesse, nämlich an einer Eheschließung, ersetzt wird, findet eine Präferenzänderung auf gleicher Ebene statt, die fraglos Respekt verdient. Ebenso, wenn jemandes Erlebnisinteressen, beispielsweise an klassischer Musik, anderen Interessen auf derselben Ebene weichen – und sei es die Freude von Margo2 am Tiere-Streicheln. Doch wenn die Vorstellungen, die Margo1 von einem würdigen Lebensende hatte, schlicht ausradiert statt ersetzt sind, liegen andere Umstände vor.
Dann geht es nämlich darum, ob, wann und wieso jemandes kritischen Interessen eine Vorrangstellung gegenüber Erlebnisinteressen eingeräumt werden soll. Dazu müssen wir etwas ausholen. Kritische Interessen spielen im Leben von Menschen unterschiedlich starke Rollen und können ein breites Spektrum von Lebensaspekten betreffen. Wir können sie vergessen, über den Haufen werfen oder schlicht verletzen – zum Beispiel dann, wenn unsere Erlebnisinteressen uns dazu veranlassen. Das alles überlassen wir, in den Grenzen des sozial Zuträglichen, der persönlichen Entscheidung des Einzelnen. Es geht also nicht darum, kritischen Interessen objektiven Vorrang gegenüber Erlebnisinteressen einzuräumen. Vielmehr überlassen wir auch diese Frage jedem Einzelnen selbst, wobei den kritischen Interessen häufig (aber keineswegs notwendigerweise) ein subjektiver Vorrang inhaltlich eingeschrieben ist, indem sie sich auf Erlebnisinteressen beziehen.
Nehmen wir an, jemand ist ein überzeugter Tierwohl-Verfechter, der es aus ethischen Gründen ablehnt, Fleisch zu essen (kritisches Interesse), es geschmacklich aber durchaus liebt (Erlebnisinteresse). Stimmig und willensstark wäre hier eine Selbstverpflichtung auf vegetarische Ernährung. Durchaus menschlich wäre aber auch, wenn unser Tierwohl-Verfechter gelegentlich und vielleicht mit schlechtem Gewissen ein Schnitzel äße. Wie jemand mit derartigen Ambivalenzen umgeht, überlassen wir also der persönlichen Entscheidung.
Was nun den Umgang mit der dementen Margo2 betrifft, so würde jeder zustimmen, dass die Erfüllung ihrer neuen Erlebnisinteressen, soweit sie auszumachen sind, als Maßstab für ihr Wohlbefinden dienen müssen. Wenn Margo2 jetzt gerne knetet, Tiere streichelt oder Vanillepudding isst, wäre es absurd und falsch, ihr irgend etwas davon mit dem Argument zu untersagen, sie habe doch früher ganz andere Vorlieben gehabt. Hier kommt unstrittig das Recht auf Präferenzänderung zum Zuge. Was aber, wenn an dieser Stelle auch noch alte kritische Interessen inhaltlich relevant, aber nicht mehr geistig präsent sind? Was also, wenn Margo1 aus ethischer Überzeugung strikte Vegetarierin gewesen wäre, Margo2 davon aber nichts mehr weiß und sich bei jeder Gelegenheit Frühstücksspeck oder Frikadellen vom Teller ihrer Tischnachbarn zu angeln versucht? Soll man ihr nun direkt Fleisch anbieten? Noch ähnlicher wird das Beispiel unserem medizinischen Margo-Konflikt, wenn wir annehmen, Margo1 hätte eine »Vegetarier-Verfügung« verfasst:
Sollte ich durch meine fortgeschrittene Demenz eines Tages vergessen haben, dass ich aus ethischer Überzeugung strikt gegen den Verzehr von Fleisch bin, möge man bitte trotzdem Sorge dafür tragen, dass meine Ernährung fleischlos bleibt. Aus Respekt vor dem, was mir als Person wichtig ist. Bitte!
Wenn Margo1 dies schreibt, hat sie vor ihrem inneren Auge wohl Bilder einer gierigen und beglückten Fleischesserin, die sie keinesfalls werden und als die sie nicht erinnert werden möchte. Hofft man nicht für sie auf eine Pflegeumgebung, die diese Bitte respektiert und in liebevoller Weise umsetzt?
Zweierlei könnte man nun gegen den Vergleich einer Vegetarismus- mit einer Nichtbehandlungs-Verfügung einwenden: Zum einen, dass sich die gesunde Margo1 das Erlebnis-Glück einfach nicht vorstellen kann, das sie mit fortgeschrittener Demenz beim Kneten, Tiere-Streicheln oder Puddingessen vielleicht genießen wird. Zum anderen, dass es bei der ersten Verfügung um eine bloße Diät, bei der zweiten immerhin um Leben oder Tod geht. Doch beide, der Non-Antizipations-Einwand und der Es-geht-ums-Ganze-Einwand, sind allenfalls auf den ersten Blick überzeugend. Der Verfasser einer Demenz-Verfügung könnte sich nämlich absolut im Klaren darüber sein, dass ihm sein späteres Innenleben unvorstellbar ist, und er kann diese Tatsache zugleich gänzlich bedeutungslos finden. Macht nicht das eingangs angeführte Zitat des Historikers Norman Cantor exemplarisch deutlich, dass für ihn persönlich der fortschreitende Verlust mentaler Fähigkeiten durch kein noch so intensives, unbekanntes Erlebnis-Glück aufgewogen werden könnte? Auch betrifft der Non-Antizipations-Einwand genau besehen nicht nur eine zukünftige Demenz, sondern auch sehr viele andere Vorkehrungen und Weichenstellungen für die eigene Zukunft. Man weiß nicht im Voraus, wie es sich anfühlen wird, langfristig verheiratet zu sein, Kinder zu haben oder auszuwandern – und schultert doch gegebenenfalls die damit einhergehenden Ungewissheitsrisiken. Demenz ist hier gewiss ein Extrem-, aber eben doch kein totaler Ausnahmefall.
Ähnliches muss man auch dem Einwand entgegenhalten, im PDPI-Konflikt gehe es nicht um vergleichsweise triviale Weichenstellungen für Berufe, Wohnorte oder Lebensformen, sondern um den eigenen Tod. Das lässt sich gewiss nicht leugnen, aber was folgt daraus? Längst gesteht die Medizinethik Patienten zu, auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten, weil sie ihr Restleben in Krankheit, Siechtum oder gebrechlichem hohen Alter nicht weiterführen möchten. Dasselbe gilt nach Ansicht vieler auch für einen freiverantwortlichen Suizid.[3] Auch hier können die Betroffenen zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung nicht genau wissen, was ein Weiterleben später für sie bedeuten würde. Demenzverfügungen sind hier zwar erneut ein Extremfall, weil sie reale und zeitlich entfernte spätere Ichs betreffen, während akut umgesetzte Sterbeentscheidungen die Existenz eines noch späteren Ichs von vornherein verhindern. Aber dass daran wirklich ein moralisch gravierender Unterschied hängen sollte, scheint wenig plausibel. Danach nämlich wäre es von Margo1 moralisch in Ordnung, bereits zu leicht dementen und nicht unglücklichen Zeiten akut den Tod zu suchen – nicht aber das Sterben ihres späteren, anders glücklichen Ichs zu verfügen. Das scheint absurd.
Wohin führen uns solche Szenarien-Vergleiche und Stimmigkeits-Überlegungen? Ich denke, wir müssen noch einmal zurückkommen auf die Vorrangfrage von kritischen Interessen und Erlebnisinteressen und auf die Bedeutung, die kritische Interessen und Selbstbestimmung für unser Selbst- und Fremdverständnis haben.
In unserem Kulturkreis ist unstrittig, dass zum Kern des Rechts und Interesses an Selbstbestimmung die eigene Lebensgestaltung gehört. Lebensgestaltung wiederum drückt sich wesentlich darin aus, dass wir sowohl Erlebnisinteressen als auch wertebezogene kritische Interessen ausbilden oder nicht ausbilden, beibehalten oder ändern, befolgen oder nicht befolgen. Der Maßstab für ein gelingendes Leben liegt dabei am Ende bei jedem Einzelnen.
Da kritische Interessen darauf abzielen, was einem wichtig (und nicht nur erfreulich) ist, haben sie nicht selten Einfluss darauf, wie die eigenen Erlebnisinteressen bewertet werden. Daraus kann sich ein Sekundärinteresse an Selbstbindungen ergeben. Unsere ethische Vegetarierin ist hier ein gutes Beispiel: Ihr kritisches Interesse übertrumpft eigentlich ihr vorhandenes Erlebnisinteresse am Fleischessen. Wie konsequent sie das durch Willensstärke und durch geeignete Vorkehrungen (kein Besuch einer Fleischtheke, nur vegetarische Restaurants etc.) anerkennt und stärkt, liegt bei ihr selbst. Solche Vorkehrungen und nicht zuletzt Zukunftsanweisungen an andere (die Vegetarier-Verfügung) sind also Ausdruck der Wichtigkeit und des Vorrangs, die jemand seinen eigenen kritischen Interessen beimisst.
Lebensgestaltung bezieht sich manchmal auf bestimmte Lebensphasen, nicht selten aber auf unser Leben als Ganzes, auf dessen »Gesamtcharakter«, wie schon Dworkin es genannt hat. Das mag etwas pathetisch klingen, trifft aber gerade bei Entscheidungen über das eigene Lebensende und insbesondere für Demenzverfügungen sehr genau zu: Wie man von seinen Angehörigen oder Freunden erlebt und erinnert werden möchte, was man ihnen da zumuten will, zählt doch ohne Frage zu den Kernfragen von Lebensgestaltung. Dabei können die Antworten aber natürlich ganz verschieden ausfallen: Manche Menschen möchten den Zustand weitgehender Umnachtung und Hilfsbedürftigkeit, wenn er denn in Aussicht steht, gar nicht erst erleben, andere möchten ihn durch Therapieverzicht begrenzen, wieder andere möchten auch diese Erfahrungen auf sich zukommen lassen, solange sie dabei nicht leiden. All das verdient doch wohl gleichen Respekt.
Den Konflikt adressieren
Allerdings kann gerade ein PDPI-Konfliktfall für Angehörige oder Behandlungsteams eine enorme psychische und moralische Zumutung werden.[4] Auch deshalb wird seit Jahren von verschiedenen Seiten angeraten oder sogar strikt verlangt, dass die Demenzverfügung den beschriebenen Konflikt ausdrücklich anspricht und eindeutig regelt.
Eine solche Klausel könnte lauten:
Wenn im Stadium fortgeschrittener Demenz aus Sicht meiner Behandler/meiner Angehörigen Anzeichen dafür bestehen, dass ich Lebensfreude empfinde,
–
dann sollen medizinisch gebotene Maßnahmen ergriffen werden, soweit sie belastungsarm sind; [oder]
–
dann sollen meine Ärzte / Angehörigen gemeinsam entscheiden, wie ich behandelt werde; [oder]
–
dann soll diese Verfügung dennoch strikt befolgt werden.
Die Verwendung einer solchen Klausel hätte gleich drei begrüßenswerte Funktionen: Sie würde garantieren, dass ihr Autor sich über die Möglichkeit eines PDPI-Konflikts und die oben besprochenen Ungewissheiten und Risiken im Klaren ist. Angehörige und Behandler würden entlastet. Und schließlich ›privatisiert‹ sie die ethische Antwort auf den PDPI-Konflikt. Eine solche Privatisierung – jeder Betroffene entscheidet für sich selbst – ist bei manchen ethischen Dissensen, die sich nicht ausräumen lassen, die beste Lösungsstrategie.
Wer es allerdings für ethisch schlechterdings unzulässig hält, die Autorität einer Demenzverfügung im PDPI-Konflikt anzuerkennen, wird sich auch von einer solchen Klausel kaum umstimmen lassen. Bisherige Daten zeigen, dass es solche Hardliner durchaus gibt. Wie sehr sie die Praxis wirklich bestimmen, weiß man nicht. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft etwa spricht sich deutlich gegen die Anerkennung einer Demenzverfügung im PDPI-Konflikt aus, allerdings ohne die Möglichkeit einer regelnden Klausel anzusprechen:
[…] Deshalb ist es notwendig, den aktuellen Willen festzustellen und mit den in der Patientenverfügung formulierten Wünschen zu vergleichen. Im Zweifel sollte aus Sicht der Deutschen Alzheimer Gesellschaft der aktuelle Wille entscheidend sein. (Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2017, S. 2)
Das Bundesministerium der Justiz hingegen bietet in seinen Textbausteinen für das Verfassen einer Patientenverfügung eine PDPI-Klausel an, die keine Alternative zur Anerkennung des aktuellen Willens lässt, indem sie verlangt,
möglichst im Konsens aller Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegungen in meiner Patientenverfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen. Bei unterschiedlichen Meinungen soll in diesen Fällen der Auffassung folgender Person besondere Bedeutung zukommen: […]. (Bundesministerium der Justiz 2020, S. 5)
Diese einseitigen Positionen verdanken sich nicht zuletzt einer entsprechenden Entwicklung im juristischen Schrifttum, die allerdings von namhaften Juristen als verfassungswidrige Minderheitsmeinung bewertet wird. Vielleicht muss das Bundesverfassungsgericht demnächst über die Missachtung einer PDPI-Klausel entscheiden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es im Sinne einer Privatisierung der PDPI-Ethik urteilen wird.
Fazit
Ob jemand eine Demenzverfügung verfasst und was sie dann enthält, ist seine höchstpersönliche Sache. Offenbar wollen zunehmend viele Menschen mit einer solchen Verfügung die letzte Phase geistigen Verdämmerns durch den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen abkürzen. Soll dies auch dann gelten, wenn ihre Umgebung sie als zufrieden und lebenswillig wahrnimmt, ist dies in einer PDPI-Klausel zum Ausdruck zu bringen, die ihrerseits uneingeschränkten Respekt verlangt. Eine solche Klausel signalisiert Wohlüberlegtheit, entlastet die Umgebung und übernimmt ethische Eigenverantwortung in einem anders nicht zu lösenden Dissens.
Dieses ethische Fazit folgt weder aus begrifflichen Einsichten noch aus tieferen philosophischen Wahrheiten. Vielmehr ergibt es sich aus dem schlüssigen ethischen Nachdenken über die Bedeutung von ›roten Fäden‹, die viele von uns auf die eine oder andere Weise durch ihr Leben ziehen möchten. Zudem verdanken unsere zukünftigen »Ichs« ihr Fortexistieren sowie ihr Außen- und Innenleben immer maßgeblich den Weichenstellungen ihrer Ichs in der Vergangenheit. Diese Freiheit zum persönlichen Weichenstellen und die Freiheit zur Auswahl roter Fäden sind zentrale gesellschaftliche Verabredungen. Es gibt keinen guten Grund, dies im Fall einer fröhlichen Demenz anders zu handhaben.
1In der deutschen Debatte wird oft auf die reale Person des bekannten Tübinger Rhetorikprofessors Walter Jens Bezug genommen, der 2016 gestorben ist. Ich finde es richtiger, meine Überlegungen auf ein fiktives und somit durch eigene Annahmen vollständig festzulegendes Szenario zu beziehen statt auf einen realen Fall mit vielleicht unbekannten Details, noch lebenden Angehörigen und einem berechtigten Anspruch auf Würdeschutz nach dem Tod.
2Exemplarische Vertreter für die hier skizzierten Positionen: Position A: Dresser 1995; Position B: DeGrazia 1999; Position C: Dworkin 1994; Position D: Hawkins 2014.
3Siehe dazu Kapitel 7 in diesem Buch.
4Das gilt erst recht, wenn die Demenzverfügung auch bevormundendes Füttern verbietet. Zu diesem Sonderproblem siehe Kapitel 7 in diesem Buch.
KAPITEL 2
Organspende: Wie bloß regeln?
DIE STORY: Organe für die Alpen?
Dienstag: Gestern Abend an unserem Stammtisch: Rudi hat erzählt, er wolle im Sommer mit seiner Frau Trude Urlaub in Österreich machen. »Nach Südtirol soll’s gehen, in einen gemütlichen Berggasthof. Von da aus wollen wir zünftig wandern, jeden Tag eine andere Tour, aber immer mit einer Hütte als Ziel – für a gscheite Jaus’n!« Jetzt aber hätte eine Freundin von der Trudi erzählt, dass man in Österreich unfreiwillig Organspender wird, wenn man einen Autounfall hat.
Wir anderen haben Rudi natürlich ausgelacht. Als ob jeder Autounfall gleich solche Ausmaße annehmen würde. Aber vor allem, weil wir das Ganze nicht glaubten. »Das wäre ja noch schöner!«; »Das kann doch rechtlich gar nicht gehen!«; »So ein Quatsch!«; »Dann kommst du endlich mal in die Zeitung: ›Deutscher spendet Leber und Lunge – ganz ohne Zustimmung!‹«, haben wir durcheinander geprustet. Ich habe versprochen, bis zum nächsten Montag nachzulesen, wie sich das alles wirklich verhält: Faktencheck gegen Freibier.
Mittwoch: Und nun sitze ich hier, habe im Netz recherchiert und kann es kaum fassen. Die Freundin von Rudis Frau hat tatsächlich recht. In Österreich gilt die sogenannte Widerspruchsregelung. Heißt im Klartext: Jedem Staatsbürger, der als Spender in Frage kommt, werden nach seinem Tod die Organe entnommen, es sei denn, er hätte zu Lebzeiten widersprochen oder seine Angehörigen würden protestieren. Schlimm genug in meinen Augen. Aber bitte, wenn die Österreicher das so wollen …
Dass diese Regelung jedoch auch für Ausländer gelten soll, ist doch nicht zu glauben. Egal ob Tourist, LKW-Fahrer oder Verwandten-Besucher? Der deutsche Urlauber, der im eigenen Land keine Organe spenden möchte, soll dazu in der Alpenrepublik genötigt werden? Das scheint aber, laut ADAC, genau so zu sein. Der empfiehlt Österreich-Reisenden daher:
[…] eine ausdrückliche schriftliche Erklärung zu Ihrem Willen dabeizuhaben. Nur so können Sie sicher sein, dass im Fall der Fälle keine Organe entnommen werden können, falls Sie das für sich nicht möchten.
Als ich das las, hätte ich beinahe meinen Kaffee verschüttet. Das kann doch nicht wahr sein! Aber so steht es da, schwarz auf weiß.
Donnerstag: Die Sache mit der Organspende hat mich nicht mehr losgelassen: habe gestern den ganzen Nachmittag herumgegoogelt. Und kann nur sagen, ich stimme einmal in meinem Leben der FDP zu. Hier ein Statement ihrer Bundestags-Abgeordneten Kristine Lütke:
Eine Widerspruchslösung bedeutet zunächst einmal, dass sich der Staat die Antwort auf die Frage nach der Organspende selbst herausnimmt und für alle beantwortet. […] Das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper über den Tod hinaus ist doch ein Grundpfeiler unserer Verfassungsordnung und auch von zentraler Bedeutung. Eine staatliche, verpflichtende Organbeschaffung wird den Menschen und ihrem individuellen Selbstbestimmungsrecht deshalb nicht gerecht. (Lütke 2024, S. 26527)
Ich werde das zum Anlass nehmen, einen Organspendeausweis mit Widerspruch auszufüllen. Ich will doch nicht im Ausland verwertet werden. Und wenn ich schon einmal dabei bin, trage ich mich dann auch gleich ins deutsche Organspende-Register ein, alles ablehnend natürlich. Wenn schon, denn schon. Wusste gar nicht, dass es das Register überhaupt gibt. Nach anfänglichen Problemen scheint das Eintragen inzwischen einigermaßen machbar: per App und Gesundheits-ID. Nächste Woche dran denken!
Freitag: Richtiger Streit mit Susa.
Sie: Du bist echt egoistisch. Andere Menschen sterben, weil es zu wenig Organspender gibt, und du regst dich darüber auf, dass man sich erklären muss? Ein richtiger Kindskopf, dann auch noch das Spenden ganz abzulehnen. Und was, wenn du selbst eigentlich ein neues Organ bräuchtest – würdest du dann darauf verzichten, dir eines einpflanzen zu lassen?
Ich: Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Es geht ums Prinzip! Der Staat hat keinen Zugriff auf meinen Körper. Punkt.
Montag: »Und, hast du’s gegoogelt?«, werde ich am Stammtisch sofort empfangen. »Jawohl, her mit meinem Freibier! Ihr werdet es nicht glauben: In Österreich sollte man nicht nur seine Wanderschuhe dabeihaben, sondern tatsächlich auch einen Organspendeausweis! Dreimal dürft ihr raten, was in meinem Ausweis stehen wird! Allerdings könnte das ein Scheidungsgrund für Susa und mich werden …«
Hintergründe und Fakten
Transplantationsmedizin: Stand der Technik
Organverpflanzungen von Toten auf Lebende sind seit den 1960er Jahren immer mehr zu einer Standardtherapie bei drohendem endgültigem Organversagen geworden. Das galt zunächst nur für Nieren. Inzwischen können auch Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Darm und Herz erfolgreich transplantiert werden. Die verpflanzten Organe funktionieren, je nach Ausgangssituation, über einen langen Zeitraum und werden von ihren Empfängern fast immer als »Geschenk des Lebens« empfunden. Für Nieren wird eine Funktionsdauer von über zehn Jahren angegeben, während transplantierte Herzen nach fünf Jahren noch zu 65 % funktionieren. Neben der postmortalen, also nach dem Tod erfolgenden Spende besteht für Nieren und Leber(teile) auch die Alternative einer Lebendspende, um die es hier jedoch nicht weiter gehen soll.[1]