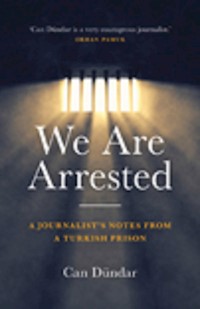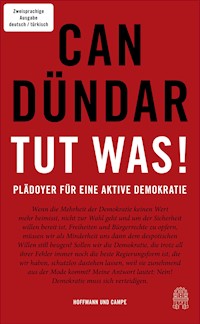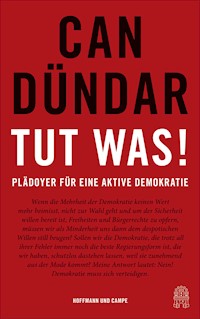17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im November 2015 werden Can Dündar, Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung »Cumhuriyet«, und Erdem Gül, Hauptstadtkorrespondent, verhaftet. Die türkische Staatsanwaltschaft wirft ihnen Spionage und Verrat von Staatsgeheimnissen vor, Staatspräsident Erdogan stellt persönlich Strafanzeige und fordert lebenslange Haft. Hintergrund ist ihre Berichterstattung über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Extremisten. Nach drei Monaten kommen die Journalisten vorläufig frei. Anfang Mai beginnt der Prozess: Dündar wird zu sechs, Gül zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In »Lebenslang für die Wahrheit« erzählt Dündar die ganze Geschichte von der Entdeckung der geheimen Waffenlieferungen über die Entscheidung, das belastende Filmmaterial zu veröffentlichen, bis zu den Ereignissen, die der Veröffentlichung folgten: Die Drohungen, die er und die Redaktion erhalten haben, die Angst vor Terroranschlägen, seine Zeit in Einzelhaft. Dündars Aufzeichnungen aus dem Gefängnis zeigen, dass sein Widerstand ungebrochen ist und er nicht aufgeben wird im Kampf für Presse- und Meinungsfreiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Can Dündar
Lebenslang für die Wahrheit
Aufzeichnungen aus dem Gefängnis
Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe
Hoffmann und Campe
Vorwort für die deutsche Ausgabe
Als ich am Morgen des 6. Mai 2016 aus dem Haus ging, fiel mir etwas Merkwürdiges auf:
In dem Wagen, der mich abholen kam, fehlte der Personenschützer, der mich seit einer Weile ständig begleitete.
Als die Drohungen zunahmen, hatte der Staat ihn mit meinem Schutz betraut, an jenem Morgen aber hatte er verschlafen.
Dabei handelte es sich um einen wichtigen Tag.
In dem Verfahren, in dem zweimal lebenslange Freiheitsstrafe für mich gefordert wurde, sollte das Urteil verkündet werden.
Ich sagte ihm, er solle direkt zum Gericht kommen.
Das tat er.
Wir gingen in die Verhandlung. Im Saal war es leer, denn die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Wir gaben unsere letzten Erklärungen ab, wiesen abermals darauf hin, dass eine Verurteilung für einen Bericht, dessen Wahrheitsgehalt belegt und der von öffentlichem Interesse war, einen Schlag für die Pressefreiheit darstellen und die Justiz mit Füßen treten würde.
Dann unterbrach der Richter die Verhandlung für die Urteilsfindung.
Wir verließen den Saal.
In einem Café in der Nähe wollten wir warten. Als wir auf dem Weg dorthin aus der Tür des Gerichtsgebäudes traten, stellte ich fest, dass – seltsamerweise – mein Personenschützer wieder nicht an meiner Seite war.
Meine Frau begleitete mich und ein Abgeordneter der CHP.
Ich wechselte einige Worte mit Kollegen, die am Ausgang gewartet hatten, da bemerkte ich plötzlich einen Mann mit hasserfüllter Miene auf mich zu kommen.
Zuerst sah ich das Funkeln des Pistolenlaufs in seiner Hand, dann roch ich den Pulverdampf.
Im selben Augenblick hörte ich den Mann brüllen: »Vaterlandsverräter!«
Das war das Etikett, das Staatspräsident Erdoğan mir anzuhängen versuchte, die Kugel war offensichtlich der »Preis«, den er mich »teuer bezahlen« lassen wollte.
Wir standen auf dem wohl bestgeschützten Platz der Türkei. Dort ließ man angeblich »keinen Vogel« hinein oder hinaus, geschweige denn einen Bewaffneten.
Der Fernsehmoderator an meiner Seite bot mir Deckung, meine Frau griff reflexartig nach dem Arm des Attentäters, mein Freund, der Abgeordnete, überwältigte ihn.
Kurz darauf kamen Zivilpolizisten herbeigelaufen. Der Attentäter wurde abgeführt. Der Kollege, der mir Deckung gegeben hatte, hatte einen Streifschuss am Bein abbekommen.
Dank des Heldenmuts meiner Begleiter kam ich mit dem Schrecken davon.
Nun war klar, dass nicht nur meine Zeitung, meine Journalistentätigkeit und meine Freiheit bedroht waren, sondern auch mein Leben.
Auf die Nachricht von dem Anschlag hin eilten Freunde herbei. Bald lösten wir uns von ihnen und betraten zur Urteilsverkündung erneut den Gerichtssaal.
Der Richter drückte Mitgefühl aus, anschließend verkündete er sein Urteil:
»Fünf Jahre und zehn Monate Haft wegen Verrats eines Staatsgeheimnisses …«
Als ich das Gericht verließ, gab ich ein Statement ab: »Innerhalb nur einer Stunde wurden ein tätlicher und ein juristischer Anschlag auf mich verübt, doch ich werde unter keinen Umständen schweigen.«
Als Erstes sagte der Attentäter aus, er hätte vorgehabt, mir wegen der Berichterstattung einen Denkzettel zu verpassen.
Am Tag der Urteilsverkündung erhielt ich vom Gericht auch meinen Pass zurück.
Sollte das ein Wink sein: »Halt dich von diesem Land fern«?
Als dieses Buch erschien, wartete ich noch immer auf die Revision des Urteils.
Mit der Gefängnisstrafe am Hals und Pulverdampf in der Nase …
2016 ist eines der traumatischsten Jahre nicht nur für mich, sondern auch für die Türkei.
Genau zehn Wochen nach mir erlitt auch die türkische Demokratie einen schweren bewaffneten Anschlag.
Am 15. Juli unternahm die Gülen-Bewegung, die jahrelang Weggefährte der Machthaber gewesen war, einen ernstlichen Umsturzversuch gegen die Regierung. Die Rebellion begann in der Armee. Das Parlament wurde bombardiert, Militär und Polizei lieferten sich Gefechte, an einigen Stellen kämpften sogar Soldaten gegen Soldaten. Obwohl viel Blut vergossen wurde, scheiterte die bewaffnete Intervention glücklicherweise.
Die türkische Bevölkerung, die im Laufe der Geschichte arg unter Staatsstreichen zu leiden hatte, ging dieses Mal auf die Straße, stellte sich den Panzern entgegen und bewahrte die Türkei vor einem ungeheuren Desaster.
Statt nun aber nach dem dumpfen Umsturzversuch die im Land entstandene Anti-Putsch-Solidarität als Chance für die Demokratie einzusetzen, nutzte die türkische Regierung die Gelegenheit bedauerlicherweise, um die Repression zu verschärfen. Landesweit wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde ausgesetzt. Die Regierung wurde ermächtigt, mit Dekreten zu regieren, womit das Parlament de facto ausgeschaltet war. Die Frist für Polizeigewahrsam wurde verlängert, eine Kampagne zur Wiedereinführung der Todesstrafe eingeleitet und im ganzen Land zur Hexenjagd geblasen. Tausende Journalisten, Autoren, Akademiker, Richter, Staatsanwälte, Soldaten, Polizisten, Beamte wurden verhaftet, Dutzende Zeitungen und Internetseiten geschlossen, weitere eingeschüchtert. Als der Westen gegen diese Maßnahmen protestierte, wurden die Verbindungen bis zum Zerreißen angespannt.
Der Militärputsch war vereitelt, doch der darauf folgende zivile Coup hebelte Freiheiten aus.
Kommen wir zu den persönlichen Auswirkungen des Putsches.
Zu den Ersten, die in den höchsten Justizorganen vom Dienst suspendiert wurden, gehörten die Richter am Verfassungsgericht, die unsere Freilassung veranlasst hatten.
Es folgte die Umstrukturierung des Revisionsgerichts, das über unseren Widerspruch gegen die Verurteilung zu Haftstrafen entscheiden würde.
Der Staatsanwalt, der den Haftbefehl gegen uns erwirkt und die Anklageschrift für das Verfahren verfasst hatte, wurde zum Oberstaatsanwalt von Istanbul befördert.
Ein neuer Prozess wurde eröffnet, der Vorwurf lautete, ich hätte mit der Nachricht, aufgrund derer ich verhaftet worden war, die als Drahtzieher hinter dem Putsch ausgemachte Gülen-Bewegung unterstützt.
Das Gericht, das diesen Prozess einleitete, erklärte noch vor Verhandlungsbeginn meinen Reisepass für ungültig.
Das Jahr 2016 begann für mich in einer Gefängniszelle, es setzte sich fort mit Pulverdampf, Verurteilungen, neuen Prozessen und der Wahrscheinlichkeit neuerlicher Verhaftung.
Gleich mir bemüht sich auch die schwache Demokratie in der Türkei darum, einen Ausweg aus Pulverdampf, Putschversuchen, Hexenjagd, Verhaftungswellen und repressiver Politik zu finden, Atem zu schöpfen und Hoffnung auf ein Morgen zu fassen.
Jeder Satz, den man über ein Land schreibt, in dem die Lage sich von einem Tag auf den anderen radikal verändert, ist dazu verurteilt, im nächsten Augenblick bereits nicht mehr aktuell zu sein. Dennoch wollen wir, wenn wir die Ära dokumentieren, in der dieses Buch entstand, hoffen, morgen diese Zeilen unter besseren Umständen lesen und sagen zu können: »Es war eine finstere Zeit, sie ist vorbei.«
Wenn ich der europäischen Leserschaft dieses Buch jetzt vorlege, möchte ich nicht nur als Journalist, der sich für die Pressefreiheit einsetzt, sondern auch als Bürger einer Nation, die sich alle Mühe gibt, die Demokratie auf einem riskanten Pendel zwischen Kaserne und Moschee am Leben zu erhalten, appellieren:
Unterstützten Sie den Existenzkampf der demokratischen Kräfte in der Türkei!
Diese Unterstützung ist von enormer Bedeutung für die Türkei, aber ebenso für Europa.
So isoliert, antiwestlich und totalitär die Türkei als Land ohne Europa wäre, so einfarbig, selbstbezogen und ineffizient wäre Europa als Kontinent ohne die Türkei.
Überzeugen Sie die Türkei davon, dass Europa kein Christen- Club ist, sondern eine moderne Wertegemeinschaft; Europa seinerseits sollte die sich zunehmend breitmachende Islamophobie überwinden, indem es das säkularste Land der islamischen Welt mit offenen Armen aufnimmt.
Nur so können wir dem religiös motivierten schmutzigen Krieg, der drauf und dran ist, die Welt in eine Katastrophe zu führen, sowie der Seuche des Nationalismus und den repressiven Regimen, die dieser Krieg mit sich bringt, Einhalt gebieten.
Can Dündar
August 2016
Einleitung
Eines Tages öffnete sich die Klappe in der Zellentür. Der Wärter brüllte:
»Can Dündar, privater Besuch für dich.«
»Privater Besuch?«
Dieser Ausdruck war mir völlig neu.
In den drei Monaten in Silivri empfingen wir dreihundertfünfzig Besucher. Es handelte sich um Anwälte, denen eine permanente Zutrittserlaubnis erteilt wurde, und um Abgeordnete, die uns mit Genehmigung des Justizministeriums besuchen durften. Die Angehörigen kamen an den Besuchertagen.
Im Gegensatz zu Journalisten, die vor Erdem Gül und mir eingesperrt worden waren, erteilte das Ministerium in unserem Fall keinem einzigen privaten Besucher eine Genehmigung. Weder ausländischen Delegationen noch Berufsorganisationen noch Kollegen.
Die einzige Ausnahme bildete der Besucher an diesem Tag.
Er hatte eine Genehmigung für einen offenen, privaten Besuch erhalten, wie auch immer er den beim Ministerium durchbekommen haben mochte.
Auf dem Weg zum großen Besucherraum rannte ich beinahe. Der Saal war leer, ich setzte mich an einen der Kunststofftische. Wie immer stierte ich das Foto »Freie Pferde« an und wartete voller Neugier auf den »privaten Besuch«.
Bald ging die Tür auf.
Das Warten wurde spannend wie vor dem Höhepunkt einer Hochzeitsfeier.
Und dann …
Ein herzliches Lächeln unter seinem Bart trat Can Öz ein, mein Verleger.
Ich traute meinen Augen nicht.
Er hatte die strenge Isolation durchbrochen und war zum offenen Besuch gekommen.
»Wie ist das möglich? Wie hast du die Erlaubnis ergattert?«, fragte ich, als ich ihn umarmte.
Ümit Altaş, Anwalt des Verlags Can Yayınları, hatte beim Justizministerium in Ankara vorgesprochen und angegeben, aufgrund unserer Autor-Verlag-Beziehung sei eine persönliche Unterredung über Copyright, Verträge und Ähnliches unabdingbar.
Offenbar stehen alle Mühlen still, wenn es um »Kommerz« geht. Die Genehmigung war unverzüglich erteilt worden.
Die Stunde verging wie im Flug.
Wir redeten über den Druck, der auf das ganze Land ausgeübt wurde, über die Neuauflage meiner Bücher, über die unmittelbar bevorstehende Geburt seiner Tochter.
Den Plan, meine Masterarbeit zum Thema »Staatsgeheimnisse« zum Prozessauftakt neu herauszubringen, hatte ich aufgegeben. Die Arbeit war mehr als zwanzig Jahre alt, und die Daten darin waren zum Teil überholt. Sie aus dem Gefängnis heraus zu überarbeiten, war unmöglich.
Allerdings schrieb ich in der Haft ohne Unterlass.
Es mögen die drei fruchtbarsten Monate meines Lebens gewesen sein.
Das Skript für den liegen gebliebenen Dokumentarfilm über Kuba wurde endlich fertig.
Nicht allein an die Cumhuriyet, an renommierte Zeitungen in aller Welt schickte ich zahlreiche Artikel.
Den Menschen, die vor dem Gefängnis die »Wache der Hoffnung« organisiert hatten, Preisverleihungen, Gedenktagen, Berufsverbänden, ausländischen Staatsleuten ließ ich Botschaften zukommen.
Jeden Brief beantwortete ich.
Überdies führte ich Tagebuch.
Und war dabei, ein neues Buch zu konzipieren.
Bücher mit Erinnerungen an Silivri füllten in der Tat mehrere Regale in meiner Bibliothek. Beim Lesen einiger von ihnen nahm ich Abstand davon, eine ähnliche Gemengelage erneut niederzuschreiben und verschob das geplante Buch.
Doch als ich mit Can auf meine Notizen zu sprechen kam, merkte ich, wie ihn meine Silivri-Memoiren fesselten. Und begriff, es würde mich im Gefängnis auf den Beinen halten, mich unverzüglich ans Werk zu machen. Außerdem war es ein Zeugnis. Die Dokumentation einer Ära der Brutalität und des Gefängnisses, das zu ihrem Symbol geworden war. Ein Gefangenentagebuch. Ein Brief von einer einsamen Insel.
Zum Abschied umarmte ich Can und kehrte in meine Zelle zurück. Ich nahm mir ein leeres Heft vor und begann zu schreiben.
Dies ist mein erstes handschriftlich verfasstes Buch.
Computer und Schreibmaschine waren mir verwehrt.
Seit dem Abitur hatte ich nicht mehr per Hand geschrieben. Als Kind war mein Traum, Arzt zu werden, das war mir zwar nicht gelungen, doch meine Handschrift ist denen von Ärzten nicht unähnlich: unentzifferbar! Also musste ich in Großbuchstaben und leserlich schreiben.
Meine Hand erlahmte rasch, die Erschöpfung schlug sich in der Schrift nieder. Deshalb musste ich häufig pausieren, den Arm ausruhen und die taub gewordene Hand ausschütteln.
Irgendwann versuchte ich, die linke Hand zu Hilfe zu nehmen, doch sie erwies sich als ungelenk und unfähig.
Als mir nach zwei Monaten hartnäckiger Antragstellung erlaubt wurde, an zwei Tagen pro Woche für je eine Stunde einen Computer zu benutzen, war das Buch bereits praktisch fertig. Es war unsinnig, nun der Gefängnisleitung, die nach meiner Arbeit am Computer die Ausdrucke unter die Lupe nahm, das Lektorat zu überlassen.
Das Konzept zu diesem Buch entstand bei langen Hofgängen, beim Ausblick auf gelbe Mauern, auf dem eisernen Bettgestell im Obergeschoss der Zelle und vor der Heizung unten.
Die Tagebuchform behagte mir nicht, ich stellte die gesammelten Erinnerungen einer ganz eigenen Chronologie folgend unter Ein-Wort-Motti.
Beim Schreiben saß ich auf einem Plastikstuhl mit einer weißen Wolldecke als Sitzkissen an einem weißen Kunststofftisch mit Wachstuchdecke.
Glauben Sie nicht, die schönsten Bücher entstünden mit Blick auf herrliches Panorama. Ganz im Gegenteil. Der Vorstellungskraft, die bei schöner Aussicht zum Einschlafen neigt, können angesichts einer Mauer, von der Lust, dahinter zu schauen, Flügel wachsen. Sie erklimmt die Mauer. Das peitscht den Stift auf, er beeilt sich, ihr zu folgen.
Zwei Monate lang setzte ich mich manchmal traurig, meist aber frohgemut und immer mit größtem Eifer an den Tisch, brauchte drei Kugelschreiber und drei linierte Hefte auf, um dieses Buch zu schreiben, und träumte von dem Tag, an dem es erscheinen würde.
Mein Tweet nach Erlass des Haftbefehls markierte den Beginn unserer Gefangenschaft und verwies zugleich auf die unter der AKP-Regierung immer schwerer und länger werdende Inhaftierung der Gesellschaft: Tutuklandık – WirSindVerhaftet.
In dieser langen Haft gehörten wir wahrscheinlich noch zu den glücklicheren Häftlingen.
Was uns widerfuhr, konnte gerade einmal als Praktikum gelten angesichts Tausender jahrelang zu Unrecht inhaftierter, beim Kampf für Gerechtigkeit ums Leben gekommener oder irgendwo in einer Kerkerecke in Vergessenheit geratener Opfer.
Da mein Stift nun einmal ein fernes Ziel hatte wie auch die Kraft, Herzen zu berühren, und treue Leser, wurde es geradezu zur Verantwortung auch den weiterhin Inhaftierten gegenüber, das Unrecht vor der Geschichte aufzuzeichnen, zu dokumentieren, zu verkünden, herauszuschreien.
Als Can Öz kam, stand der Tag unserer Verhandlung noch nicht fest, sicher war nur, dass sein Kind Ende März zur Welt kommen würde.
Dieses Buch stellte ich mir als kleines väterliches Geschenk für das Baby vor und fasste den 30. März als Erscheinungsdatum ins Auge.
Dann wurde unser erster Verhandlungstag auf den 25. März 2016 angesetzt.
Die beiden Daten überschnitten sich.
Das Buch würde womöglich noch vor mir herauskommen.
Es würde aller Welt von meiner Situation berichten.
Es kam dann aber doch anders, noch vor dem 25. März war ich frei. Die letzten Kapitel schrieb ich (mit phantastischer Aussicht) in Freiheit.
Dieses Buch ist die Frucht einer kollektiven Solidarität.
Mit Hund Tarçın (dt. Zimt) in Seferihisar.
Ich danke all den Engagierten dieser Mobilisierung, die auf Anstoß von Can Öz ihren Ausgang nahm: meiner Frau Dilek, die mir geduldig Ermutigung, Verstand und Bücher aus meiner Bibliothek zutrug; meinem Weggefährten Erdem, der die Wehen des Schreibprozesses teilte; Tahir Özyurtseven und Murat Sabuncu, die mir trotz der Erschöpfung all der Monate die Zeit gaben, das Buch zu vollenden; Akın Atalay, der das Buch als Erster las und mich ermahnte, mir nicht noch mehr Ärger aufzuhalsen; Özlem Yılmaz, die meine krakelige Schrift abtippte, das Bildmaterial zusammenstellte und mir inhaltliche Tipps gab; meine Lektoren Sırma Köksal und Emre Taylan, die mir vom ersten Tag vor Gericht bis zur Haft nicht von der Seite wichen; Utku Lomlu, der sein Designergenie für das Cover nutzte und damit der Literatur ein neues Element schenkte: einen Hashtag als Gefängnisgitter[1]; meinem Anwalt und Freund Ümit Altaş, der zwischen dem Verlag und mir eine Brücke baute, und meiner Assistentin Ayçin Yenitürk, die half, die Mängel des Buches zu beheben.
Der Zorn und die Panik, die unsere Freilassung im Präsidenten-palast und seinem Pool[2] auslösten, deutet darauf hin, dass dieses Buch noch nicht zu Ende ist.
Wir warten auf »Neuauflagen« für noch kommende Erinnerungen.
Solange sie den Druck erhöhen, erhöhen auch wir ihn.
Die Antwort auf die Frage, ob schlussendlich der Druck der Regierung oder der Druck des Buches Spuren hinterlassen wird, sei der Geschichte überlassen.
Can Dündar
März 2016
1Das Verbrechen
28. Mai 2015, Donnerstag.
15.00 Uhr.
Außerordentliche Sitzung im fünften Stock der Zeitung Cumhuriyet, in dem Büro, in dem seinerzeit der langjährige Chefredakteur Ilhan Selçuk saß.
Als die bleisicheren Vorhänge zugingen, wurde auch die stickige Luft im Raum »schwer wie Blei«.[3]
Wir waren zu siebt.
Vier Redaktionsmitglieder: Tahir Özyurtseven, Murat Sabuncu, Doğan Satmış und ich.
Auf der »Gegenseite« drei Rechtsanwälte: Akın Atalay, Bülent Utku, Abbas Yalçın.
Später stieß noch der Journalist und Kolumnist Hikmet Çetinkaya zu uns.
Auf der Tagesordnung stand ein Video, das eine Straftat zeigte.
Zwar hatte nicht ich die Straftat verübt, aber weil ich beschlossen hatte, die Aufnahmen zu veröffentlichen, sollte ich dafür vor Gericht.
Auf dem Video war ein Lastwagen des Geheimdienstes MIT zu sehen.
Die Gendarmerie hielt den Lkw an.
Es kam zum Streit zwischen Geheimdienstlern und Gendarmen.
Die Gendarmerie holte die MIT-Leute aus dem Lkw und durchsuchte ihn auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft. Als die Stahltüren geöffnet wurden, stießen die Gendarmen zunächst auf Kisten mit Medikamenten, die zur Tarnung geladen waren. Darunter auf schwere Munition: Mörsergranaten, Kanonenkugeln u.a.
Die Aufnahmen stammten vom 19. Januar 2014.
Sechzehn Monate waren seither vergangen, die Sache war an die Presse, an die Justiz, ans Parlament gegangen, es hatte Diskussionen und Kritik gegeben.
Alles zu einer Zeit, als darüber spekuliert wurde, die Regierung unterstütze Al-Kaida und lasse den IS-Kämpfern Hilfe zukommen. Nun war sie in flagranti ertappt worden.
Das war das »Irangate der Türkei«.
Die Behauptung, humanitäre Hilfe zu leisten, war in sich zusammengebrochen.
Die Verteidigung, die Waffenlieferung ginge an die Turkmenen, war von turkmenischer Seite dementiert worden.
Die Staatsanwälte, die den Stopp des Lkw-Konvois veranlasst hatten, hatten geredet, Aussagen waren an die Öffentlichkeit gelangt, Fotos verbreitet worden. Neu war das Video.
Der von der Gendarmerie gedrehte Film dokumentierte eindeutig, um welche Fracht es sich tatsächlich gehandelt hatte.
Es war nichts Geringeres als ein internationaler Skandal.
Und die Wahlen standen unmittelbar bevor.
Die Cumhuriyet beobachtete die Sache seit Langem. Am 8. März 2015 hatte der Journalist Ahmet Şık mit dem suspendierten Staatsanwalt Aziz Takçı gesprochen, wir hatten mit dem Interview aufgemacht. Wir spürten, damit waren wir dem, was die Aufnahmen von der Razzia zeigten, sehr nahegekommen.
Am Nachmittag des 27. Mai brachte ein befreundeter linksgerichteter Abgeordneter die Videoaufnahmen vorbei.
»Was du wissen willst, ist auf diesem USB-Stick«, sagte er.
Als ich das Video ansah, waren alle Zweifel fortgewischt:
Der Geheimdienst MIT lieferte Waffen nach Syrien.
Wenn Sie Chefredakteur einer Zeitung sind, bekommen Sie tagtäglich eine Vielzahl von Informationen und Dokumenten in die Hände.
Mal zweifelt man an der Echtheit der Unterlagen, mal an der Absicht des Informanten.
Das Risiko, für eine Operation instrumentalisiert zu werden, ist hoch.
In einer solchen Situation stellen Sie sich zwei Fragen:
Ist das zugespielte Dokument echt?
Ist seine Veröffentlichung im Interesse der Öffentlichkeit?
Lautet die Antwort auf beide Fragen »Ja«, dann wäre nicht die Publikation Verrat an Ihrem Beruf, sondern wenn Sie die Sache in die Schublade stecken würden.
Ich gab die Aufnahmen unverzüglich unserem Redaktionsteam zur Kenntnis, es herrschte große Aufregung.
Was die Veröffentlichung anging, zögerten wir keinen Augenblick. Doch es war spät, wir beschlossen, den Bericht auf den Folgetag zu verschieben.
Am nächsten Tag hockten wir uns im entlegensten Winkel des vierten Stocks vor einen Computer und entwarfen die Seite eins. Noch wussten nur sehr wenige von dem uns zugespielten Material.
Wir wählten die deutlichsten Aufnahmen aus dem Video aus und setzten sie auf die Seite.
Die Schlagzeile dokumentierte eine Lüge:
»Hier sind die Waffen, die Erdoğan leugnet!«
Zu diesem Zeitpunkt kam ich auf die Idee, unsere »Bombe« dem Vorsitzenden des Exekutivausschusses, Akın Atalay, zu zeigen.
Akın bekleidete die Position des Herausgebers im Namen der Cumhuriyet-Stiftung.
Ein Manager, der sorgsam auf die sensible Linie zwischen Redaktion und Stiftung achtgab. Zudem vertrat er sowohl die Zeitung als auch mich persönlich als Anwalt. Bei heiklen Berichten pflegte ich ihn um Rat zu fragen.
Als er das Video sah, reagierte zunächst der Journalist in ihm mit Empörung, dann rief der Anwalt zur Besonnenheit.
»Hast du an die Konsequenzen gedacht?«, fragte er.
Da schrillte bei mir die Alarmglocke.
So gingen wir in die eilig einberufene Sitzung am 28. Mai.
Anwälte und Journalisten nahmen in einander gegenüber aufgestellten schwarzen Ledersesseln Platz.
Die Anwaltsriege der Cumhuriyet verstand aufgrund jahrelanger Erfahrung »die Sprache der Journalisten«. Üblicherweise listeten sie die Risiken auf und überließen die Entscheidung der Redaktion. So hielten sie es auch diesmal.
Einleitend sagte Akın unmissverständlich: »Sie werden sagen, es handele sich um ein Staatsgeheimnis. Gegen Staatsanwälte und Soldaten, die den Lkw-Konvoi stoppten, wurden Haftbefehle erlassen. ›Aufdeckung von Staatsgeheimnissen‹ ist eine schwerwiegende Straftat. Haft ist unausweichlich. Ich persönlich bin nicht gegen die Veröffentlichung, aber ich bin verpflichtet, die Risiken zu nennen. Das solltet ihr berücksichtigen.«
Ich wandte mich an Bülent Utku, den erfahrenen Strafverteidiger im Team.
»Das Risiko ist hoch, Can«, sagte er. »Ich denke, ihr solltet es sein lassen.«
Der stellvertretende Chefredakteur Tahir Özyurtseven ergriff das Wort: »Ich bin für die Veröffentlichung. Aber wenn es Can ist, der dafür geradestehen muss, dann sollte er entscheiden.«
Unser Nachrichtenchef Murat Sabuncu war der Meinung, dass man eine Woche vor den Wahlen am 7. Juni die Cumhuriyet und mich nicht antasten würde.
»Bei Erdoğan ist alles möglich«, mahnte Akın.
Murat schlug vor: »Und wenn wir alle unsere Unterschrift darunter setzen, wenn wir den Bericht mit unser aller Namen herausbringen?« Doch Doğan hielt dagegen:
»Dann ist das kein Journalismus, dann geben wir uns den Anschein einer Organisation.«
»Wie wäre es, das Video auf YouTube hochzuladen?«
»Das wäre Betrug.«
Am besten war also, transparent, offen und ehrlich zu sein.
Wir glaubten nicht, eine Straftat zu begehen, im Gegenteil, wir würden eine Straftat aufdecken.
Der Geheimdienst maßte sich ohne Wissen des Parlaments eine Kompetenz an, die ihm gesetzlich nicht zustand, und lieferte Waffen in ein Nachbarland.
Die Waffen gingen vermutlich an radikal-islamistische Organisationen. Damit ergriff die Türkei Partei im syrischen Bürgerkrieg. Die Öffentlichkeit hatte ein Recht darauf, davon zu erfahren und sich an der Wahlurne entsprechend zu verhalten. Denn sie würde die Rechnung zu bezahlen haben.
Meine Masterarbeit an der Middle East Technical University hatte ich zufälligerweise über »Staatsgeheimnisse und Pressefreiheit« geschrieben. Ich kannte internationale Beispiele dazu wie auch die Gesetzeslage. Ich wusste, dass eine Straftat kein Geheimnis sein konnte. Watergate, Irangate, Pentagon Papers, Wikileaks, stets war enthüllt worden, dass schmutzige Operationen der politischen Machthaber mit dem Stempel »streng geheim« in Geheimakten verschwanden, letztlich landeten aber nicht die Journalisten, sondern die Regierenden, die sich strafbar gemacht hatten, vor Gericht. Unser Bericht war stark. Mein Gewissen rein.
Es gab ein öffentliches Interesse an diesen Informationen. Dafür traten wir ein.
»Was kann schlimmstenfalls passieren?«, fragte ich.
»Sie führen nachts eine Razzia in der Druckerei durch, beschlagnahmen die Zeitung, nehmen dich fest und erlassen einen Haftbefehl«, sagten die Anwälte.
»Gut, dann drucken wir«, sagte ich.
Die Besorgnis im Raum war mit Händen greifbar, alle sorgten sich um mich.
Ich respektierte ihre Sorge, wusste aber, jetzt galt es nicht, sich zu sorgen, sondern zu informieren.
Kurz vor Ende der Sitzung kam ein letzter Vorschlag: »Wenn du das wirklich durchziehen willst, geh wenigstens nicht das Risiko der Verhaftung ein. Geh ins Ausland.«
»Wann?«
»Sofort. Jetzt.«
Es waren noch zehn Tage bis zu den Wahlen. Auf dem Weg zu den Wahlurnen schien eher unwahrscheinlich, dass die Regierung sich einen Übergriff auf die renommierteste Zeitung des Landes erlauben würde. Doch bei Erdoğan konnte man nie wissen.
Es machte Sinn, bis zu den Wahlen vorsichtig zu sein und die darauffolgenden Entwicklungen zu beobachten.
Wir fassten mehrere Beschlüsse:
Auf der Website würde die Ankündigung stehen: »Die Cumhuriyet lässt die Bombe platzen«, aber die Nachricht selbst sollte bis zum Morgen zurückgehalten werden.
Beschluss-Sitzung (von links): Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Can Dündar, Tahir Özyurtseven, Akın Atalay, Bülent Utku, Doˇgan Satmı¸s, Abbas Yalçın.
Cumhuriyet, 29. Mai 2015: »Warum bringen wir das?«.
Die frühe Ausgabe der Zeitung für die Auslieferung in den Provinzen sollte den Bericht nicht enthalten, um das Risiko einer möglichen Razzia in der Druckerei zu vermeiden.
Ich würde einen Leitartikel verfassen, in dem ich der Leserschaft erläuterte, warum wir die Nachricht brachten.
Wir waren uns einig. Zur Erinnerung ließen wir ein Foto machen und gingen an die Arbeit.
Jeder wusste, dass uns eine schwierige Nacht (und ebensolche Tage) bevorstanden.
Ich ging in mein Büro und schrieb den Leitartikel.
Meine Assistentin Ayçin schaute unterdessen nach Flugtickets.
Plötzlich fiel mir Mehmet Ali Birand ein.
Ich hatte ihn anlässlich meiner Masterarbeit über Staatsgeheimnisse kennengelernt. Er hatte als erster Journalist darüber berichtet, dass die zur türkischen Marine gehörige Fregatte Kocatepe bei der Militäraktion auf Zypern 1974 aus Versehen versenkt worden war.
Auch der Skandal damals war ein »Staatsgeheimnis« gewesen.
Auch er hatte, als er ein Jahr nach dem Skandal die »Bombennachricht« seiner Zeitung abgeliefert hatte, Pass und Flugticket eingesteckt und sich auf den Weg zum Flughafen gemacht.
Genau vierzig Jahre später war es nun an mir, die Szene, die ich in meiner Masterarbeit geschildert hatte, selbst zu erleben.
Ich würde nach London fliegen, zu meinem Sohn, der dort studierte.
Doch die Flüge nach London waren ausgebucht.
Es gab nur Platz in einem Flugzeug nach Köln.
Man legte mir den Entwurf für die erste Seite vor. Sie sah großartig aus!
Ich verabschiedete mich von meinen »Komplizen« in der Redaktion und fuhr am frühen Abend nach Hause.
Dilek freute sich, dass ich so früh kam, wunderte sich aber zugleich. Der Tag ging zur Neige.
»Komm, lass uns ein Glas Wein trinken«, schlug ich vor. Auf der Terrasse, bei Wein und Käse, überbrachte ich ihr die Nachricht.
»Ich gehe.«
»Wann?«
»Jetzt.«
»Wohin?«
»Nach London.«
Sie verstand sofort. Ein Hauch von Nervosität huschte durch ihren Blick.
»Gibt es eine Hausdurchsuchung?«, fragte sie.
»Das glaube ich kaum, aber möglich ist es doch. Bleib nicht zu Hause.«
»Hättet ihr nicht auf die Veröffentlichung verzichten können?«
Ich gab keine Antwort.
Zwei Stunden später war ich am Flughafen Sabiha Gökçen.
Mein Telefon stand nicht still, alle wollten wissen, was es mit der »Bombe« auf sich hatte, die Nachricht verbreitete sich rasant im Internet.
Man schickte mir die Endversion der Seite auf mein Smartphone.
Ich rief Tahir an.
Wir besprachen, was zu tun wäre, falls es zu einer Razzia in der Druckerei käme.
Mir behagte es gar nicht, in einer solchen Nacht nicht in der Redaktion zu sein, doch die Entscheidung war nun einmal gefallen, es gab kein Zurück.
Eine SMS kam und weckte den Gedanken, es könnte auch einfach eine angenehme Auszeit werden:
»Mein bester Freund kommt nach London. Ich freue mich sehr. Der Abwasch stapelt sich schon, Mann.«
Mein Sohn Ege.
Zwei Jahre lang hatte ich den Ort, an dem er lebte, und seine Universität nicht gesehen.
Ich würde »meinen besten Freund« treffen. Was wollte ich mehr?
Um 23:00 Uhr bestieg ich das Flugzeug.
Beim Start war ich in Gedanken bei der Zeitung und zu Hause.
Würden sie die Druckerei durchsuchen und die Zeitung konfiszieren?
Würden sie bei mir zu Hause vor der Tür stehen und nach mir suchen?
Würde diese Reise, von der ich hoffte, dass sie von kurzer Dauer wäre, sich in ein langes Exil verkehren?
Das würde sich herausstellen, während ich in der Luft war.
Der Pfeil war abgeschossen.
In Gedanken machte George Orwell mir Mut:
»In Zeiten, da Täuschung und Lüge allgegenwärtig sind, ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt.«
2Die Drohung
Manche Städte reiben dich auf, manche nehmen dich auf.
London ist mir der Hafen, in dem ich wer weiß wie oft schon Zuflucht suchte.
Als ich nun wieder unterwegs dorthin war, erinnerte ich mich an meine erste Reise nach London.
Vor genau dreißig Jahren.
Damals leitete ich das Ankara-Büro von Nokta, dem couragiertesten Magazin in der Zeit nach dem Militärputsch von 1980.
An der Spitze der Zeitschrift stand ein hervorragender Mann:
Ercan Arıklı.
Seine Genehmigung und ein sechsmonatiges Stipendium in der Tasche, fuhr ich zu einem Lehrgang für Journalisten.
Auf der Zwischenetappe Ankara-Istanbul war Arıklı bei mir.
»Du verpasst eine große Bombe«, flüsterte er mir ins Ohr.
Ich fragte nach, er fabulierte daher. Ich begriff, dass er nichts verlautbaren lassen wollte, und tat so, als glaubte ich ihm.
Von der »Bombe« erfuhr ich in London.
»Die Bekenntnisse des Folter-Polizisten.«
Das legendäre Cover der Nokta.
Jetzt, dreißig Jahre später, flog ich mit einer anderen »Bombe« im Schoß nach London.
Wieder würde London mich aufnehmen.
Kaum stieg ich in Köln aus dem Flieger, schaltete ich das Telefon ein. »Absolute Ruhe und Ordnung«. Die Zeitung war raus. Aber nicht aus dem Spiel!
In einem kleinen Hotel am Flughafen Köln fiel ich in einen erschöpften, besorgten Schlaf.
Am Morgen weckte mich ein Anrufersturm.
Cumhuriyet, 29. Mai 2015: »Hier sind die Waffen, die Erdoˇgan leugnet«.
Die Nachricht schlug im turbulenten Vorfeld der Wahlen ein wie eine Bombe.
Die Staatsanwaltschaft leitete unverzüglich ein Verfahren ein und tat das ungewöhnlicherweise mit einer Presseerklärung kund:
Ich wurde der »Spionage« angeklagt, da ich Informationen veröffentlicht hatte, die »geheim zu halten waren«. Für wen waren diese Informationen geheim zu halten? Für den Geheimdienst MIT? Für den IS? Für die Bevölkerung? Wer hatte darüber zu entscheiden?
»Die Anschuldigung ist aus der Luft gegriffen, aber sie machen daraus ein Verbrechen, worauf lebenslänglich steht. Die Verhaftung ist unausweichlich. Jeden anderen hätten sie längst abgeholt. Da sie das Verfahren nun mit einer Erklärung verkündet haben, werden sie dich zur Vernehmung vorladen. Warten wir erst einmal ab«, riet Akın am Telefon.
Die schwere Anschuldigung verstärkte die Wirkung der Nachricht noch.
Es hagelte Unterstützeranrufe.
Der CHP-Vorsitzende Kılıçdaroğlu sagte am Telefon: »Wir haben gesehen, dass es couragierte Journalisten in diesem Land gibt. Sie sollen wissen, dass wir stets an Ihrer Seite stehen.«
Die Zentrumsmedien ignorierten die Nachricht. Die regierungstreuen Medien dagegen gingen zum Angriff über. Scharfmacher wie Cem Küçük gaben den Standpunkt der Regierung wieder:
»Verhaften! Aber vor den Wahlen wäre das ein Fehler.«
In einer Fernsehsendung schlugen Nagehan Alçı und Cem Küçük eine praktische Lösung vor: »Wäre etwas Ähnliches wie die Sache mit den MIT-Konvois in Amerika passiert und hätte eine Zeitung wie die New York Times Bilder von CIA-Lkws veröffentlicht, hätte man das nicht auf dem Rechtsweg gelöst. Die CIA hätte die Sache mit einem Verkehrsunfall erledigt.«
Mitten in all dem Tumult flog ich nach London.
Und traf meinen Sohn.
Bei der ersten Umarmung waren Unruhe und Sorgen vergessen.
Lange liefen wir durch den Hyde Park.
Ich erzählte ihm von meinen Jahren in London ohne ihn, er von dem London, das er ohne mich kennenlernte.
Das Telefon stand nicht still, ständig holte es mich in die Gegenwart, in mein Land zurück. Durch den schönen Park düsten Lkws mit Waffenladungen und zerfetzten das Vater-Sohn-Gespräch, von dem es für uns nicht genug geben konnte.
Einer der Anrufe schmerzte mich sehr.
Der Karikaturist Bedri Koraman war verstorben.
Ich musste zurück und es wenigstens auf seine Beerdigung schaffen.
Anschließend sollte ich meine Aussage machen.
Aus der Ferne streiten, war nicht meine Sache. War ein Kampf nötig, dann musste ich mich ihm stellen, war ein Preis nötig, dann musste ich ihn zahlen.
Ich verschloss die Ohren vor allen, die rieten: »Bleib da!« Mir war bereits klar, dass ich nicht länger bleiben, sondern heimkehren würde.
In der Nacht des 31. Mai geschah etwas, das diese Entscheidung bekräftigte.
Ege und ich aßen im berühmten indischen Restaurant Han. Da kam eine Nachricht von Murat Sabuncu:
»Erdoğan macht dich auf TRT nieder.«
»Was sagt er?«
»›Ich habe ihn angezeigt. Denen geht es darum, die Türkei schlechtzumachen. Die Person, die das als Aufmacher brachte, wird teuer dafür bezahlen. Der kommt mir nicht so davon.‹«
Ich las Ege die Zeilen vor.
Cumhuriyet, 2. Juni 2015.
Cumhuriyet, 3. Juni 2015.
»Was antworten wir darauf?«, fragte ich ihn.
Dann schrieb ich spontan auf Twitter:
»Die Person, die dieses Verbrechen beging, wird teuer dafür bezahlen. Der kommt uns nicht so davon.«
Das Titelblatt der Zeitung vom 2. Juni wurde übermittelt. Sämtliche Redaktionsmitglieder und Autoren der Zeitung (mit einer Ausnahme) zeigten Stirn: »Verantwortlich bin ich.« Am nächsten Tag solidarisierten sich die Künstler: »Wir sind an eurer Seite.« Also musste ich an ihrer Seite sein. Bei einem solchen Sturm konnte ich nicht länger in London herumsitzen.
Nach vier Tagen Auszeit entschloss ich mich zur Rückkehr. Fünf Tage vor den Wahlen besorgte ich mir ein Flugticket.
Vor der Abreise kopierte ich meinen Computer komplett auf eine externe Festplatte und gab sie Ege in Obhut. Es war nicht abzusehen, was geschehen würde, falls sie bei meiner Rückkehr gleich zugriffen. Sie hatten schon viel auf dem Kerbholz.