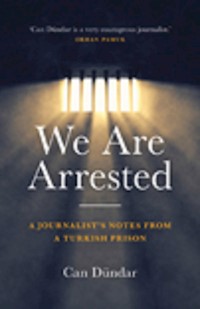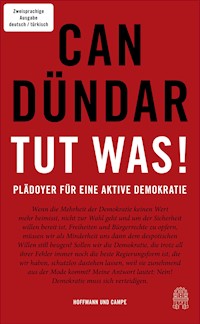
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zweisprachige Ausgabe: deutsch/türkisch "Sollen wir die Demokratie, die trotz all ihrer Fehler immer noch die beste Regierungsform ist, die wir haben, schutzlos stehenlassen, weil sie zunehmend aus der Mode kommt? Meine Antwort lautet: Nein! Demokratie muss sich verteidigen." In seinem leidenschaftlichen Plädoyer für eine aktive Demokratie erklärt Can Dündar, warum es nicht mehr reicht, alle vier Jahre brav seine Stimme abzugeben. Seit Populismus zur globalen Krankheit geworden ist und nur noch 4,5 Prozent der Weltbevölkerung in vollständig demokratischen Zuständen leben, braucht es Bürger, die sich aktiv an der Politik beteiligen, die ihre Stimme lautstark zu Gehör bringen. Dündar zeigt, wie jeder Einzelne sich für soziale Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit einsetzen kann. Wenn wir uns jetzt einmischen und uns erheben, ist noch nicht alles verloren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Can Dündar
Tut was!
Plädoyer für eine aktive Demokratie
Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe
Hoffmann und Campe
In der Türkei zeigen Karikaturisten die Demokratie meist als strahlend schöne Königin. Eine attraktive, selbstbewusste, vitale junge Frau. Göttin der Ruhe, des Friedens und des Überflusses. Eine glaubensstarke, kämpferische Jeanne d’Arc. Eine Themis, die Schwert und Waage nie aus der Hand legt.
So stellte auch ich mir als Kind die Demokratie vor.
Heute, ein Dreivierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich die bildschöne Königin in meinem Kopf in eine schwache Greisin verwandelt. Im Osten der westlichen Welt drängt jemand sie unter das Kopftuch, ganz im Westen richtet ein anderer sie übel zu. Unsere gereizte, erschöpfte Demokratie hat die Hoffnung auf die Zukunft verloren und ringt mit dem Tod.
Wann und wie ist die einstige Schönheit zu einem solchen Wrack geworden?
Warum ist sie auf einmal so schwächlich?
Wo hat sie Fehler gemacht?
Winds of change
Erinnern Sie sich an 1989? An das Licht, das mit dem Fall der Mauer auf unsere Erdkugel fiel, an die Hoffnung, die zwischen ihren Überresten hervorspross? Enthusiastisch sangen die Scorpions Winds of Change und fragten: Did you ever think / That we could be so close, like brothers?1
Die blutbefleckten Erinnerungen, die uns gegeneinander aufgehetzt hatten, waren für immer begraben. Der Duft von Hoffnung lag in der Luft. Die Winde des Wandels läuteten die Freiheitsglocke und bliesen uns den Glauben an ein Morgen ins Gesicht. Das war überall zu spüren.
Was ist aus diesen Winden geworden?
Wann sind sie abgeflaut, warum hat sich ihr Hauch verbraucht?
Wie kam es, dass unsere Mutter Erde Kinder zur Welt gebracht hat, die sich nun überall gegen sie wenden?
Der erste Warnruf kam von Leonard Cohen. Keine drei Jahre nach dem Mauerfall, als in Europa noch der Freudentaumel über den unerwartet hereingebrochenen Frühling herrschte, warnte er auf seinem Album The Future vor einem heraufziehenden Schneesturm.2 Wie ein Derwisch hatte er eine Vorahnung, vernahm in der Ferne das Rumoren der Reue, roch den heraufziehenden Sturm und forderte die Berliner Mauer zurück. Denn er hatte die Zukunft gesehen. »Mord« sei die Zukunft. Im Magen der neuen Ordnung grummelte es vor Mordlust. Die Utopie würde schon bald ihrem verfluchten Zwilling, der Dystopie, weichen.
Demokratie im Stillstand
Ein Vierteljahrhundert später belegte der Demokratie-Index 20173, dass sämtliche Prophezeiungen aus Cohens Lied eingetroffen waren.
Der Report verkündete, auf der Welt seien kaum Fortschritte in Sachen Demokratie zu verzeichnen, ganz im Gegenteil gebe es massive Rückschritte. Nur 4,5 Prozent der Weltbevölkerung lebten demnach in vollständig demokratischen Zuständen. Rund ein Drittel der Staaten werde von autoritären Regimen regiert. Der Index wies auf Rückschritte insbesondere in Asien hin, stufte die Vereinigten Staaten, die im Vorjahresbericht noch zu den »vollständigen Demokratien« gezählt hatten, zu den »unvollständigen Demokratien« zurück und erklärte die Türkei zum »größten Journalistengefängnis der Welt«.
In entwickelten Demokratien hätten sich die politischen, sozialen und kulturellen Spannungen verschärft und die Spaltung der Gesellschaft vertieft, die Wahlbeteiligung und das Interesse der Bevölkerung an Politik seien geschrumpft. Das Vertrauen in Institutionen habe abgenommen, traditionelle Parteien verlören an Attraktivität, die Kluft zwischen Eliten und Wählern risse weiter auf. Presse- und Meinungsfreiheit sowie Bürgerrechte seien allerorten Angriffen ausgesetzt. Regierungen schränkten die Freiheit der Bürger ein und stärkten zugleich die eigene Macht.
In den letzten Jahren wurden aus fast allen Hauptstädten Europas ähnliche Wahlergebnisse gemeldet. In den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien – überall sorgen die Parteien der Mitte für Überdruss und schmelzen dahin, die Rechnung für ihr Scheitern geht an die liberale Demokratie, populistische Parteien, die sich Abschottung, EU-Austritt und Ausländerfeindlichkeit auf die Fahnen geschrieben haben, sind rasant gewachsen. Unter dem Beifall der Massen ist ein vor siebzig Jahren eingesargter Vampir wieder zum Leben erweckt worden.
Die Demokratie scheint auf dem Kontinent, auf dem sie einst entstand, geschlagen, der Populismus ist zur globalen Krankheit geworden.
Wo nur hat sich unsere Welt diese Krankheit geholt?
Was ist geschehen, dass die Winde des Wandels, die gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts so stark wehten, uns Tumult statt Stabilität gebracht haben?
Wie konnten aus den Trümmern der gefallenen Mauer noch höhere Mauern entstehen?
Kurz: Warum steht die Welt seit fünfzehn Jahren kopf?
Die Herrschaft der Angst
Auf den ersten Blick scheint alles das Werk ein und desselben Despoten zu sein:
Ich nenne ihn den »Herrscher der Angst«.
Als der globale Sturm des Wandels unvermutet über uns hereinbrach und alles hinwegfegte, was wir im vergangenen Jahrhundert für unumstößlich gehalten hatten, entstand zunächst eine Atmosphäre großer Ungewissheit und anschließend ein Klima ernsthafter Besorgnis.
Wir bekamen es mit der Angst zu tun.
Der Nationalstaat, der uns immer ein einigermaßen vorhersehbares Leben in bekannten Grenzen versprochen hatte, ist auf einmal von der Bühne abgetreten. Über die offeneren Grenzen sind multinationale Konzerne und internationale Organisationen gekommen, die große Reden schwingen und grellbunt leuchten. Grenzenloser Wettbewerb, Technologien, deren Sprache wir nicht verstehen, ein dreistes neues System ohne Regeln und Ordnung, das Argwohn und Unsicherheit verursacht – all das hat unser Gleichgewicht aus dem Lot gebracht.
Unser Verhältnis zu der Gewerkschaft am Arbeitsplatz, zum Krämer an der Ecke, zu der Zeitung, die wir lasen, der Bank, der wir unser Geld anvertrauten, dem Telefon in unseren Händen, der Partei, der wir unsere Stimme gaben, hat sich im Eiltempo verändert, unsere familiären Beziehungen, Arbeitsverhältnisse, Fernsehnachrichten, Immobilienkredite, Lebensweisen – alles Gewohnte ist fremd geworden und wandelt sich. In einem sozialen Erdbeben spüren wir den Boden, auf dem wir uns seit Generationen bewegt haben, erschüttert und uns unter den Füßen entgleiten.
The Future steht vor der Tür.
Wir haben Angst.
Manche von uns fürchten den Terror, der Blutspuren durch die Straßen unserer Städte gezogen hat, manche fürchten die ungeheure Migrationswelle, die unsere Grenzen bestürmt, manche fürchten, durch diese Flut ihre Arbeit zu verlieren. Einige schreien auf: »Der religiöse Glauben geht verloren!«, andere warnen: »Die Religion kommt an die Macht!« Einige fürchten sich vor Atomwaffen, andere, keine Atomwaffen zu besitzen. Manche sind erschrocken angesichts von Börsen, an denen es drunter und drüber geht, andere über die globale Erwärmung. Manche haben Angst, im Alter obdachlos zu werden, andere, in einem solchen Chaos Kinder zur Welt zu bringen. Manche fürchten, ihre Kinder an hitzige Hasardeure zu verlieren, andere fühlen sich bedroht, wenn Homosexuelle heiraten dürfen.
Die Wolke der Angst, die aus den Trümmern der gefallenen Mauer emporgewabert ist, hat sich in alle Winkel unseres Erdballs ausgebreitet.
Erschreckend sind die Zahlen, die Yascha Mounk in seinem Buch Der Zerfall der Demokratie4 nennt:
Vor zwanzig Jahren fanden nur 25 Prozent der Briten die Idee eines starken Staatschefs attraktiv, der sich nicht um Parlament und Wahlen schert, heute sind es dagegen über 50 Prozent. 1995 glaubte einer von sechzehn Amerikanern, ein Militärregime sei besser als Demokratie, heute dagegen ist es einer von sechs. In Deutschland wurden die Populisten zur größten Oppositionspartei im Bundestag, in Österreich wurden sie sogar so stark, dass sie als Koalitionspartner mitregieren, auch in Frankreich, den Niederlanden, Italien, Griechenland, Polen und Ungarn haben sie Aufwind oder sind an der Regierung beteiligt. Die »Krankheit« grassiert also auch auf dem europäischen Kontinent.
Die Massen, die den von Cohen angekündigten »Mord« vorausahnen, vereinen sich keineswegs in einer politischen Verteidigungslinie, um solidarisch nach Auswegen zu suchen, vielmehr verschanzen sie sich hinter den Sesseln autoritärer Führungspersönlichkeiten, die ihnen ihre aufgestauten Sorgen nehmen und neue Mauern an ihren Grenzen errichten, die die Fremden zurückschicken, an die die Massen ihre Jobs zu verlieren fürchten, und die ihnen das Gefühl geben, nicht allein zu sein, die ihnen Selbstbewusstsein und Geltung versprechen.
Putin, Trump, Orbán, Strache, Wilders, Erdoğan und Berlusconi sind nicht die Ursachen der globalen Angst, die die Welt im Griff hält, sondern ihr Resultat.
Mit Macht ausgestattet von den Massen, die sich verängstigt unter ihre Fittiche flüchten und sie beknien, das Problem mit welchen Mitteln auch immer zu lösen, fordern sie die ihrer Fähigkeit zur Problemlösung verlustig gegangene Politik der Mitte, das Establishment, heraus. Statt Alternativen zu bieten, greifen sie das System an:
Mit verschiedenen Methoden wie der Manipulation von Wahlergebnissen, der Entlassung eigensinniger Richter, Attacken gegen kritische Medien und der Inhaftierung von Widersachern demontieren sie der Reihe nach die wichtigsten Standbeine der Demokratie.
Als starke Persönlichkeiten kommen sie nicht nur den Massen ohne Selbstvertrauen gelegen, sondern auch dem begehrlichen internationalen Kapital. Die Demokratie der Koalitionen tut sich schwer mit Entscheidungen, weil sie nach Ausgleich sucht. Den »Alleinherrscher« eines totalitären Regimes zu überzeugen, ist dagegen viel einfacher, erst recht wenn er geldgierig ist. Die liberale Überzeugung, Freihandel benötige Demokratie und freie Gesellschaften, um Waren zu verkaufen und neue Märkte zu erschließen, straft das globale Kapital Lügen, wenn es auf stabilen Despotismus statt auf demokratisches Chaos setzt.
Themis hat die Waage der Gerechtigkeit sinken gelassen und konzentriert stattdessen ihre Kraft auf das Schwert.
All dies sind Resultate. Um die Gründe zu verstehen, müssen wir weiter zurückgehen und näher betrachten, wie das Klima der Besorgnis, das eine seit dem Zweiten Weltkrieg einzigartige Vertrauenskrise und Tendenz der Autoritarisierung ausgelöst hat, entstehen konnte.
Ich will aus meiner persönlichen Perspektive von dieser Zeit erzählen. Dass es sich bei dem Ausschnitt, den ich aus meinem lokalen Fenster sehe, um einen Teil der Szenerie handelt, die sich uns nun in globalen Ausmaßen zeigt, verstehe ich jetzt viel besser.
Tür auf für Islamisten
Zu Zeiten des Kalten Kriegs war es einfach, die Welt zu begreifen:
Wir gehörten entweder zum Osten oder zum Westen. Waren entweder rechts oder links. An einem der beiden Pole zu stehen, gab uns ein Zugehörigkeitsgefühl, einen Identitätsausweis. Trotz mancher Klagen fühlten wir uns in Sicherheit in einer Gruppe, die uns schablonenhafte Meinungen bot, in der übergestreiften Uniform, mit dem Abzeichen am Kragen.
Ende der siebziger Jahre, als ich Student war, bekämpften sich in der Türkei Rechte und Linke in zwei gegnerischen Lagern auf den Tod. Täglich starben etliche Menschen meines Alters. Heiß spiegelte sich hier der Kalte Krieg. Die Türkei lag auf der Grenzlinie, wo Ost und West aufeinandertrafen. Sie war einerseits ein ferner Satellit der USA, aber auch offen für die von ihrem Nachbarn Sowjetunion ausgehenden Verheißungen des Sozialismus.
Unter jungen Leuten gab es neben Nationalisten auf der einen und Revolutionären auf der anderen Seite noch eine dritte Gruppe: die Islamisten. Wenn irgend möglich, hielten sie sich aus den Auseinandersetzungen heraus. Vom Trottoir aus beobachteten sie schweigend, wie in den Straßen das Blut floss. Recep Tayyip Erdoğan war damals einer der führenden Köpfe dieser islamistischen Jugend. Er wartete ab, bis seine Zeit anbrach.
1980