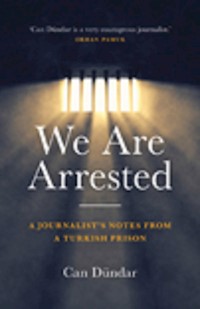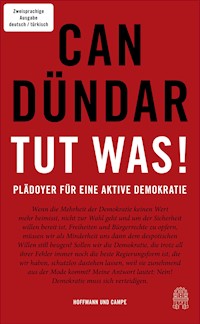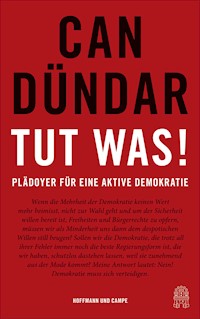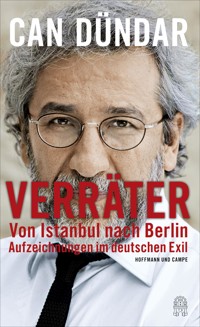
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung ›Cumhuriyet‹, die 2016 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde, saß wegen seiner mutigen Berichterstattung über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien drei Monate in türkischer Einzelhaft, wurde zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und ist nur knapp einem Mordanschlag entkommen. Wäre er während des Putschversuchs in der Türkei im Juli 2016 nicht im Ausland gewesen, säße er jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder im Gefängnis. Doch Dündar ging ins Exil und setzte seinen Kampf für die Pressefreiheit in seinem Land und gegen Erdoğan von Berlin aus fort. In seinen Aufzeichnungen aus dem deutschen Exil erzählt er von den Ereignissen, die sich in dem letzten halben Jahr nach seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft überschlagen haben: Prozess, Attentat, Urteil, der Putschversuch in seiner Heimat, seine Flucht nach Deutschland, sein Exil in Berlin. Dort führt er ein Leben zwischen Preisen und Anerkennungen, Bedrohungen und Anfeindungen, denn er kämpft weiter für eine demokratische, westlich orientierte Türkei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Can Dündar
Verräter
Von Istanbul nach Berlin. Aufzeichnungen im deutschen Exil
Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe
Hoffmann und Campe
In memoriam Mete Akyol
So stemmen wir uns voran, in Booten gegen den Strom, und werden doch immer wieder zurückgeworfen ins Vergangene.
F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby
Vorwort
Eines Morgens erwachte ich mutterseelenallein.
Das Haus, in dem ich aufwachte, war nicht meins, das Bett nicht das gewohnte.
Meine Frau lag nicht neben mir. Die Einrichtung war mir fremd.
Ich zog den Vorhang auf:
Eine fremde Stadt schaute herein. Weder war da der üppig grüne Garten noch das blaue Meer. Ich befand mich nicht in meinem Land. Die Sonne, deren stetiges Lächeln ich gewohnt war, hielt sich hinter Wolken verborgen.
Ich schaltete den Fernseher ein, auf dem Bildschirm redeten Menschen, die ich nicht kannte, in einer Sprache, die ich nicht verstand.
Ich hatte keine Arbeit, zu der ich hätte gehen, ebenso wenig einen Menschen, mit dem ich hätte reden können.
Mein Haus, meine Frau, meine Stadt, mein Garten, mein Land, meine Arbeit – alle meine Lieben waren auf einen Schlag aus meinem Leben verschwunden.
You’ll never walk alone, das Lied, das mir Freunde unentwegt ins Ohr gesungen hatten, war verstummt.
Sam-jsa bedeutet im Tschechischen »allein seiend«.
Die Erzählung von Gregor Samsas Erwachen und die Bedeutung seines Namens schienen in diesem Moment genau auf mich zu passen.
Ein Bericht in der Zeitung hatte mein Leben verändert.
Ich hatte ein »Geheimnis« aufgedeckt, das alle kannten.
Ich hatte belegt, dass der staatliche Geheimdienst illegal Waffen nach Syrien lieferte. Aufnahmen davon lagen vor. Die Regierung hatte es nicht dementieren können. Sie beharrte lediglich darauf, es handele sich um ein Geheimnis des erhabenen Staates, das im Verborgenen zu bleiben habe. Eine Operation, die das Land in einen Krieg hineinziehen konnte, war mit dem Schild »Kein Zutritt!« verrammelt worden. Niemand, der sich Journalist nennt, hätte ein solches Schild beachtet, jeder hätte sich die Sache genau angeschaut. Genau das hatten wir getan und damit die um eine internationale Straftat gezogene Grenzlinie verletzt.
Die Anschuldigung gegen uns war so gewaltig wie das Verbrechen, das wir enthüllt hatten:
»Aufdeckung eines Staatsgeheimnisses zwecks Versuchs, die Regierung zu stürzen …«
Zweimal lebenslänglich lautete die Forderung gegen uns. Nach dem alten Strafrecht[1] hätte das ein Todesurteil für uns bedeutet.
Einen Journalisten zum Tode verurteilen wollen, weil er einen wahren Bericht veröffentlich hatte!
Der Hass blendete die Rechtsprechung.
Man bezichtigte mich, ich kam ins Gefängnis, ich wurde vor Gericht gestellt, es wurde auf mich geschossen, ich wurde verurteilt. Und eines Tages wachte ich im Exil auf.
Es folgte der giftige Stempel:
»Landesverräter!«
Denn unser Land war Dieben in die Hände gefallen. Räubern, Waffenschmugglern, Kriegshändlern, Waldmarodeuren, Ausschreibungsschiebern, Palast-Intriganten, Religionsschacherern, Köpfe abschlagenden Dschihadisten …
Wer sich gegen sie stellte, galt als Gegner des ganzen Landes.
So nannte man es Landesverrat, dass wir den Mitschnitt des Telefonats veröffentlichten, in dem Erdoğan seinen Sohn fragte, ob er »das Geld im Haus« habe verschwinden lassen; dass wir die Worte des Geheimdienstchefs, »Wenn nötig, schicke ich vier Männer nach Syrien, lasse von dort acht Raketen auf die Türkei abfeuern und schaffe einen Kriegsgrund«, publizierten; dass wir mit einer Schlagzeile enthüllten, wie radikale Islamisten an der Grenze, bei Polizei und Justiz von Regierungsseite beschützt wurden; dass wir bekannt machten, wie Unternehmer auf Druck der Regierung und mit Großbauprojekten als Gegenleistung Medien aufkauften und in Propaganda-Instrumente verwandelten …
All dies waren Staatsgeheimnisse; schmutzige Geheimnisse, über die die Menschen im Land doch unterrichtet werden mussten.
Die über die Wahrheit gebreitete Decke reichte nicht länger, um den daruntergekehrten Dreck zu verbergen.
Die Regierung wandte eine in der Psychologie als Projektion bekannte Verteidigungsstrategie an:
Sie übertrug ihre eigene Schuld auf jene, die ihre Tat aufgedeckt hatten.
Um den eigenen Landesverrat zu verschleiern, erklärte sie jene, die für das Land eintraten, zu Landesverrätern. Dabei engagierten wir uns, weil wir unser Land liebten, nach Kräften dafür, dass es nicht von einem unzeitgemäßen Frömmler-Fanatismus in die Finsternis gerissen wurde, nicht mit seinem Nachbarn in Krieg geriet, seine Wälder und Ressourcen nicht geplündert wurden, dass es nicht von Bürgerkrieg, Angst und Armut überzogen wurde.
Wir waren es, die für Recht und Gerechtigkeit eintraten, sie dagegen missachteten sie.
Wir waren es, die den Baum hegten und pflegten, sie fällten ihn.
Wir waren es, die Frieden wollten, sie entfachten Krieg.
Wir waren es, die die Religion achteten, sie dagegen richteten sich nach dem Gebot der Politik.
Wir waren es, die gewalttätigen Polizisten Einhalt geboten, sie dagegen riefen: »Schießt!«
Wir hatten unsere Kinder dazu erzogen, sich nicht unrechtmäßig zu bereichern, sie dagegen hüteten daheim gehortetes schmutziges Geld.
Sie waren es, die uns in »wir und sie« auseinanderdividierten.
Als Erdoğan mich als Landesverräter abstempelte, stritt ich für sein Recht, in Deutschland aufzutreten. Denn, wie der bosnische Präsident Alija Izetbegović einmal sagte: »Ein Krieg geht nicht verloren, wenn man besiegt wird, sondern wenn man dem Feind ähnlich wird.« Für uns war existenziell, unter allen Umständen für Meinungs- und Redefreiheit einzutreten.
Als ich des Landesverrats bezichtigt wurde, riet ich deutschen Unternehmern, ihre Investitionen in der Türkei nicht auszusetzen, sondern sie an die Bedingung von Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Gegen die Regierung, die mein Land in die Einsamkeit führte, engagierte ich mich dafür, dass es nicht von der europäischen Familie losgerissen wurde.
Als Interpol der Haftbefehl gegen mich übermittelt wurde, sagte ich Deutschen, die sich nach Erdoğans an Angela Merkel gerichtetem Nazi-Vorwurf fürchteten, Urlaub in der Türkei zu machen: »Zwischen unseren Völkern gibt es kein Problem. Fahren Sie in die Türkei! Wir sollten einander noch viel näherkommen.«
Als die regierungstreue türkische Presse Deutschland vorwarf, »den Terroristen« im Schloss des Bundespräsidenten empfangen zu haben, warf ich Merkel vor, den Widerstand der Menschen in der Türkei zu ignorieren.
Man betrachtete die Türkei, als bestünde sie aus Erdoğan allein. Und genau dieses Bild versuchte auch Erdoğan zu vermitteln. Er versteckte sich hinter seinem Land und stellte Kritik an seiner Politik als Kritik an der Türkei insgesamt dar. Dabei ist die Türkei eine Sache, Erdoğan aber eine andere. Und da wir die erste lieben, wollen wir sie von der zweiten befreien.
Dieses Engagement war es, das mich fern meiner Heimat nach Deutschland führte, das mich in die unangenehme Lage versetzte, eines Morgens mutterseelenallein in Berlin aufzuwachen.
Was in meinem Leben seit einem Jahr fehlt, geht mir wegen Erdoğan ab. Doch auch was ich habe, ist – ironischerweise – ein wenig ihm geschuldet.
Wegen seiner Wut, seines Hasses, seines Rachedursts verlor ich meine Arbeit, meine Frau, mein Land, doch aufgrund des Kampfes, den ich gegen diese Hasskampagne führe, wurde ich ehrenvoll in die große Familie der Menschenrechtsverfechter aufgenommen. Die Proteste gegen ihn riefen Sympathie für mich hervor.
Die zehn internationalen Auszeichnungen, die ich im Laufe des vergangenen Jahres erhielt, und die Übersetzung meines Buches in fünf Sprachen belegen diese Solidarität. Wenn man am einen Ende der Welt für Demokratie, Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit streitet, rührt man damit an das Leben anderer, die am anderen Ende einen ähnlichen Kampf führen, und die starke Stimme der Solidarität verhindert, dass man im Stillschweigen ertrinkt.
Die Menschen in Europa wundern sich, warum Erdoğan trotz unzähliger Fehler, trotz seiner Wut und all der Repressionen seit so vielen Jahren in seinem Land und vor allem auch bei seinen Landsleuten in Europa nach wie vor derart populär ist.
Dafür gibt es verschiedene Erklärungen, eine lautet:
Er hat eine Geschichte.
Eine Geschichte, die ihm in der Politik sehr von Nutzen ist.
Er wuchs in einem Istanbuler Viertel auf, in dem viele Ausgegrenzte leben, sein Leben begann unter schlechten Voraussetzungen wie Bildungsmangel und Armut, doch er kämpfte gegen die Hindernisse auf seine Art an, dann musste er ins Gefängnis, weil er ein Gedicht vorgetragen hatte, später gelang es ihm, den Thron jener zu erobern, die ihn hinter Gitter gebracht hatten.
Das ist eine Erfolgsgeschichte, die großen Bevölkerungsgruppen, die wie er Diskriminierung, Armut und Bildungsmangel ausgesetzt sind, Hoffnung macht.
Allerdings geht die Geschichte böse aus:
Bis er den Gipfel des Erfolgs erreicht hatte, lebte Erdoğan in bescheidenen Verhältnissen; sobald er das Machtmonopol innehatte, ließ er einen der größten Paläste der Welt für sich errichten. Statt die Repression abzuschaffen, sagte er: »Jetzt ist die Reihe zu unterdrücken an mir«, und verwandelte die Türkei in ein gigantisches Freiluftgefängnis. Statt Bereicherung durch Diebstahl und Plünderung einen Riegel vorzuschieben, zog er es vor, »Jetzt sind wir dran« zu sagen und die Ressourcen des Landes großzügig seinen Anhängern zu kredenzen. Den Anschein des Staatsmanns, der sich um Frieden mit Kurden, Armeniern und allen Nachbarn bemüht und die Zukunft seines Landes in Europa sieht, legte er ab und verwandelte die Türkei in ein unterdrücktes, innerlich gespaltenes, einsames Land, das mit aller Welt zerstritten ist. All dies hüllte er in den Mantel der Religion. Er rühmte den Tod und machte seine Anhänger glauben, das Größte, was es im Leben zu erreichen gebe, seien Leichentuch und Märtyrertod. Kritik untersagte er.
Es stellte sich heraus, dass der Mann, der Knechten die Freiheit versprochen hatte, im Grunde nur selbst Herr über sie sein wollte.
Genau das ist es doch, was man Verrat am eigenen Land nennt.
Nun, auch ich habe eine Geschichte.
Als meine Mutter am Telefon sagte: »Mach dir keine Sorgen um mich, mein Platz ist bereit«, wusste ich, dass sie den Platz neben dem Grab meines Vaters meinte. Dass ich sie vielleicht nie mehr wiedersehen werde, ist der Preis dafür, dass wir unser Land gegen Repression, Diebstahl und Plünderei verteidigen.
Dass ich seit über einem Jahr meine Frau nicht haben treffen können, dass unser Haus, das wir vom Ersparten eines ganzen Lebens erworben hatten, nun von Konfiszierung bedroht ist und es das Bestreben gibt, mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ist der Preis dafür, dass wir unser Land lieben.
Dass ich mich eines Tages selbst fand, als ich im Wörterbuch nach dem Wort »haymatlos« suchte, dass ich im Büro hinter vorgezogenen Vorhängen arbeiten muss, dass ich fern von meinem geliebten Land lebe, ist der Preis für den Kampf darum, dieses Land nicht einem islamofaschistischen Regime in die Hände fallen zu lassen.
Nun, auch jene, die ein Auge verloren, weil auf sie geschossen wurde, als sie im Gezi-Park um den Erhalt eines Baumes kämpften, haben eine Geschichte. Eine Geschichte haben auch die Frau mit Kopftuch und Plastikschuhen an den Füßen, die auf dem Markt festgenommen wurde, als sie dort das Brot für ihre Kinder verdiente; die junge Frau, die attackiert wurde, weil sie den Bus in Shorts bestiegen hatte; der Karikaturist, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, weil er Erdoğan als Katze gezeichnet hatte; die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die von der Universität geworfen wurden, weil sie einen Aufruf gegen das Blutvergießen unter Brüdern unterzeichnet hatten; jene, die jetzt von der Partei, der sie aufgrund ihrer Frömmigkeit ihre Stimme gegeben haben, in Armut und Bedürftigkeit allein gelassen werden; die Frau, die Polizisten wegzerrten, ihr den Arm brachen und rücklings Handschellen anlegten, als sie Rechenschaft für den Tod ihres fünfzehnjährigen Sohnes durch eine Tränengasgranate der Polizei forderte[2]; die Kurden, deren Abgeordnete und Vorsitzende – von ihnen gewählt, als man ihre Städte und Dörfer zerstörte – in Ketten gelegt wurden; die Aleviten, deren Türen mit roter Farbe markiert wurden – sie alle haben eine Geschichte.
Das Land weiß mittlerweile, wer es liebt und wer es ausraubt.
Manche Bücher liegen verlassen in einer Schublade und warten darauf, geschrieben zu werden. Andere sind ungeduldig, rufen laut: »Schreib mich!«, und drängeln.
Dieses Buch hätte ich schreiben können, wenn irgendwann die Wunden des Exils verheilt und vernarbt sind, doch ich wollte, dass man weiß, um welchen Preis wir Widerstand leisten, dass man sieht, wie wir innerlich bluten, und dass bekannt wird, wer der eigentliche Landesverräter ist.
Ich wollte, dass man sieht, dass die Mächtigen im Unrecht und die Schwachen im Recht sind. Dass die Schwachen stärker werden, wenn die, die sich im Unrecht befinden, an Macht verlieren.
Ich wollte, dass man erkennt, wie schwierig und zugleich existenziell notwendig es ist, trotz aller im Kampf erhaltenen Lädierungen die Fahne der Hoffnung zu schwenken.
Den deutschen Leserinnen und Lesern, die den Preis der Ein-Mann-Diktatur aus der eigenen Geschichte kennen, wollte ich näherbringen, welch bleiches Antlitz das schöne Land, in das sie in Urlaub fahren, hinter den Mauern der Ferienressorts hat.
Als Augenzeuge wollte ich davon berichten, wie das »arme, aber sexy« Berlin immer mehr auch zu einer gefährlichen, aber hoffnungsfrohen Stadt politischer Flüchtlinge wird.
Ich wollte verkünden, dass die Überreste einer alten Mauer, an denen mein Weg täglich entlangführt, mir davon spricht, dass kein Repressionsregime ewig währt, auch wenn es jetzt ungeheuren Kummer bereitet.
Ich widme dieses Buch dem mit einundachtzig Jahren verstorbenen Journalisten Mete Akyol, der mir wie ein großer Bruder war.
Eine Woche nach unserer Verhaftung war er mit einem Stuhl vor das Gefängnis gekommen, in dem wir einsaßen.
Mete Akyol vor dem Gefängnis in Silivri.
Es war Winter, es war eiskalt. Er stellte den Stuhl vor das Tor, setzte sich darauf, hüllte sich in seinen Mantel und las den ganzen Tag ein Buch.
Es war ein persönlicher Protest, die Warnglocke, die ein damals achtzigjähriger Meister in aller Stille anschlug.
Bevor er heimging, sagte er: »Ich war einen Tag lang hier. Wenn jeder meiner Kollegen auch nur einen Tag lang herkommt, kann Hoffnung daraus entstehen.«
Ab dem folgenden Tag kamen Journalisten zu Hunderten und standen mit ihren Stühlen Schlange, um sich an der »Wache der Hoffnung« zu beteiligen. Bald kamen die Menschen in ganzen Busladungen herbei und verwandelten den Platz vor der Haftanstalt in einen Kundgebungsplatz.
Die Aktion, die der junge Mann von achtzig Jahren eingeläutet hatte, hatte großen Anteil daran, dass ich heute frei bin.
Als ich aus dem Gefängnis kam, brachte er mir den Stuhl und schenkte ihn mir. Ich versprach ihn dem Pressemuseum.
Manchmal reicht ein hölzerner Stuhl aus, um einen goldenen Thron zu stürzen.
Can Dündar
August 2017
1Das Flugzeug
Ich sitze im Flugzeug.
Zum ersten Mal seit Monaten.
Ich lasse vom Himmel den Blick über die Erde schweifen und erinnere mich an die Zeit vor drei Monaten:
Von einem Gefängnishof schaute ich zu den Flugzeugen am Himmel auf. Wie hoch und groß wirkte die Mauer, wie fern und klein das Flugzeug!
»Ob ich je wieder im Flugzeug sitzen und in die Ferne fliegen kann?«, seufzte ich damals.
Gezählte Tage vergehen, schlimm aber ist die Ungewissheit. Ein Lebenslänglicher kommt womöglich nie wieder frei.
Nun aber schaue ich aus dem Flugzeug auf die Landschaft unter mir. Ich halte Ausschau nach Silivri, nach dem Land der Gefangenschaft, in dem ich drei Monate logierte. Aus der Luft wirkt die Mauer niedrig und klein, das Flugzeug, in dem ich sitze, dagegen groß.
Schauen wohl jene, die jetzt dort im Gefängnis auf einem der Betonhöfe von vier mal acht Schritt stehen, zum Himmel hinauf?
Ob sie das Flugzeug sehen und dabei seufzen?
Im Grunde ist weder das Flugzeug extrem fern noch die Mauer extrem hoch.
Glauben und Hoffnung bestimmen unsere Wahrnehmung von Dimensionen.
Ohne Glauben und ohne Hoffnung kommen einem die Mauer höher und die Freiheit ferner vor, als sie tatsächlich sind.
Hoffnung indes verkürzt die Ausmaße der Mauer, die Entfernung des Himmels, den Weg zur Freiheit.
Der Glauben überwindet die Mauer und rückt die Ferne näher.
Und eines ist sicher:
Was dich nicht umbringt, macht dich stark.
2Trennung
Wenn Sie mit jemandem, den Sie mögen, zusammengesessen und geplaudert haben, verabschieden Sie sich vielleicht mit den Worten: »Wir sehen uns!«
Aber Sie sehen sich nicht wieder.
Es ist das letzte Treffen, ohne dass Sie es ahnen.
Hätten Sie es gewusst, wären Sie vielleicht länger geblieben, hätten sich jedes Wort des anderen genau eingeprägt, seinen Duft in sich aufgenommen, ihn ausgiebig umarmt, wären womöglich gar nicht gegangen; doch es ist zu spät.
Das tut weh.
Als Dilek, unser Sohn Ege, der in England studiert, und ich am letzten Junitag 2016 in London zusammen waren, ahnten wir nicht, dass dies unser letztes Treffen vor einer sehr langen Trennung sein würde. Nach einem Interview beim Guardian machten wir es uns auf Liegestühlen draußen vor dem Zeitungshaus bequem, schauten den Enten auf dem Kanal zu und tranken unser Bier, während die zarte Londoner Sonne unsere Haut streichelte. Während meiner Haft hatten wir drei außer an wenigen offenen Besuchstagen nicht zusammen sein können. Nach unserem Treffen in London sollte es dann wieder nahezu unmöglich werden, zusammenzukommen.
Wir sprachen an jenem Tag nicht von der unerfreulichen Vergangenheit, von Haft und Trennung, sondern von der Zukunft, von der Lage in der Türkei und der Welt. Vermutlich waren wir aber alle in Gedanken bei anderen unerfreulichen Ereignissen, über die wir nicht reden wollten:
Die Polizei hatte plötzlich die Personenschützer abgezogen, die sie nach dem Attentat auf mich bewilligt hatte.
Meine Zeitung hatte mir ein Schloss vor die Tür gehängt: »Die Drohung ist ernst, wir müssen Maßnahmen treffen.«
Die Bank verkündete, der zuvor bewilligte Hauskredit werde vermutlich storniert werden. Wir saßen auf Schulden.
Von der Staatsanwaltschaft war die Vorladung zu einem neuen Prozess gekommen.
Die regierungsnahe Presse blies wegen Aussagen, die ich nach meiner Freilassung gemacht hatte, inzwischen zum Generalangriff.
Bei der Zeitung war es unterdessen zu einem Missklang gekommen. Mehrere mir sehr nahestehende Kollegen aus dem Hirn der Zeitung hatten gekündigt, obwohl ich gesagt hatte: »Mitten im Kampf schmeißt man nicht hin.«
Ich war erschöpft und bedrückt.
Von dem Gehetze von einer Einladung zur anderen, die nach meiner Haft aus Europa kamen, drehte sich mir der Kopf.
Die Strapazen der Haft waren noch nicht überwunden. Die Probleme stapelten sich.
Ich musste mich ausruhen, mich sammeln, am Strand liegen, Sonne tanken und mit der Lektüre für mein neues Buch beginnen. Möglichst weit entfernt von Telefonklingeln, Krisennachrichten, Drohungen, Ermittlungen, Leibwächtern, Pulverdampfgeruch und Gerüchten in der Zeitung musste ich neue Kräfte sammeln.
Ich bat die Zeitung und meine Frau um anderthalb Monate Urlaub. Am 7. Juli packte ich Bücher und Sommersachen in zwei Koffer und fuhr allein in Urlaub. Unruhig wie ein aus dem Käfig befreiter Vogel stieg ich ins Flugzeug nach Barcelona.
3Flüchtling
7:30 Uhr morgens.
Schreie aus den letzten Reihen im Flugzeug:
Stöhnen, Flehen, kummervolles Gejammer.
Die traurige Stimme einer wehklagenden Frau.
Unablässig wiederholt sie dieselben Wörter. Wir verstehen nicht, was sie sagt, doch ihre Empörung ist offensichtlich groß.
Die Stewardess erklärt den irritierten Reisenden:
»Ein Flüchtling aus Eritrea, sie wird zum dritten Mal abgeschoben, sie wehrt sich …«
Um uns zu beruhigen, fügt sie hinzu:
»Es sind Zivilpolizisten dabei, keine Sorge. Wir sind so was gewohnt.«
Dennoch sind die Passagiere beunruhigt.
Die Klage der Frau aus Eritrea wird vor dem Start immer lauter, Passagiere aus den hinteren Reihen ziehen nach vorne um, flüchten vor der Störung.
Einige setzen Kopfhörer auf, hören Musik oder verlegen sich darauf, nichts zu hören, und schlafen.
Andere schauen besorgt von weitem zu.
Niemand aber kommt ihr zu Hilfe, fragt nach ihren Sorgen, sucht nach einer Lösung.
Schauspiel eines Aufstands, bewacht von zwei Polizisten in Zivil.
Hinter mir höre ich einen Reisenden sagen: »Gut, dass sie die abschieben.«
Ich drehe mich zu ihm um.
Ein Schwarzer.
Vermutlich also jemand, der vor dieser Frau aus Eritrea einen Platz in Europa ergattern konnte. Panisch darum bemüht, seinen Platz nicht zu verlieren, hat er sein Gewissen eingebüßt.
Abgebrüht grinst er mich an:
»Hauptsache, die jagt sich nicht in die Luft …«
Erst als er meine wütenden Blicke sieht, senkt er die bis zu den Ohren hochgezogenen Mundwinkel.
Mit dem Flugzeug steigen auch die Schreie auf, fliegen von den hinteren Reihen in Richtung Cockpit.
Die Frau aus Eritrea schreit, als verbrenne sie bereits in dem Höllenfeuer, in das sie zurückgeschickt wird.