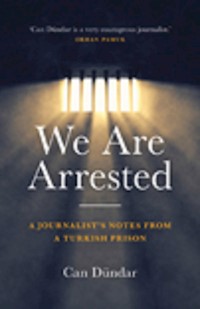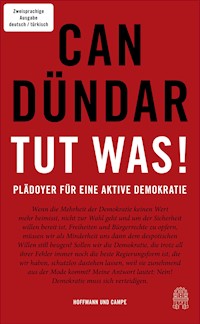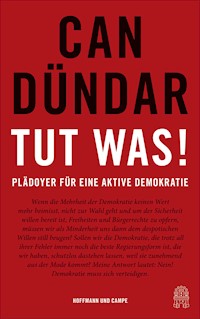19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Can Dündar, in der Türkei als »Terrorist« gesucht und in Abwesenheit zu über 27 Jahren Haft verurteilt, erzählt mit präzisem Blick auf die letzten Jahrzehnte und die Ereignisse um die Schicksalswahl im Mai 2023 vom hundertjährigen Ringen der Türkischen Republik um eine freie Gesellschaft. Kaum ein Jahr ist für diesen wichtigen Partner Europas so existenziell wie dieses! 100 Jahre ist es her, da zerfiel das marode Osmanische Reich und die Türkische Republik wurde gegründet. Diese wollte ein radikal moderner Staat werden: mit Übernahme europäischer Rechtssysteme, europäischem Kalender, lateinischer Schrift, freien Wahlen, Gleichstellung der Geschlechter, Gewaltenteilung und und und – ein Programm, moderner und säkularer als fast überall sonst auf der Welt. Die Brücke nach Europa wurde geschlagen, und die Anstifter dieser Entwicklung waren nicht etwa fortschrittliche Parteien, sondern das Militär. 1952 wurde die Türkei Teil der Nato, aber ausgerechnet die Einführung eines Mehrparteiensystems gab den islamistisch-konservativen Kräften Auftrieb, zwischenzeitlich gab es Putsche, Parteienverbote, Kriegsrecht. Als Erdoğan 2013 Ministerpräsident wurde, wollte er das Land zwar in die EU führen, aber nachdem seine Partei mächtig geworden war, nahm der Staat unter ihm immer autokratischere Züge an. Die Opposition wurde in die Enge getrieben, jedes kritische Denken abgestraft. Erdoğans Regierung intensivierte die Unterdrückung der Kurden, führte Krieg in Syrien und im Irak. Sie änderte die Verfassung, nahm Wirtschaft und Justiz an die Leine, ließ Kritiker und Oppositionsparteien verbieten. Niemand ist vor Verhaftung gefeit, die Vorwände können noch so bizarr sein. Vor und nach der Wahl ist das Land zerrissen wie nie zuvor. Can Dündar erzählt davon, und von einem Jahrhundert dramatischer Ereignisse und des Ringens. Und er gibt einen Ausblick, wie es mit dem Land weitergehen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Can Dündar
Die rissige Brücke über den Bosporus
Ein Jahrhundert Türkische Republik und der Westen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Can Dündar
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Warum? Die äußere Dynamik
Warum? Die innere Dynamik
Die Gründung
Die Reaktion
Der Übergang
Die neue Türkei
Rechts-Links
Wieder ein Putsch
Zwischen zwei Putschen
Der Zwölfte September
Ein Anschlag, ein Tod, ein Unfall
Ein postmoderner Putsch
Krise und Chance
Honeymoon
Ein Mann, eine Partei
Der letzte Schlag
Fazit
Dank
Zeittafel zur Türkischen Republik
Namensregister
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Die Wahlnacht
Am Abend des 28. Mai 2023 versammelte sich in einer geräumigen Wohnung in Berlin-Charlottenburg eine Gruppe Personen aus der Türkei. Journalisten, Wissenschaftler, Musiker, Politiker, allesamt im Exil. Die meisten von uns waren relativ neu in Berlin. Wir hatten unser Land verlassen und waren hergekommen, als gegen uns laufende Verfahren, nicht enden wollende Drohungen, Polizei vor der Tür uns die Luft zum Atmen nahmen. Einige von uns hatten stets einen für die Rückkehr gepackten Koffer bereitstehen, andere hatten sich eingerichtet, als würden sie nie wieder zurückgehen.
An jenem Abend sollte sich entscheiden, ob der Mann, wegen dem wir im Exil waren, wiedergewählt werden würde, also ob der Alptraum andauern würde, und natürlich auch, in welche Richtung sich unser Leben entwickeln würde.
Eine Optimistin unter uns hatte gar ein Flugticket nach Istanbul für den auf diesen Sonntag folgenden Dienstag reserviert. Der Sieg schien sicher, wir würden mit rund 60 Prozent gewinnen und heimkehren. Andere, die in den letzten zwanzig Jahren bereits mehr als eine Wahlniederlage erlebt hatten, saßen in Erwartung einer weiteren in der Ecke und nippten melancholisch an ihren Drinks.
Wir glichen Angeklagten, die vor Gericht auf ihr Urteil warteten. Je nach Wahlausgang würden wir nach einem Ticket für den Rückflug in die Türkei schauen oder nach einer Grabstätte in Berlin, wie es ein befreundeter Journalist ausgedrückt hatte.
Unser 27-jähriger DJ hatte zwei unterschiedliche Playlists für den Abend vorbereitet, die eine mit fetzigen Songs, die unsere Siegeseuphorie begleiten sollten, die andere mit traurigen Stücken, um unserer Wehmut Ausdruck zu verleihen. Je nach Ergebnis würden wir tanzen oder wehklagen.
Jeder hatte etwas zu essen mitgebracht, aber niemand bediente sich am reichhaltigen Büfett in der Ecke. Vorerst beobachteten wir mit Neugier, Sorge und Hoffnung das »Menü«, das uns der Fernsehbildschirm bot, und hofften verhalten optimistisch, dass endlich die seit Jahren erwartete Stunde käme.
Wir waren optimistisch, weil nahezu sämtliche Meinungsumfragen die frohe Botschaft verkündeten, das Repressionsregime ginge zu Ende. Politische Parteien, deren Zusammenkommen zuvor schier undenkbar war, hatten sich unter dem Motto »Schluss mit der Autokratie« zum größten Bündnis der türkischen Geschichte vereint, und während des Wahlkampfes hatten Menschenmassen auf den Kundgebungsplätzen nach Freiheit gerufen.
Verhalten war unser Optimismus, weil dem fulminanten Bündnis ein Parteienstaat gegenüberstand, der Medien und Justiz lenkte und alle öffentlichen Ressourcen nutzte. Würde der »Sultan« den Palast überhaupt widerstandslos räumen, falls die Opposition dennoch gewann? Oder würde er wie Trump oder Bolsonaro seine Anhänger auf die Straße rufen und das Land in Brand setzen?
Auf dem großen Fernsehbildschirm im Wohnzimmer lief ein oppositioneller Sender, den Erdoğan noch nicht verboten hatte. Die Kommentatoren diskutierten vorsichtig und warteten auf die Schließung der Wahllokale. Um 17.00 Uhr Ortszeit war die Wahl zu Ende. Aufgrund der Regeln für den Wahltag wurden noch keine Ergebnisse genannt, doch die Mienen der Moderatoren und die ersten Zahlen, die es bald auf unsere Smartphones hagelte, deuteten auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Aus Parteizentralen und Wahllokalen riefen Freunde mit ersten Teilinformationen an. »Wir liegen vorn«, sagten sie, »wir gewinnen!«
Im Wohnzimmer bei uns sprangen manche bei der ersten positiven Meldung auf, andere versuchten, ihre Freude zu dämpfen. Die Skeptiker waren in der Mehrheit. Wir wussten aus vorangegangenen Wahlen, dass die ersten Nachrichten irreführend sein konnten, ebenso, dass eine knapp ausgehende Wahl offen für Manipulation durch die Regierung war.
Um 19.00 Uhr Ortszeit endete das Sendeverbot, da waren wir alle auf den Beinen und warteten in einer großen Gruppe mit pochenden Herzen wie an einem Spieltisch, wo um unser Leben gewürfelt wurde, darauf, wie die Würfel gefallen sein, welche Zahlen sie zeigen würden.
Die ersten Resultate machten Hoffnung. Der Herausforderer lag mit 52 zu 48 Prozent vorn. Wir hielten den Atem an und den Blick starr auf die Ecke mit den Zahlen auf dem Bildschirm gerichtet. Dabei bemühten wir uns, unsere innere Stimme zu beruhigen, die flehte: »Bitte, lass es so ausgehen!«
Ab 20.00 Uhr fing der Taxameter auf dem Bildschirm an, gegen uns zu laufen. Die Differenz von vier Prozent schrumpfte zusehends zugunsten der Regierung. Erst waren es noch 51 zu 49 Prozent. Um 21.00 Uhr dann Gleichstand 50 zu 50 Prozent.
Da fühlten wir uns wie beim Tauziehen; an beiden Enden unseres in zwei gleich große Teile gespaltenen Landes wurde gezerrt. Auf der einen Seite herrschte tiefste Finsternis, auf der anderen helle Hoffnung. Und wir befanden uns im Zwielicht. Es konnte Morgengrauen daraus werden, aber auch Abenddämmerung. Doch es ging Richtung Nacht. Die Erfahrenen unter uns hatten es sogleich erkannt, schwiegen aber, um uns nicht die Hoffnung zu nehmen.
Gegen 21.30 Uhr hatten Gewinner und Verlierer die Plätze getauscht. Einmal mehr standen wir auf der Seite der Verlierer. Es war, als hätten wir keine Wahl verloren, sondern ein Land.
Da setzten die fünf Phasen der Trauer ein.
Zuerst das Leugnen: Wie kann das sein, es kann nicht sein. Noch sind nicht alle Urnen ausgezählt, das Ergebnis wird sich noch ändern. Zweifellos wurden Stimmen geklaut.
Dann der Zorn: Verdammt! Das Land ist erledigt. Das Volk liebt den Diktator. Er wurde sogar in der Erdbebenregion gewählt.
Schließlich das Verhandeln: Vielleicht erkennt er, dass die Hälfte der Bevölkerung gegen ihn ist, und wird milde. Jetzt macht Europa Druck zur Demokratisierung.
Gegen Mitternacht mutierte der Emotionscocktail zur Depression. Wehmut breitete sich vom Wohnzimmer in die anderen Räume aus, quoll sogar auf den Balkon hinaus. Ununterbrochen meldeten sich unsere Telefone. Einige von uns verloren sich in Grübelei, andere suchte nach Verantwortlichen, manche fluchten.
Meine Mutter, die seit sieben Jahren in Ankara auf mich wartete, weinte am Telefon: »Ich habe deine Lieblingsspeisen gekocht, dein Bett bezogen, was soll denn jetzt werden?« Ich tröstete sie, biss mir dabei auf die Lippen, um nicht die Frage zu stellen: »Werden wir uns jemals wiedersehen?«
Einige verfolgten mit leerem Blick die Kommentatoren auf dem Bildschirm, ein Freund, der jüngst die Diagnose für seine Erkrankung erhalten hatte, rechnete sich aus, ob er die nächsten Wahlen noch erleben würde. Würde Erdoğan sie wohl erleben?
In einem anderen Zimmer warnte jemand seinen Freund, der nicht wieder ins Parlament einziehen würde: »Deine Immunität ist aufgehoben. Geh noch heute Nacht außer Landes, es wird Verhaftungen geben. Womöglich steht eine Polizeirazzia bevor.«
Die befreundete Musikerin hatte ihr Kind zurückgelassen, weil sie nur zu einem Konzert ausgereist war. Sie überlegte, was aus dem Kind werde, falls man sie wegen ein paar Tweets bei der Rückkehr an der Grenze verhaftete.
Der kleine Sohn der Gastgeberin fragte neugierig, als erkundigte er sich nach dem Ausgang eines Fußballspiels: »Haben wir gewonnen, Mama?«
Dann fiel uns ein, dass unsere inhaftierten Freunde in einer kalten Zelle allein vor dem gleichen Bildschirm saßen. Sie hatten sich Hoffnungen gemacht, am nächsten Morgen freizukommen, jäh mussten sie erkannt haben, dass sie bis auf Weiteres in Einzelhaft bleiben würden. Wie sollten sie das ertragen?
Gegen Mitternacht trat Erdoğan auf den Balkon seines Palastes und verkündete seinen Sieg. Auf dem Platz davor eine Menschenmenge, die an die finstersten Zeiten der Geschichte des Despotismus gemahnte. Erdoğan leitete seine Show mit einem Liebeslied ein:
»Ob ihr es hört oder nicht / Ob ihr danach fragt oder nicht, / Ich liebe sie / ich liebe sie sehr«, sang er schief. Dann verkündete er, die, die er liebe, seien seine Anhänger, und unmittelbar nach dem Satz »Wir zürnen niemandem« kündigte er schärfere Repressionen an, wie um alle Lügen zu strafen, die Konzilianz von ihm erwartet hatten. Solange er an der Macht sei, würden seine inhaftierten Kontrahenten das Tageslicht nicht wiedersehen. Während er sprach, rissen Tausende zornig den Mund auf, skandierten: »Todesstrafe! Todesstrafe!«, und forderten den Galgen für die Verräter, die ihr »Führer« ins Visier genommen hatte.
Das in eine Messe der Anbetung verwandelte Mitternachtsmeeting beendete Erdoğan mit dem Gedicht »Gebet«:
»Die auf einen Held wartenden Massen
lass nicht ohne Held, Allah!
Wissen wir uns dem Feind entgegenzustellen,
lass uns nicht ohne Lebenskraft, Allah!«
Im Taumel über den erneuten Sieg des »erwarteten« Helden ging die Menschenmenge auseinander, nun ging es daran, die Verlierer der Nacht zu wecken. Autohupen und Gegröle, dann Schüsse. Mit Gewehren bewaffnete Banden waren unterwegs, schossen wie wild in die Luft, die Polizei schaute vom Rande aus zu.
Im Erdbebengebiet tanzten Anhänger seiner Partei den Kettentanz Halay vor den Trümmern, die erst drei Monate zuvor über fünfzigtausend Menschen verschüttet hatten.
Entsetzt beobachteten wir die Bilder und diskutierten dabei, ob Verzweiflung oder das Stockholm-Syndrom dahintersteckte.
Unser Land brannte, die Massen feierten, stolz darauf, Benzin in das Feuer gegossen zu haben, das sie selbst versengte. Und wir schauten aus der Ferne zu, verzweifelt, weil wir keinen Eimer Wasser reichen konnten, um das Feuer zu löschen, das auch unsere Liebsten verbrannte.
Der Lärm der Demonstrationen in der ganzen Türkei ertönte kurz darauf auch vor unserem Balkon in Berlin. Lärmende Autokorsos mit wehenden Flaggen, die sagen sollten: »Jenes Land gehört euch nicht mehr.« Seit ich in Deutschland bin, sah ich mehr türkische Fahnen als deutsche. Mittlerweile wusste ich, warum es so wenige deutsche und so viele türkische Fahnen gab.
Kurz darauf meldeten die Fernsehsender, der Bundeskanzler habe Erdoğan angerufen, zum Wahlsieg gratuliert und ihn nach Berlin eingeladen. Anders als bei vorangegangenen Gratulationen fehlte diesmal die Formulierung, Deutschland wolle Partner einer demokratischen Türkei sein. Man hielt es offenbar nicht für erwähnenswert, dass die Hälfte der Wählerinnen und Wähler für eine demokratische Türkei und gegen die Autokratie gestimmt hatten, dass 50 Prozent der Bevölkerung sich unter Lebensgefahr für Demokratie einsetzte. Die deutschen Politiker wussten genau, unter welch unfairen Bedingungen die Wahlen abgehalten worden waren, doch in offiziellen Texten schrieben sie das Gegenteil dessen, was sie in persönlichen Gesprächen sagten. Das Land, das uns, die wir gegen die Autokratie kämpften, Zuflucht gewährte, schickte sich an, dem Autokraten, der uns in diese Zuflucht getrieben hatte, den roten Teppich auszurollen.
Als das Hupen nachließ, gingen auch wir auseinander. Der Abend, von dem wir gehofft hatten, er würde lang werden und freudig enden, hatte schnell und traurig ein Ende gefunden. »Wenn wir ein Taxi rufen, ist der Chauffeur sicher ein AKP-Mann und es gibt Streit«, sagte jemand. Gingen wir gemeinsam zu Fuß, würde man uns erkennen und belästigen. Also nahm jeder, der ein Auto hatte, Freunde mit und wir suchten unseren Weg nach Hause durch die AKP-Autokorsos, die lärmend den Sieg feierten, hindurch. Beim Abschied verabredeten wir, genau wie unsere Vorgänger im Exil, im Sommer auf eine griechische Insel zu fahren und von ferne auf unser Land anzustoßen.
Jetzt war die Reihe an der fünften Phase der Trauer: Akzeptieren. Für ungewisse Zeit würden wir weiter im Exil bleiben müssen. Das Wort »haymatlos« war eines der ersten deutschen Wörter, die wir gelernt hatten, an jenem Abend wurde uns erst richtig klar, was es bedeutete. Als wir uns mit der schweren Bürde des Abends in eine Dunkelheit von ungewisser Dauer zurückzogen, klangen uns Samuel Becketts Zeilen im Ohr:
»Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.«
Inhaltsverzeichnis
Warum?
Die äußere Dynamik
Wie konnte Recep Tayyip Erdoğan wiedergewählt werden, nachdem er der Wirtschaft den größten Schaden ihrer Geschichte zugefügt hatte, obwohl er so krank war, dass er kaum noch laufen konnte, und obwohl das halbe Land gegen ihn war?
Die Antwort auf diese Frage hat aktuelle, politische, soziale, wirtschaftliche, historische und diplomatische Aspekte. Betrachten wir zunächst den aktuellen internationalen Aspekt, anschließend beleuchten wir verstärkt die nationalen und historischen Dimensionen.
Zunächst einmal ist der Fakt zu betonen, dass es sich beim Aufstieg von Nationalismus und Populismus um eine globale Epidemie handelt. Ihre Auswirkungen sind in der ganzen Welt zu spüren, von den USA bis Indien, von Israel bis Italien, in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Deutschland. Auch in der Türkei fand sie geeigneten Nährboden. Sie besitzt eine Reihe gemeinsamer Merkmale:
Regionale Reaktionen auf Globalisierung, Multikulturalität und die Traumata, die beide mit sich bringen; Schaffung einer starken Alternative gegen die festgefahrene Politik des Mainstreams und gegen elitäre Politiker; Bildung einer gesellschaftlichen Basis durch Schärfung der Gegensätze »wir« und »sie«; Eintreten für eine defensive, nach innen gerichtete Politik mit aggressiver Rhetorik; Anstacheln des Rufs nach einem starken Führer, indem Ängste genährt werden; Betreiben einer auf Polemik beruhenden Politik, die sich auf einer ausländer- und flüchtlingsfeindlichen, antielitären, homophoben Linie bewegt. Beim Populismus türkischer Spielart kommt noch eine streng islamistische Ausrichtung durch religiöse Erziehung hinzu, die sich parallel zum Zusammenbruch des laizistischen Bildungssystems breitmacht, sowie die damit ansteigende Aversion gegen den Westen und das Christentum.
Erdoğan vereinte sämtliche Eigenschaften dieses giftigen politischen Cocktails in seiner Person und wurde damit zu einem Symbol des aufstrebenden Populismus. Er machte sich zu einem einflussreichen Akteur der Weltpolitik, indem er seine Meisterschaft nutzte, Krisen in Chancen zu verwandeln. Und etliche Spitzenpolitiker im Westen arbeiteten aus eigenen Interessen dem Erfolg dieses Akteurs freiwillig in die Hände.
Sie werden sich an das Foto von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem vergoldeten Sessel im Palast von Staatspräsident Erdoğan erinnern. Es wurde im Oktober 2015 aufgenommen. Vier Monate vor ihrem damaligen Türkei-Besuch hatte Erdoğans AKP bei den Juni-Wahlen erstmals die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Jäh setzten Anschläge, Bombardierungen, Morde ein und verwandelten das Land in ein Meer aus Blut. Die Bevölkerung war entsetzt.
In jenen Tagen des Entsetzens fiel ein Detail auf: Die Veröffentlichung des jährlichen EU-Fortschrittsberichts zum Beitritt der Türkei war mehrfach verschoben worden. Neun Tage nach der Neuwahl wurde er dann publiziert und beinhaltete harsche Kritik an Erdoğans Regime.
In ebendieser kritischen Phase reiste Kanzlerin Merkel in die Türkei und bot Erdoğan zehn Tage vor der Wahl den rettenden »Lebenskuss«. Der Kanzlerin ging es darum, den Ansturm von Flüchtlingen in der Türkei aufzuhalten, bevor er Europa erreichte. Das Fundament des berühmten Flüchtlingsabkommens wurde bei diesem Treffen gelegt. Wir wissen zwar nicht, was auf den vergoldeten Sesseln besprochen wurde, haben aber konkrete Kenntnis von den Verhandlungen mit EU-Vertretern hinter verschlossenen Türen. Dabei zeigt sich deutlich, wie Erdoğan Erpressung als diplomatisches Instrument einsetzte und den Westen mit Einschüchterung in die Tasche steckte:
16. November 2015. Zwei Wochen nach seinem Wahlsieg traf Erdoğan den damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und den damaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in Antalya. Die griechische Website Euro2day.gr bekam die Protokolle des Dreiergipfels in die Hand und veröffentlichte sie. Die nicht dementierten Unterlagen beinhalten sämtliche schmutzigen Geheimnisse des Türkei-EU-Deals.
Auf der Tagesordnung des Gipfels stand die Verhandlung über die Flüchtlinge. Als Gegenleistung dafür, die Flüchtlinge nicht nach Europa durchzulassen, versprach die EU der türkischen Regierung Geld und den Bürgern der Türkei Freizügigkeit. Allerdings war man sich über die Summe uneins. Zur Eröffnung sagte Tusk zu Erdoğan: »Wir haben uns auf drei Milliarden Euro in zwei Jahren verständigt. Aber Sie fordern drei Milliarden pro Jahr.« Erdoğan reagierte barsch:
»Wenn Sie drei Milliarden für zwei Jahre zahlen, brauchen wir gar nicht zu reden. Wir brauchen das Geld der EU nicht. Wir öffnen die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien und setzen die Flüchtlinge in Busse. Das werden zehn- bis fünfzehntausend. Wie wollen Sie damit fertigwerden? Wie wollen Sie die Flüchtlinge aufhalten, wenn das Abkommen nicht zustande kommt? Wollen Sie sie umbringen? Das sind ungebildete Leute, sie werden in Europa weiter als Terroristen agieren.«
Und was tat Juncker angesichts dieser Drohung, die die in die Türkei geflüchteten Menschen zum Faustpfand machte? Er enthüllte, warum der EU-Bericht verschoben worden war. Lesen wir die Protokolle:
Juncker: »Ich erinnere daran, dass wir den Fortschrittsbericht auf nach den Wahlen in der Türkei verschoben. Wir wurden dafür kritisiert.«
Erdoğan: »Das Verschieben hat dem Wahlsieg der AKP nicht gedient. Der Bericht ist ohnehin eine Beleidigung. Wie können Sie solche Dinge schreiben?«
Juncker: »Wir haben den Bericht verschoben, weil Sie es wollten. Wir dachten, Sie wollen sich mit Europa verständigen. Jetzt fühle ich mich betrogen.«
So stand es also um das »betrogene« Europa gegenüber Erdoğan: Man hatte den Bericht, der schwere Menschenrechtsverletzungen in der Türkei aufführte, auf Erdoğans Verlangen hin auf nach den Wahlen verschoben, und doch hatte es nichts genützt.
Mit dem Trumpf Flüchtlinge in der Hand ging die neue Regierung zu noch massiveren Angriffen auf Pressefreiheit und Menschenrechte über. Genau zehn Tage nach dem Tusk-Juncker-Erdoğan-Gipfel wurde ich von der Staatsanwaltschaft vorgeladen und verhaftet – wegen meines Berichts, der belegte, dass Erdoğan über seinen Geheimdienst die Dschihadisten in Syrien mit Waffen belieferte. Der Staatsanwalt sagte nicht, der Bericht sei falsch, vielmehr erklärte er, er hätte nicht veröffentlicht werden dürfen, weil es sich um ein Staatsgeheimnis handelte. Wie hätte ich das wissen sollen? War es nicht meine Pflicht als Journalist und dazu im öffentlichen Interesse, das Volk zu unterrichten, wenn der Staat in einer geheimen, illegalen Operation die Dschihadisten in Syrien aufrüstete?
Meine Argumente wurden als unwirksam betrachtet, am Donnerstag, den 26. November 2016, kam ich ins Gefängnis. Für Sonntag, den 29. November, stand ein Treffen der EU-Staatschefs mit dem türkischen Premier in Brüssel an. Ich beschloss, allen EU-Gipfelteilnehmern einen Brief zu schreiben. Auf dem Notizzettel eines Abgeordneten, der mich am Freitag im Gefängnis besuchte, notierte ich handschriftlich:
»Wir schreiben Ihnen aus der Haftanstalt Silivri als Journalisten, die davon überzeugt sind, dass die Türkei zur europäischen Familie gehört, und an das Ziel der Vollmitgliedschaft glauben. Die Freiheit der Meinung und der Rede ist ein unverzichtbarer Wert der Zivilisation, der wir angehören. Wir sind angeklagt und inhaftiert, weil wir Gebrauch von dieser Freiheit machten und für das Recht der Öffentlichkeit auf Information eintraten. Der türkische Premierminister, den Sie an diesem Wochenende treffen, und das Regime, das er repräsentiert, sind für ihre Menschenrechte und Pressefreiheit missachtende Politik und Praktiken bekannt. Wegen der Flüchtlingskrise, die unser aller Herz rührt, verhandeln Ihre Regierungen mit der Regierung in Ankara. Wir wünschen aufrichtig, dass bei Ihrem Treffen eine dauerhafte Lösung für das Problem gefunden wird. Wir möchten hoffen, dass Ihr Wunsch nach Lösung Ihrer Sensibilität in Sachen Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit, die zu den Grundwerten der westlichen Welt gehören, nicht im Weg stehen wird. Wir erinnern daran, dass unsere gemeinsamen Werte nur durch gemeinsames Handeln und Solidarität bewahrt werden können, und möchten zum Ausdruck bringen, wie wichtig und dringend geboten diese Solidarität ist.«
Dieser Brief gelangte in der Innentasche des Jacketts eines Abgeordneten aus dem Gefängnis hinaus und wurde noch am selben Tag an die Büros der EU-Staatschef gesandt, allen voran an Kanzlerin Merkel. Am Sonntag verfolgte ich in meiner Einzelzelle live die Übertragung der zum Gipfel in Brüssel angereisten Staatschefs. Ich hörte den italienischen Premier Renzi sagen: »Ich habe einen Brief von einem Journalisten in der Tasche, der in der Türkei inhaftiert ist.« Die Nachricht war also angekommen.
Europa war aber nicht gewillt, sich mit der Unterdrückung der Pressefreiheit in der Türkei und den dort inhaftierten Journalisten zu beschäftigen, es ging ja um ein weit wichtigeres Thema. In der nach dem Gipfel veröffentlichten gemeinsamen Erklärung war lediglich von der Verhinderung des Weiterzugs der Flüchtlinge, der Bekämpfung des Terrorismus und der gemeinsamen Sicherheitspolitik die Rede. Es hieß, der Beitrittsprozess der Türkei zur EU sollte wiederaufgenommen werden, türkischen Staatsbürgern wurde – unter der Bedingung, dass die Kriterien erfüllt wären – versprochen, ab Juni 2016 ohne Visum nach Europa reisen zu können. Unhaltbare Versprechen alle beide. Mit dem im hinausgezögerten Bericht aufgeführten Sündenregister war die Wiederaufnahme des EU-Beitrittsprozesses der Türkei unmöglich. Das wussten beide Seiten genau. Doch Erdoğan, der sich bereiterklärte, Millionen in die Türkei Flüchtende aufzunehmen, brauchte angesichts der schweren Last, die er der Gesellschaft aufbürdete, einen Trumpf, der ihn so dastehen ließ, als hätte er einen Vorteil herausgeschlagen. Dieser Trumpf war das falsche Versprechen der Freizügigkeit. Acht Jahre nach dem Abkommen kam der EU-Beitrittsprozess komplett zum Erliegen. Und das EU-Versprechen auf Freizügigkeit war längst vergessen. Im Gegenteil, nach der Wahl wurde die Bearbeitung von Visa sogar gestoppt. Brüssel hielt seine Versprechen nicht und die Türkei stand mit den schweren politischen, ökonomischen und sozialen Problemen infolge des Zustroms von über vier Millionen Geflüchteten sowie der zusehends steigenden Fremdenfeindlichkeit allein da.
Ein weiteres Beispiel für Erdoğans Talent, Krisen in Chancen zu verwandeln, das ich persönlich miterlebt habe:
Sieben Jahre nach der »Flüchtlingskrise«, wieder im Vorfeld einer Wahl und wieder in einer Phase, als die AKP im Sinkflug war, kam Erdoğan eine andere Krise zu Hilfe. Diesmal befand er sich in der Rolle des Vermittlers im Ukraine-Krieg. Mit Selenskij stand er ohnehin in Verbindung. Dass er gleichzeitig mit Putin kooperierte, bot ihm plötzlich ein diplomatisches Manövrierfeld.
Aus reinem Zufall hatte ich vor Kriegsausbruch Kontakt zu einer Nachrichtenquelle von enormer Bedeutung in der Ukraine. Für den Bericht über die Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes nach Syrien, der zu meiner Verhaftung geführt hatte, hatte ich den wichtigsten Zeugen aufgespürt. Nuri Gökhan Bozkır war der Waffenhändler, der für den türkischen Geheimdienst die nach Syrien gelieferten Rüstungsgüter beschafft hatte. Als ihm in der Türkei ein Mord zur Last gelegt wurde, flüchtete er in die Ukraine. Er war bereit zu erzählen, wie er die Waffen beschafft und an wen er sie wie geliefert hatte. In der Furcht, ihre schmutzigen Geheimnisse kämen ans Licht, hatte die türkische Regierung von der Ukraine Bozkırs Auslieferung gefordert, um sein Geständnis zu verhindern, doch das Gericht lehnte das Ersuchen aus Mangel an glaubhaften Beweisen mehrfach ab.
Als Russland im Herbst 2021 begann, an der ukrainischen Grenze verstärkt Militär zu stationieren, änderte sich die Sache. Selenskij wollte zwecks Verteidigung ein drohnenbasiertes Abwehrsystem von der Türkei erwerben. Anfang Dezember schrieb Bloomberg, die Türkei habe der Ukraine eine beträchtliche Anzahl Drohnen verkauft. Ein paar Wochen später verkündete Erdoğan, Nuri Gökhan Bozkır sei »in einer Geheimdienstoperation« in die Türkei gebracht worden. Das war aber keine solche Operation, sondern eine Auslieferung als Verhandlungsergebnis. Bozkır wurde mit schwerer Folter gedroht, damit war der Zeuge des großen Geheimnisses zum Schweigen gebracht.
Die Ukraine-Krise bot Erdoğan auch die Chance, den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands für Verhandlungen zu nutzen. Als beide Länder aus Angst vor Russland schleunigst der Allianz beitreten wollten, spielte Erdoğan die Veto-Karte aus. Für die Zustimmung der Türkei machte er die Auslieferung von 120 Dissidenten zur Bedingung, die in den beiden Ländern Asyl erhalten hatten. Bei einer Person auf der Liste handelte es sich um eine ehemalige Abgeordnete des schwedischen Parlaments. Nun steckte Schweden in der Klemme zwischen der Achtung der Menschenrechte und seinem dringenden Sicherheitsbedürfnis. Putin beobachtete vergnügt, wie Erdoğan zeigte, dass er, wenn er wollte, die NATO blockieren konnte. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson reiste zu Erdoğan in die Türkei, um die Krise zu lösen, und versprach, man werde alle der Türkei gemachten Zusagen einhalten. Schließlich nahm Stockholm auf Druck Ankaras eine Verfassungsänderung vor, die die Einschränkung der Versammlungsfreiheit von Vereinigungen ermöglichte, die etwas mit Terrorismus zu tun haben. Das reichte Erdoğan aber noch nicht. »Die kennen die Türkei nicht. Die nehmen uns auf den Arm«, murrte er.
Diese beiden Beispiele sollen zeigen, wie der Westen gegenüber Erdoğans Erpressungen einknickte. Der türkische Präsident nutzte während des Wahlkampfs sein Image eines Staatschefs, der dem Westen Paroli bietet, ihn nach seiner Pfeife tanzen lässt und die Premiers herbeizitieren kann, und wandelte es in Stimmen um.
Folgende Worte von Erdoğans ultranationalistischem Verbündeten Devlet Bahçeli auf einer Wahlkampfkundgebung zeigen deutlich die in der Regierung herrschende Stimmung:
»Kinder Amerikas, Hans, Sam … Kinder Deutschlands, Tonis und Connys, Franks und Henrys, ich wende mich an euch alle: Was ihr auch sagt, wir lassen nicht zu, dass ihr den Helden Anatoliens Recep Tayyip Erdoğan niedermacht.«
Dabei ist, wie ich an den Beispielen verdeutlicht habe, das Streben des Westens keineswegs darauf gerichtet, Erdoğan niederzumachen, sondern vielmehr darauf, ihn an der Macht zu halten. Der britische Telegraph titelte nach der Wahl, als es in Ankara Gratulationsanrufe aus den europäischen Hauptstädten hagelte, denn auch mit: »Europe breathes sigh of relief as Erdoğan remains in power in Turkey« [Aufatmen in Europa, weil Erdoğan in der Türkei an der Macht bleibt]. In dem Artikel hieß es u.a. wie folgt:
»Herr Erdoğan hat den Beitritt der Türkei zur EU längst aufgegeben. (…) Das passt Brüssel und den Mitgliedsstaaten gut. (…) Vielleicht ist es unmöglich, Herrn Erdoğan zu mögen. Aber er hat sich sehr nützlich gemacht.«
Seit ich in Deutschland bin, wurde mir immer wieder eine Frage gestellt: »Warum unterstützen Migranten aus der Türkei, die hier in einem demokratischen Land wie Deutschland leben und von seinen Vorteilen profitieren, in der Türkei die Autokratie?«
Selbst noch auf der Suche nach den Gründen dafür reagiere ich meist mit einer Gegenfrage:
»Vielleicht lautet die Frage, die wir eigentlich stellen sollten: Warum unterstützen demokratische Länder wie Deutschland in der Türkei einen Autokraten?«
Vielleicht weil er sehr »nützlich« ist?
Schauen wir uns nun die inneren Dynamiken an, die Erdoğan zum Wahlsieg führten:
Inhaltsverzeichnis
Warum?
Die innere Dynamik
Die Politik der Türkei der letzten zwanzig Jahre erinnert an die letzten zehn Jahre Fußballliga in Deutschland: Viele Mannschaften spielen, es gewinnt aber immer dieselbe.
In den einundzwanzig Jahren seit seinem Regierungsantritt gewann Recep Tayyip Erdoğan sieben Parlamentswahlen, vier Kommunalwahlen, drei Referenden und drei Präsidentschaftswahlen. Er regiert die Türkei inzwischen sogar länger als Staatsgründer Atatürk. Die globale Dimension dieses Erfolgs haben wir beleuchtet, doch es gibt natürlich auch persönliche, historische, soziale, politische und ökonomische Gründe dafür.
An die Spitze der inneren Dynamiken müssen wir den Begriff »Parteienstaat« stellen. Bedienen wir uns erneut der Fußballmetapher: Die AKP kaufte den Schiedsrichter, dann lief sie auf und foulte die besten Spieler der gegnerischen Mannschaft und fesselte ihren Torwart am Pfosten.
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Vorsitzende der HDP, der zweitgrößten Partei im Parlament, einer der stärksten Kontrahenten Erdoğans, und die zweite Ko-Vorsitzende Figen Yüksekdağ sind seit sieben Jahren inhaftiert. Der wichtigste Herausforderer im Rennen um die Präsidentschaft, Ekrem İmamoğlu, wurde unmittelbar vor Verkündung der Kandidaten mit einem drohenden Verfahren ausgebootet, das ihm ein Politikverbot einbringen kann. Auf diese Weise hatte Erdoğan zum Zeitpunkt der Ankündigung seiner eigenen Kandidatur auch bestimmt, wer gegen ihn antreten konnte.
Am Beispiel Türkei wird deutlich, wie leicht es für eine Regierung wird, Wahlen zu gewinnen, wenn sie die Justiz kontrolliert.
Die Aushebelung der Unabhängigkeit der Justiz war einer der Wendepunkte der AKP-Regierung. 2010 heckte Erdoğan einen raffinierten Plan aus. Die für ihre Sensibilität in Sachen Laizismus bekannte republikanische Justiz, vor allem die obersten Gerichte, stellte ein Hindernis für seine Souveränität dar. 2008 war ein Verbotsverfahren gegen die AKP eingeleitet worden, 71 führende Kader einschließlich Erdoğan sollten mit Politikverbot belegt werden. Der Vorwurf lautete, die Partei sei zum Hort von Aktivitäten geworden, die mit dem Laizismus unvereinbar seien. Von elf Richtern votierten schließlich sechs für das Verbot, fünf dagegen. Da die nötige qualifizierte Mehrheit nicht erreicht war, wurde die Partei nicht verboten, ihr wurde lediglich die Hälfte der Unterstützung aus der Staatskasse gestrichen.
Erdoğan war klar, dass er keine absolute Herrschaft errichten konnte, solange er das Rechtswesen nicht in der Hand hatte. Er beschloss, mit aller Kraft gegen die Justiz vorzugehen. Zwei Jahre nach dem Verbotsverfahren legte er einen Entwurf für eine umfassende Verfassungsreform vor. Die Anzahl der Richter am Verfassungsgericht, das das Verbotsverfahren gegen seine Partei angestrengt hatte, sollte erhöht werden, Parteienverbote sollten erschwert, der Zuständigkeitsbereich von Militärgerichten eingeschränkt, wichtiger noch, mit der Umstrukturierung des Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte, der für die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten zuständig ist, dafür gesorgt werden, dass die Regierung die Kontrolle über die Justiz in die Hand bekam. Das Raffinierte an dem Plan war, dass sich unter den Paragraphen, über die per Referendum entschieden werden sollte, auch einer befand, der die Verfassungsbestimmung außer Kraft setzte, die verhindert hatte, dass die Verantwortlichen für den Militärputsch vom 12. September 1980 vor Gericht gestellt wurden. Damit erweckte Erdoğan den Eindruck, einen demokratischen Schritt in Richtung Befreiung des Landes vom Kuratel des Militärs gesetzt zu haben, dahinter aber verbarg er seine eigentliche Absicht. Er wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: sich der Vormundschaft des Militärs entziehen, die ihm das größte Hindernis für seine Pläne zu sein schien, sowie die Barriere der laizistischen Justiz überwinden. Die Liberalen in der Türkei wie auch der Westen unterstützten begeistert den »Demokratisierungsschub«, der erklärtermaßen durchgeführt wurde, um den »Panzer der Immunität der Putschisten« abzuschaffen und erneute Coups zu verhindern. Nötig war dafür ein Volksentscheid. Die Verfassungsänderung wurde ausgerechnet am 12. September, dem Jahrestag des Putsches, zur Abstimmung gestellt und mit 58 Prozent angenommen.
Das Europäische Parlament gratulierte unverzüglich. Die Türkei-Berichterstatterin des Parlaments, Ria Oomen-Ruijten, stufte das Referendum als »ersten Schritt der Türkei zur Demokratisierung« ein. Jene, die wie wir gegen das Referendum protestierten, weil es eine Falle sei, und mit Nein stimmten, kritisierte sie mit den Worten: »Sie verpassen die Chance zur Demokratisierung.«
Zwei Jahre nach dem Volksentscheid, als die beiden letzten noch lebenden Mitglieder der Militärjunta zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, waren auch diese dann aber bereits verstorben, die Richter aber kuschten mittlerweile vor Erdoğan.
Nach Legislative und Exekutive hatte er nun auch die Judikative in der Hand. Kaum hatte er unter dem Vorwand, Verbote abzuschaffen, die Justiz unter seine Fuchtel gebracht, beeilte er sich, mittels Justiz seine Gegner mit Verboten zu überziehen. Es hagelte Beleidigungsverfahren gegen Kritiker des Präsidenten. Binnen kürzester Frist wurde wegen Beleidigung gegen 200000 Personen ermittelt, 5000 kamen hinter Gitter. Mit Hilfe der Justiz wurde Erdoğan eine Art Immunität gesichert, während bestraft wurde, wer das zu durchbrechen versuchte.
Ein kleines Beispiel: Stunden, bevor ich vor dem Richter stand, las ich in der regierungstreuen Presse, dass Haftbefehl gegen mich ergehen würde. Die Urteile wurden nun im Palast gefällt, Staatsanwälte und Richter führten sie aus. Als Europa seinen Fehler einsah, war es zu spät. Erdoğan setzte nicht einmal die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte um, und als der Europarat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei einleitete, lachte er nur.
Nicht von ungefähr setze ich die Justiz an die Spitze der Binnendynamiken, die Erdoğan den Sieg brachten, bei den jüngsten Wahlen handelten Richter in jedem Stadium wie Parteileute, sei es, dass sie seine Kontrahenten inhaftierten oder mit Politikverbot bedrohten, sei es, dass sie Kundgebungen verboten oder Beschwerden wegen Wahlbetrug nicht annahmen. Ergänzen wir die »Regierungsjustiz« noch um Parteikader, Gouverneure, Landräte, Polizeichefs, Kommandanten, Imame und Rektoren, wird verständlich, dass die Opposition letztlich zu einer unmöglich zu gewinnenden Wahl gegen den Staat antrat.
Addieren wir auch die Medien zu der Liste hinzu. Neben Legislative, Exekutive und Judikative arbeitete bei den jüngsten Wahlen auch »die vierte Gewalt« mit voller Kraft für Erdoğan. Das staatliche Fernsehen TRT räumte Erdoğan im Wahlkampf 48 Stunden Sendezeit ein, dem Kandidaten der Opposition Kılıçdaroğlu aber nur 32 Minuten. Ebenso war die große Mehrheit der Privatsender für die Regierung im Einsatz.
Auch zuvor waren die Medien in der Türkei nicht frei gewesen, oppositionelle Medien bekamen zu allen Zeiten Druck von der Regierung zu spüren. Erdoğan beschritt aber einen anderen Weg als seine Vorgänger: Statt sich mit Zensur abzugeben, kaufte er die Presse. Loyale Unternehmer nötigte er als Gegenleistung für Vorteile bei großen öffentlichen Ausschreibungen, die größten Zeitungen und Fernsehkanäle der Türkei zu übernehmen, und wurde auf diese Weise zum »neuen Medienzar«. Inzwischen unterstanden ihm 90 Prozent der Medien. Unversehens war eine Propagandamaschinerie entstanden, die sich aus ein und derselben Nachrichtenquelle speiste, die gleichen Schlagzeilen und Fotos brachte und hinter der Regierung stand, auf Oppositionelle aber einprügelte. Im Wahlkampf diente diese Maschinerie Erdoğan und überzog die Opposition mit Lügen.
Ein Beispiel dafür, wie die Intervention in die Medien funktionierte:
2014. Ein Nachrichtensender überträgt live die Rede eines Oppositionsführers in seiner Parlamentsfraktion. Erdoğan sitzt vor dem Bildschirm, ärgert sich und ruft den Zuständigen beim Sender an. Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurde das Telefonat abgehört und gelangte in die sozialen Medien. Hier ist der Dialog:
»Fatih, siehst du gerade die Presseerklärung?«
»Ich bin zu Hause, mein Herr.«
»Ihr wisst ja nicht, was ihr tut, Mann! Der Mann verliest da ein Manifest, als wäre die Türkei erledigt, am Ende, total verloren, und ihr sendet das live!«
»Ich lass das sofort abbrechen, mein Herr.«
»Was ist das denn für eine Sache, Mann! Hat auch nicht gerade angefangen, das läuft schon seit 25 Minuten.«
»Ich sage sofort Bescheid, mein Herr, alles klar.«
»Das geht doch nicht, Mann! Was für eine Schmach. Der Mann beschimpft uns von Anfang an.«
»Die Erklärungen von Parteien mit Fraktionen im Parlament sollten doch gesendet werden …«
»Auf keinen Fall! Müsst ihr denn so was bringen?«
»Verstanden. Ich lass das sofort abbrechen, mein Herr. Entschuldigen Sie.«
Es geht noch weiter:
Nach dem Telefonat ruft der Leiter des Senders den Nachrichtenchef an:
»›Jemand hat angerufen und gesagt, dass er sich grämt. Bring das bitte nicht, okay?«
Anschließend ruft er Erdoğans Sohn an und versucht sich zu entschuldigen:
»Mein Boss hat angerufen, er hat die Rede bei uns erwischt, ich hab sofort abbrechen lassen. Hauptsache, er grämt sich nicht … Wenn er sich grämt, bin ich auch traurig. Vergib mir. Tut mir wirklich leid …«
So stand es im Wahlkampf um die regierungsnahen Medien, die als »Poolmedien« bezeichnet werden, weil sie von dem Geld gekauft wurden, das loyale Unternehmer zu einer Art Pool zusammengetragen hatten. Diese Kanäle machen 90 Prozent der Mainstreammedien aus. Die wenigen oppositionellen Sender außerhalb des Pools wurden mit Geldbußen abgeschreckt. Die staatliche Regulierungsbehörde für Radio und Fernsehen, deren Aufgabe es ist, die Sendungen zu kontrollieren, und die auch ihrerseits dem Befehl der Regierung untersteht, sanktionierte allein im Jahr 2022 fünf um neutrale Berichterstattung bemühte Sender 54 Mal mit harten Strafen und verhängte auch immer wieder Verbote.
Die Haftanstalt Silivri, in der auch ich eine Zeitlang einsaß, wurde zum größten Journalistengefängnis der Welt. Unter Journalisten ist ein beliebter Scherz, sich vor einen Reporter, der gerade einen Bericht schreibt, zu stellen und zu sagen: »Es ist ziemlich kalt in Silivri.« Berichterstatter, die fürchten müssen, morgens von Polizei aus dem Haus geholt und ins Gefängnis gebracht zu werden, sind gezwungen, jedes Wort, das sie