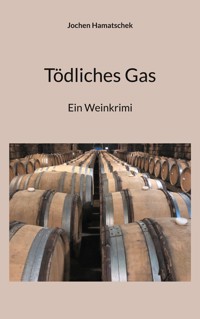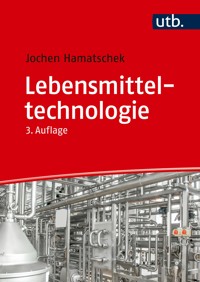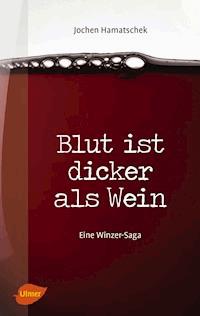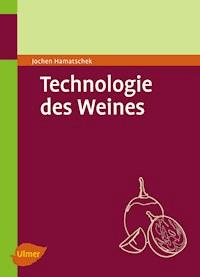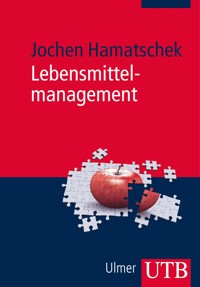
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Aktuelle Herausforderungen im Management souverän meistern: Praxiswissen auf dem Weg zur Führungskraft in der Lebensmittelwirtschaft! Managementwissen praxisnah als Synthese aus betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, Fachwissen und Wissen um den Markt samt all seinen Teilnehmern. Das Biotop, in dem ein Manager arbeitet, umfasst den Markt mit allen Zulieferern und Wettbewerbern, die eigene Firma mit ihren Mitarbeitern und Anteilseignern sowie die Gesellschaft mit ihren sozialen, kulturellen und ethischen Ansprüchen. Dem Thema Ethik und der Einhaltung aller Regeln wird angesichts der sich rasant verändernden Verbrauchererwartungen viel Raum gegeben. Dieses Lehrbuch stellt Management unter den Überbau eines philosophischen Gedankengebäudes und wendet sich an zukünftige Führungskräfte insbesondere in der Lebensmittelwirtschaft. Das Unternehmen und seine Menschen werden im Licht der Evolution gesehen. Es thematisiert damit ein neues, vielfach noch ungewohntes Denken. Manager zu sein heißt, Unternehmensziele strukturiert mit Hilfe von drei Aktivitäten anzugehen: planen, messen und korrigieren. • Planen setzt einen Ausgangspunkt und ein davon abgeleitetes Ziel zum Abschluss einer Periode voraus. • Management ersetzt Bauchgefühl und Zufall durch exaktes Messen aller wichtigen Größen. • Managen heißt im Falle von Planabweichungen kontinuierliches Korrigieren durch aktives Eingreifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Hamatschek
Lebensmittelmanagement
Ulmer E-Books
Inhaltsverzeichnis
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag • Wien • Köln • Weimar
Verlag Barbara Budrich • Opladen • Farmington Hills
facultas.wuv • Wien
Wilhelm Fink • München
A. Francke Verlag • Tübingen und Basel
Haupt Verlag • Bern • Stuttgart • Wien
Julius Klinkhardt Verlagsbuchhandlung • Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck • Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft • Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag • München • Basel
Ferdinand Schöningh • Paderborn • München • Wien • Zürich
Eugen Ulmer Verlag • Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft • Konstanz, mit UVK/Lucius • München
Vandenhoeck & Ruprecht • Göttingen • Oakville
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Dr. Jochen Hamatschek, Jahrgang 1954, Studium der Lebensmitteltechnologie in Stuttgart-Hohenheim, Promotion u. a. an der LVWO Weinsberg, war acht Jahre als regionaler Vertriebsleiter für ein deutsches Maschinen- und Anlagenbauunternehmen tätig. 1990 – 1992 Professur für Kellerwirtschaft an der Forschungsanstalt Geisenheim. Danach Manager und Geschäftsführer mit weltweiter Verantwortung für Technologie und Vertrieb/Schwerpunkt Zulieferung an die Lebensmittelindustrie im früheren Unternehmen.
Impressum
Die in diesem Buch enthaltenen Empfehlungen und Angaben sind vom Autor mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft worden. Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann aber nicht gegeben werden. Autor und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und Unfälle.
ISBN 978-3-8252-4005-9 (Print)
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2013 Eugen Ulmer KG
Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart (Hohenheim)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ulmer.de
ISBN 978-3-8463-4005-9 (E-Book)
Vorwort
Das vorliegende Arbeitsbuch ist ein Produkt der beruflichen Praxis und entstand aus der Ausarbeitung einer Vorlesung im Abschlusssemester des im Jahr 2008 an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gestarteten Studiengangs Lebensmittelmanagement. Es ist übergreifend angelegt und wendet sich vorrangig an Studierende der Fachrichtungen Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelwirtschaft und Lebensmittelmanagement sowie der Nachbarfächer (z. B. Ökotrophologie, Lebensmittelchemie oder Life Science) mit speziellen Vertiefungsrichtungen.
Weiterhin begleitet das Lehrwerk sowohl Jungakademiker der Lebensmittelwirtschaft als auch Fachkräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung, die aus der Position eines Spezialisten ins Management wechseln. Dort zeigt sich schnell, dass sie eher als Generalist gefragt sind und möglicherweise Teile ihrer fachlichen Tiefe einbüßen. So rückt das spezifische Fachwissen eines Technologen oder Chemikers zugunsten von methodischen und fachübergreifenden Kenntnissen in den Hintergrund. Zusätzlich werden mit dem Aufstieg im Management die Anforderungen vielfältiger. Dieses Lehrbuch will daher einige wichtige Aspekte dieser Führungsansprüche – zugeschnitten auf die Besonderheiten der Lebensmittelwirtschaft – praxisorientiert und im Gesamtzusammenhang darstellen. Der Leser soll verstehen, was „Management“ ausmacht und die Bandbreite der Aufgaben, die über das klassische Programm der Betriebswirtschaft oder des Marketings hinausgehen, kennenlernen.
Zu den Schwerpunkten des Studienbuchs gehört neben grundlegendem Management-Know-how (z. B. Einkauf, Vertrieb, Innovationen, Projektmanagement) auch die deutsche Lebensmittelwirtschaft in ihrer Gesamtheit und in ihrer Rolle als zukünftiger Arbeitgeber. Weiterhin rückt der Mensch in den Mittelpunkt, dessen Reaktionen und Marktverhalten ein Produkt seiner evolutionären Entwicklung sind. Als spezieller Aspekt wird zudem der gesamte ethische Überbau als Leitfaden für Entscheidungen und als Maxime des eigenen Handelns mit der Absicherung des Unternehmens gegen Risiken aller Art verknüpft.
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich ein Studienbuch dieser Art im Umfang beschränken und in vielen Bereichen an der Oberfläche bleiben muss. Die Kapitel dieses Werks folgen daher einer kompakten Darstellung, sie werden durch zahlreiche anschauliche Abbildungen sowie aussagekräftiges Zahlenmaterial in Form von Tabellen ergänzt. Fett hervorgehobene Begriffe im Lauftext helfen bei der thematischen Orientierung innerhalb der Absätze und separat gekennzeichnete Merksätze sichern Definitionen und wichtige Ergebnisse. Für eine Vertiefung des Stoffes finden sich am Ende der Kapitel die verwendeten Literatur- und Internetquellen sowie hilfreiche Links zu den angesprochenen Organisationen und Firmen. Der abschließende Serviceteil umfasst das Abkürzungsverzeichnis sowie ein umfangreiches Register zum gezielten Nachschlagen von Stichworten und Fachbegriffen.
Danken möchte ich all den Studierenden, die die Vorlesung kritisch begleitet haben. Konstruktive Kritik ist die Voraussetzung, um besser werden zu können. Zwei weiteren Weggefährten bin ich zu Dank verpflichtet: Georg Schmidt als Wanderer zwischen den Kontinenten, der schon überall auf der Welt Jahresabschlüsse erstellt hat und Ingolf Ziegenhorn, der sich sowohl im sozialistischen als auch im kapitalistischen Management bewähren musste. Diese beiden Kollegen waren es, die mit ihren Korrekturen und Anmerkungen immer wieder für meine „Erdung“ gesorgt haben.
Ich wünsche allen Nutzern dieses Lehrwerks, dass sie ihr Wissen festigen, erweitern und in der Praxis umsetzen können.
Landau/Pfalz, im April 2013
Jochen Hamatschek
Anmerkung zur Schreibweise der weiblichen und männlichen Form: Ausschließlich aufgrund der deutlich besseren Lesbarkeit wird in diesem Werk auf die jeweilige Doppelnennung oder Anpassung der Schreibweise bestimmter Bezeichnungen verzichtet. So stehen u. a. Fachvertreter, Wissenschaftler, Techniker und Manager selbstverständlich für alle Frauen und Männer, die diese Berufe ausüben oder vertreten.
1Einführung: Idee und Rahmen des Buches
Die deutsche Sprache ist kreativ in der Produktion von Wortschöpfungen. Zur Freude aller, die Deutsch als Fremdsprache lernen, lassen sich Substantive fast unbegrenzt aneinanderreihen und neue Bedeutungen kreieren. Ein Paradebeispiel dafür ist der Begriff Management – man stolpert täglich über neue Kreationen. Alles im Leben scheint Management zu sein und aus jeder handelnden Person wird demzufolge ein Manager. Der Automobilist fabuliert von Motor-, der Oenologe von Alkohol- oder Säuremanagement, der Personalchef vom Diversity Management, der Landtierarzt verdient gut als Abferkelmanager, der Katastrophentheoretiker betreibt Endzeitmanagement, ein Hausmeister nennt sich Facility Manager, der Verkäufer Vertriebsmanager, der Ökologe Nachhaltigkeitsmanager, der Coach Karrieremanager, den Milchbauern gibt es heute ohne Herdenmanagement fast nicht mehr und dazwischen tummeln sich munter Hotel-, IT-, Event-, Portfolio-, Fonds-, Ideen- oder Finanzmanager. Für schwierige Situationen gibt es Krisenmanager, die sich ihrerseits mühsam in Selbstmanagement geschult haben und sich auf ein ausgefuchstes Qualitätsmanagement stützen. Viele Firmen haben ein aufwendiges Compliance Management installiert, an das sich die Feld-, Wald- und Wiesenmanager für Produkte oder Projekte halten müssen, wenn sie vom Einkaufsmanager des Kunden im Rahmen seines Supply-Chain-Managements angegangen werden. Und alle sind sie bemüht, dem Top Management zu gefallen, um möglichst bald mindestens in das Mittelmanagement aufzusteigen.
Mitten in diesem Reigen steht der Begriff Lebensmittelmanagement. Eine vergleichsweise junge Wortschöpfung im wohl ältesten Bereich menschlichen Handelns. Hätten unsere Vorfahren zu einem beliebigen Zeitpunkt aufgehört, Lebensmittel zu sich zu nehmen, gäbe es uns heute nicht. Da sie das nie getan haben, erwachen inzwischen jeden Morgen sieben Milliarden Esser weltweit und verspüren Hunger (7,11 Mrd. nach http://www.umrechnung.org, Stand 11.2.2013). Jährlich kommen 80 Millionen dazu. Alle Erdbewohner satt zu bekommen, ohne die Ressourcen der Erde unwiederbringlich zu vernichten, ist eine wahrhaft herkulische Managementaufgabe. Ein Begriff wie Management verliert sich in Beliebigkeit, wenn er nicht präzise definiert und abgegrenzt wird. Das vorliegende Buch orientiert sich am Begriffsverständnis, wie es im Merksatz festgehalten ist.
Merksatz
Management ist die Lehre von der Führung von Organisationen. Sie umfasst die Gestaltung, Steuerung und Entwicklung zweckorientierter sozialer Systeme durch Planung, Organisation, Durchsetzung und Kontrolle der Prozesse.
Die Lebensmittelwirtschaft befindet sich im Umbruch. Das vielfach noch ausgeprägte handwerkliche Denken wird aufgrund der Markterfordernisse immer schneller von Ansprüchen abgelöst, die eine akademische Ausbildung notwendig machen. Dadurch entsteht ein großer Bedarf an Managern zur Lösung von immer komplexer werdenden Aufgaben. Ein dynamisches Marktgeschehen definiert kontinuierlich neue Schwerpunkte, auf deren Herausforderungen ein Manager in der Lebensmittelwirtschaft zu reagieren hat. So rückte aufgrund gestiegener Sensibilität bei den Kundenerwartungen in den letzten Jahren das Fach Ökologie in den Vordergrund. Unternehmen werden verstärkt dazu angehalten, ihren ökologischen Fußabdruck zu optimieren. Aus der Richtung des Gesetzgebers, aber auch der Gesellschaft, werden nach diversen Wirtschaftsskandalen die Forderungen nach Regeln für eine ehrbare Unternehmensführung, einer Corporate Governance, immer lauter. Firmen werden so genötigt, sich ethische Spielregeln zu verordnen und deren Einhaltung zu dokumentieren. Die komplexer werdende Welt erfordert zudem immer komplexere Vertragswerke – ohne juristischen Sachverstand können sie zu einem unkalkulierbaren Firmenrisiko werden. Management steht nicht zuletzt für lebenslanges Lernen und Anpassen an neue Situationen. Überleben werden jene Firmen und Personen, deren Anpassungsgeschwindigkeit mit der Veränderungsgeschwindigkeit mindestens mithält.
Merksatz
Managementwissen ist Branchen übergreifend und abzugrenzen vom Fachwissen. Es umfasst die gesamte Breite eines sozialen Systems (Personal, Organisation, Innovation) sowie ein hohes Maß an Wissen über die Gesellschaft.
Das Thema Management füllt ganze Bibliotheken. Das Spektrum der Fachliteratur reicht von der allgemeinen Managementtheorie, dem Management als Kunst der Führung, dem Management als Unternehmenssteuerung durch Kennzahlen über mehr handwerklich-praktische Themen (z. B. Risiko-, Portfolio- oder Produktmanagement) bis hin zur ethischen Verantwortung eines Managers.
Dieses vorliegende Werk verzichtet weitgehend auf eine Darstellung von Themen, die traditionell in den Fachgebieten Betriebswirtschaft oder Marketing zu Hause sind und dort erschöpfend behandelt werden. Deren Inhalte zählen zu den Hard Skills, zu ureigenem Hochschulwissen. Die Schwerpunkte des Buches sind folgende:
das sich aus seiner Vergangenheit ergebende Bild des Menschen, das Reaktionen und Verhaltensweisen im Leben und im Markt verständlich macht
die deutsche Lebensmittelwirtschaft als potenzieller Arbeitgeber für Absolventen von Lebensmittel-Studiengängen wird ausführlich vorgestellt
der ethische Überbau als Leitfaden des eigenen Handelns wird mit der Absicherung gegen Risiken aller Art zu einer Art Immunsystem des Unternehmens verknüpft
als wichtige Kostentreiber im Unternehmen werden Einkauf, Vertrieb, Innovation, Produkt- und Projektmanagement behandelt und mögliche Effizienzsteigerungen angesprochen
das Veränderungsmanagement, das für die Zukunftsgestaltung des Unternehmens eine entscheidende Rolle spielt
Die Idee des Buches und der Rahmen, in dem sich die Kapitel bewegen, lässt sich wie folgt beschreiben: Der Manager – mit seiner Persönlichkeit, seinem Menschenbild, seiner ethischen Einstellung – wird in seinem Lebensraum (Markt, Firma, Abteilung) täglich vom Wettbewerb bedrängt, ist ständig internen und externen Risiken ausgesetzt und ist letztlich einer einzigen Konstante unterworfen: dem kontinuierlichen Wandel. Um definierte Ziele zu erreichen, stehen ihm Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit, Präsentationsgeschick, Sprachkenntnisse oder seine Ausstrahlung zur Verfügung. Dazu beherrscht er das Handwerk des Managers, er verfügt zudem über die erforderliche Methodenkenntnis.
Ein Buch über das Managen von Unternehmen kann aus interner oder externer Sicht geschrieben werden, der Blickwinkel ist dabei jeweils ein gänzlich anderer. Die sogenannte intrinsische Betrachtung konzentriert sich auf den Organismus und seine Funktionen, auf die Spielregeln und Gesetzmäßigkeiten nach denen er arbeitet: Welche Organisationsstruktur liegt ihm zugrunde, welche Maßnahmen gegen Gefahren von innen und außen sind als Immunsystem implementiert, nach welchen Mechanismen sind die Abläufe strukturiert und welches Handwerkszeug steht den Mitarbeitern zur Verfügung, um ihren Job zu erledigen. Dieser Blickwinkel hat etwas vom Igel, der seine Stacheln nach außen stellt. Es handelt sich dabei auch ein Stück weit um eine Nabelschau, die sich im Extremfall auf die Beschäftigung mit sich selbst reduziert und bei der der Kunde zum Störfall werden kann. Bei Kaufleuten und Technikern gleichermaßen ist diese Betrachtungsweise nichts Ungewöhnliches.
Der Blick von außen, die extrinsische Betrachtung, beschäftigt sich dagegen mit allem, was auf das Unternehmen und seine Handelnden einströmt. Marketing- und Vertriebsmitarbeiter stehen dieser Betrachtung näher. Die Gesellschaft, der Gesetzgeber, vor allem aber die Kunden, das kulturelle Umfeld, NGOs, die Wettbewerber und Partner – alle hinterlassen Spuren. Das Unternehmen muss sich auf die Herausforderungen der äußeren Welt einstellen und das Verhalten ihrer Akteure frühzeitig kennen. Die Kunden bringen den Umsatz, der Wettbewerb versucht ihn zu verhindern, der Gesetzgeber steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen der Manager sich bewegen kann. Die beiden Blickwinkel sind letztlich die zwei Seiten einer Medaille. Ein Manager muss beide gleichrangig betrachten, wo hingegen ein Fachmann sich schwerpunktmäßig auf eine konzentrieren kann (siehe Abbildung 1.1).
Abb. 1.1 Interner und externer Blick auf das Management eines Unternehmens
Diesem Buch liegen über 30 Jahre als Manager in der Industrie und als Lehrer an einer Hochschule zugrunde, auf diese Weise fließt die Erfahrung beider Welten mit ein. Zur spannendsten Zeit gehörten die knapp zehn Berufsjahre als Geschäftsführer eines Konzern-Teilunternehmens. Als aufrechter Lebensmitteltechnologe, der im Studium das Wort Vertrieb nur mit Verachtung in den Mund zu nehmen gelernt hat und sich unter Controlling überhaupt nichts vorstellen konnte, musste ich realisieren, dass die Methoden des Managements in allen Lebensbereichen präsent und unverzichtbar sind: im Sport, in der Bauphase eines Hauses, beim Verfassen eines Buches, bei einem Umzug, in der Familienorganisation und im Geschäftsleben sowieso. In jedem dieser Fälle sind zunächst Ausgangspunkt und Ziel der Reise zu definieren. Zudem müssen die Mittel, mit denen auf dem Weg zum Ziel gearbeitet werden kann, bestimmt werden. Wenn sich das Ziel als utopisch herausgestellt hat, kommt die Planänderung. Ohne ein Ziel, das angestrebt wird, ist alles Tun planlos. Projektmanagement, Change Management, Risikomanagement, Einkaufsmanagement – all diese Werkzeuge werden im Privat- wie auch im Geschäftsleben benötigt.
Die vorliegende Zusammenstellung versucht, zwischen superkreativen Technologen und Zahlen anbetenden Kaufleuten zu vermitteln. Hervorragende Produkte im Portfolio sind die notwendige Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Hinreichend wird er, wenn das Unternehmen auch betriebswirtschaftlich professionell gesteuert wird. Von Kaufleuten dominierte Firmen neigen dazu, Kontrollfreaks und Zahlenfetischisten bestimmen zu lassen und das Unternehmen mit Angstfesseln zu lähmen. Techniker im Chefsessel dagegen können mit immer neuen, vielversprechenden Produkten Ergebnisschwächen kaschieren und trotz Blindflug sogar lange Zeit erfolgreich sein. Das Erfolgsrezept liegt im Mittelweg. Das setzt voraus, dass sich die beiden Pole verstehen. Zum Grundgedanken von Studiengängen wie Lebensmittelmanagement, Gesundheitsmanagement oder Wirtschaftsingenieurwesen gehört es, in beiden Welten zu Hause zu sein.
Für den beruflichen Erfolg der Absolventen gibt es allerdings eine Voraussetzung, die in keinem Buch gelehrt werden kann: die eigene Motivation und Begeisterung. Gute Automanager haben Benzin im Blut, gute Lebensmittelmanager die tierischen und pflanzlichen Rohstoffe.
2Lebensmittelmanagement: Was ist das?
Dieses Kapitel spannt zunächst den Bogen vom Begriff des Managements über die Einordnung des Managers in ein Unternehmen bis hin zum Agribusiness, zu dessen Teilbereichen die Produktion und der Vertrieb von Lebensmitteln gehören. Eine wichtige Rolle spielen grundsätzliche Überlegungen zur Unternehmensstruktur und Unternehmenskultur, innerhalb derer die Wertschöpfungskette von Produkten abgebildet wird. Als Zielgrößen für unternehmerischen Erfolg werden meist betriebswirtschaftliche Kenngrößen verwendet. Die wichtigsten davon sind in Kapitel 2.7 erläutert.
2.1Was bedeutet Management?
Kaum ein Begriff wird weltweit so inflationär eingesetzt wie der des Managements. Er wird mit Inhalten unterschiedlichster Art befrachtet und ist oftmals schwammig. Abbildung 2.1 veranschaulicht, was im vorliegenden Werk darunter zu verstehen ist und wann von „managen“ gesprochen werden kann. Stark verkürzt lässt sich „managen“ folgendermaßen definieren: „Das Ziel effektiv erreichen, den Weg dorthin konsequent und effizient gehen.“ Wer effektiv war, ist – wie auch immer – am Ziel angekommen. Wer effizient war, hat den ökonomischsten Weg, üblicherweise den geraden, gewählt. Ineffizienz ist ein Maß für die in allen Betrieben – natürlich auch im Privaten – vorkommende Schlamperei, den Reibungsverlust bzw. den mangelhaften Wirkungsgrad. Nach dem kritischen Hinterfragen der Plausibilität eines Zieles ist die Effizienzverbesserung eine der Hauptaufgaben des Managers. In der Praxis lässt sich häufig feststellen, dass nach einem energischen Beginn die Umsetzungskonsequenz im Laufe des Weges verloren geht. Ein ständiger Soll-Ist-Vergleich zwingt ihn, weiter am Ball zu bleiben.
Abb. 2.1 Grundprinzip des „Managens“
Hinter dem Ziel kann sich eine Kostensenkung im Fuhrpark, die Minimierung des Übergewichts von Verpackungen, die Steigerung von Umsatz oder Gewinn, eine höhere Effizienz der Vertriebsaktivitäten, die Verkürzung der Entwicklungszeit, die Reduzierung von Lieferantenzahlen, eine Steigerung der Patentanmeldungen und Vieles mehr verbergen. In jedem Fall setzt die Zielfestsetzung voraus, dass der Ausgangspunkt ermittelt ist. Ein Unternehmen, das seinen Umsatz im folgenden Geschäftsjahr um fünf Prozent steigern will, muss den des laufenden Jahres kennen. Da aber der Planungszeitraum für das Jahr 2012 bereits im Sommer 2011 liegt, ergibt sich bereits das erste Problem. Anstelle von Ist-Zahlen, die erst in einigen Monaten zur Verfügung stehen, dienen als Aufsatzpunkt für das Folgejahr ersatzweise Erwartungswerte oder Hochrechnungen auf das Jahresende. Dasselbe gilt für Verbesserungen der Produktivität, die Anpassung der Mitarbeiterzahl, die Steigerung der Innovationskraft u. a. Das neue Ziel wird Budget oder Plan genannt und ist, der Logik der industriellen Wirtschaft folgend, besser als im Vorjahr. Häufig ist die Zielfestlegung ein kämpferischer Prozess zwischen dem Zielverantwortlichen und der übergeordneten Ebene, die ambitioniertere Größen erwartet und meist viele Einzelpläne zum Gesamtzahlenwerk eines Unternehmens verdichten muss. Ist ein Budget verbindlich festgelegt, ist der Manager als Zielverantwortlicher gefordert. Ein Budget wird in den meisten Unternehmen als Commitment verstanden, als Verpflichtung, die einzuhalten ist. Der Manager hat die für das Erreichen des Ziels nötigen Ressourcen zu definieren und die Aufgaben in der Hierarchie nach unten festzulegen. Er muss als Kommunikator aktiv sein, um Jahresziele und korrespondierende Monats-/Wochenziele in die gesamte Organisation zu tragen. Jeder Mitarbeiter muss wissen, was er zu tun hat – Erfolg ist letztlich eine Teamleistung. Danach besteht die zentrale Aufgabe des Managers aus Controlling, dem permanenten Soll-Ist-Vergleich. Er muss dazu, unabhängig von seiner Ausbildung, über ein grundlegendes Verständnis betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge verfügen.
Abbildung 2.2 zeigt beispielhaft eine Entwicklung von realisierten Umsatzwerten im Vergleich zum Plan über mehrere Perioden hinweg. Der kumulierte monatliche Betrag erlaubt eine Abschätzung des wahrscheinlichen Jahresendwertes, der als Forecast oder Erwartungswert nach oben kommuniziert wird. Hinter den Zahlen der Abbildung 2.2 können Schweinehälften, Gummibärchen, Kaffeefiltertüten, Edelstahlpumpen oder Säcke mit Kaffeebohnen stehen. Das Prinzip von Budgetierung und Controlling bleibt das gleiche.
Der Grafik ist zu entnehmen, dass das Budget 2007 den gleichen Betrag wie der Ist-Wert 2006 aufweist. Es ist anzunehmen, dass der tatsächlich erzielte Umsatz in 2006 über dem ursprünglichen Budget lag. Ebenso übersteigt der Ist-Wert 2007 im August des laufenden Geschäftsjahres das Budget (122,9 Mio. EUR) und liegt deutlich über dem Vergleichswert 2006 (118,5 Mio. EUR). Der verantwortliche Manager befindet sich nach Ablauf von zwei Dritteln der Strecke auf einem guten Weg und wird wohl einen über dem Plan liegenden Jahresend-Forecast in Aussicht stellen können.
Die wichtigste Aufgabe des Managements ist gemäß Definition die Steuerung der Zielgrößen. „Wie wird das Jahresergebnis?“ – die Antwort auf diese Frage soll strukturiert aus dem Zahlenwerk des Unternehmens abgelesen werden und nicht nach Bauchgefühl erfolgen. Im Zahlengebilde eines Unternehmens beeinflusst ein veränderter Forecast einer Abteilung das verdichtete Gesamtergebnis unmittelbar. Ein über dem Plan liegender Umsatzwert führt im Rahmen der Konsolidierung üblicherweise zu einem höheren Gewinn und zur Änderung von mehreren anderen, meist positiv gesehenen Kennzahlen. Je früher die wahrscheinlichen Endzahlen feststehen, desto länger steht im umgekehrten Fall bei negativen Planabweichungen Zeit für die Reaktion zur Verfügung. Korrekturmaßnahmen greifen meist erst nach mehreren Wochen oder Monaten. Je früher sie eingeleitet werden können, desto besser sind sie in der Lage, ergebniswirksam zu werden. Das Controlling eines Unternehmens dient letztendlich dem permanenten Abschätzen der nahen und mittleren Zukunft, in jedem Fall der zum Jahresende zu erwartenden Zahlen, um in einer ungünstigen Situation frühzeitig reagieren zu können. Am budgetierten Jahresgesamtergebnis wird in der Praxis möglichst lange festgehalten, auch wenn Rückgänge bei Auftragseingang und Umsatz fehlende Marge bedeuten und ein Indiz für ein deutliches Risiko darstellen. Bei Aktiengesellschaften führen Gewinnwarnungen fast gesetzmäßig zum Absturz des Börsenwertes und zu massivem Druck der Anteilseigner bzw. Aufsichtsgremien auf die Verantwortlichen.
2.2Was ist ein Manager und welche Aufgabe hat er?
Der Begriff Manager entstand aus dem englischen Verb to manage, was so viel bedeutet wie handhaben, bewerkstelligen, leiten. Ein Manager übernimmt unternehmerische Aufgaben, an der Spitze agiert er wie ein Eigentümer und wird dafür entsprechend entlohnt. Er ist die Person, die eine Organisation, d. h. ein zweckgerichtetes soziales Gebilde, führt. Führung umfasst die Gestaltung, Steuerung und Entwicklung durch Planung, Organisation, Durchsetzung und Kontrolle der Prozesse. Die Begriffe Manager und Führungskraft werden häufig synonym verwendet, wobei die Führung aber nur einen Teilbereich des Managements darstellt. Eine verbindliche Definition für den Begriff des Managers gibt es nicht, vielmehr lässt er sich durch die Rechte und Pflichten dieser Person beschreiben und vom „Nicht-Manager“ abgrenzen. Für einen Manager treffen die meisten der nachfolgenden Eigenschaften zu. Er ist nach diesem Verständnis:
ein Mitarbeiter mit Personal- und Führungsverantwortung und der Berechtigung, Untergebene einzustellen bzw. zu entlassen
ein Mitarbeiter mit Budget-Verantwortung
ein Mitarbeiter in Leitungsfunktion
ein leitender Mitarbeiter laut Gesetz
ein außertariflicher (AT-)Mitarbeiter, der üblicherweise ein angemessenes Festgehalt (Fixum) und zusätzlich einen ergebnisabhängigen Anteil (Bonus, Provision) als Vergütung bezieht; zusätzlich erhält er meist Firmen-Pkw, Firmen-Telefon usw.
Im Idealfall ist ein Manager ein global denkender, persönlich stabiler und charismatischer Kommunikator, der prozessorientiert und zielgerichtet arbeitet, interdisziplinär zu denken versteht, stets ganzheitlich ausgerichtet vorgeht und ein klares Welt- und Menschenbild nach außen trägt.
Die meisten Manager gehören zum Mittelmanagement, das die Verantwortung für die operative Umsetzung der strategischen Ziele im Wesentlichen trägt. Das Top Management, die Unternehmensleitung, führt die Ergebnisse zusammen und ist darüber hinaus für die Unternehmensstrategie zuständig. Die Geschäftsführer oder Vorstände als Geschäftsleitung sind ein juristisch definiertes Organ eines Unternehmens.
Hochschulabsolventen starten ihre Berufslaufbahn in der Regel in einer Position des Sachbearbeiters in Fachabteilungen wie Produktion, Marketing, Controlling oder Forschung und Entwicklung (F+E). Als Spezialist für Spurenanalytik oder Maschinenkonstruktion, Chemiker, Biologe, Lebensmitteltechnologe oder Ernährungswissenschaftler werden sie als Produkt- oder Projektmanager, Vertriebsingenieur oder Einkäufer eingestellt. Sie bearbeiten allein oder in einer Gruppe vorgegebene Aufgaben, meist ausgestattet mit Projekt- und Kostenverantwortung, aber ohne Führungsaufgaben. Größere Unternehmen leisten sich zudem beim Vorstand oder in der Produktion angesiedelte Assistenten, die dem Vorgesetzten zuarbeiten und im Zuge dieser Mitarbeit einen guten Überblick über die wichtigsten Firmenbereiche bekommen. Derartige Stabsstellen im Dunstkreis der Macht bieten Anfängern hervorragende Möglichkeiten, die Breite von Managementaufgaben kennenzulernen, sie sollten aber nach einiger Zeit in einer Linienfunktion mit eigener Verantwortung münden.
Eine Karriere verläuft üblicherweise vom Spezialisten zum Generalisten, je nach Organisation des Unternehmens vom Sachbearbeiter zum Gruppenleiter, von dort weiter nach oben im Flaschenhals zum Leiter einer Abteilung, einer Hauptabteilung, eines Bereiches. Auf diesem Weg – aus der Tiefe in die Breite – wachsen Aufgaben und Verantwortung für Personal, Budget, Kennzahlen, aber auch das Gehalt und die Belastung. Sach- und Fachwissen, das Beherrschen der Fachsprache und der entsprechenden Werkzeuge eines Arbeitsgebiets werden um Managementwissen ergänzt. Das Besondere am Managementwissen besteht darin, dass es nicht fachbezogen ist, sondern quasi eine Universalsprache besitzt, mit dem Kenner in jeder Art von Geschäft zurechtkommen. Branchenwechsel sind deshalb im oberen Management, wo reines Fachwissen bereits viel an Bedeutung verloren hat, weder ungewöhnlich noch selten. Abbildung 2.3 stellt die beiden Wissenspools in einer Matrixform dar. Im konkret vorliegenden Fall soll ein Spezialist aus der Konstruktion zum Innovationsmanager der Firma aufsteigen. Dieser ist dann für alle Arten von Innovationen, d. h. für Produkt-, Prozess- und Organisationsinnovationen, in den verschiedenen Abteilungen der Firma verantwortlich. Gleichzeitig wird ihm Personalverantwortung übertragen und möglicherweise wird er in den erweiterten Führungskreis aufgenommen.
Abb. 2.3 Matrix aus Management-, Sach- und Fachwissen (Arnold 2010, verändert)
In der Matrix ist die nur schwer überschaubare Vielzahl der Managementaufgaben in vier Hauptlinien zusammengefasst. Das Personalmanagement wird lediglich unter dem Aspekt des Managers als Mensch und die Auswirkungen seines Tuns auf andere Menschen behandelt (Kapitel 3). Die Linie Wissen über das Biotop enthält eher „weiche“ Elemente, die der Allgemeinbildung zugerechnet werden, dazu soziale und gesellschaftliche Kompetenzen sowie ein umfassendes Welt- und Menschenbild. Organisationsmanagement wirkt über die funktionalen Linien hinaus in fast allen anderen Managementbereichen. Produkt-, Risiko-, Qualitäts- oder Projektmanagement, Marketing – alle unternehmerischen Funktionen müssen organisatorisch dargestellt werden. Inhalte dazu finden sich in den jeweiligen Kapiteln des Buches (Kapitel 5 Das Immunsystem einer Organisation, Kapitel 6 Die Anatomie einer Organisation und Kapitel 8 Produkt- und Projektmanagement). Innovationsmanagement beschäftigt sich schließlich mit allem Neuen, das in die Welt gebracht werden soll.
Aufsteiger müssen bereit sein, sich im Laufe des Berufslebens viele Dinge neu anzueignen. Von einer Führungskraft im Lebensmittelmanagement werden zahlreiche Fähigkeiten erwartet, von denen Absolventen lebensmittelorientierter Studiengänge im Laufe ihrer Hochschulausbildung allenfalls in Nebenfächern gehört haben. Die wichtigsten sind nachfolgend aufgeführt:
Personalführung: Manager sind immer auch Vorgesetzte; die Auswahl und der Einsatz von Mitarbeitern entscheiden über den persönlichen Erfolg; erfolgreiches Management ist immer eine Teamleistung
rechtliche Grundlagen: kaum ein Projekt ist ohne Rechtskenntnis abzuwickeln
klassische Managementtools wie Risiko-, Projekt- oder Produktmanagement
Präsentation- und Kommunikation: das moderne Wirtschaftsleben ist eine Welt der Präsentation und der Besprechung
Selbstmanagement: Zeit ist immer knapp, die Zahl der Jonglierbälle immer zu groß; die Kunst des Delegierens an Teammitglieder erhöht deren mögliche Anzahl immens
Philosophie: nur Kant im Chefsessel lässt die Firma florieren; das ethische Verhalten des Lieferanten sieht der Käufer von Lebensmitteln als immer wichtiger an
psychische und physische Stabilität: Budget- und Marktdruck sind enorm
Das vorliegende Kompendium erhebt nicht den Anspruch, ein Karriereratgeber zu sein. Dieses Segment wird bereits durch die am Markt anzutreffenden Heerscharen von Psychologen, Coachs, Personalfachkräften sowie die einschlägigen Buchtitel ganzer Spezialbibliotheken abgedeckt. Dabei werden all die unschlagbaren Tipps und Empfehlungen (z. B. angemessenes Verhalten, Dos and Dont‘s, Wahl der richtigen Kleidung, Benehmen bei Tisch, Auswahl der richtigen Clubs – z. B. Die Rotarier – oder der angesagten Sportart, Knüpfen und Pflegen von Netzwerken) in den Mittelpunkt gestellt, die auf der Erfolgsleiter nach oben hilfreich sein können. Die praktische Auseinandersetzung mit diesen Empfehlungen, vor allem aber die kritische Reflexion der eigenen Karriere mit allen handelsüblichen Höhen und Tiefen, hat letztlich und in Summe zu einem Destillat mit 14 flüchtigen Inhaltsstoffen geführt. Sie lauten:
Nehmen Sie die anderen Menschen ernst. Deren Würde ist unantastbar.
Nehmen Sie sich selbst nicht zu ernst.
Sozialisieren Sie sich umfassend, am wichtigsten ist ein intaktes Familienleben.
Seien Sie bereit, in den Anfangsjahren mit entsprechendem Einsatz den Schwerpunkt auf Ihren Beruf zu legen, aber planen Sie Ruhephasen aktiv.
Haben Sie immer einen Plan B parat, wenn es mit dem aktuellen Plan schiefgeht.
Mit 50 spätestens sollten Sie beginnen, die Schwerpunkte zu verschieben. Ehrenämter warten auf Sie.
Erstellen Sie einen Masterplan für Ihr Leben und passen Sie ihn jährlich an! Was wollen Sie im Leben wirklich erreichen, was ist Ihre Botschaft?
Definieren Sie den Preis, den Sie für Ihre Karriere bereit sind, zu bezahlen. Der Job verändert Sie schneller und stärker als Sie den Job.
Netzwerke sind lebensnotwendig, kosten leider Zeit.
Suchen Sie sich Hobbys und persönliche Interessen. Sie erhöhen Ihre Allgemeinbildung und machen sich interessant für andere Menschen.
Stellen Sie sich ständig infrage und hören Sie auf Personen Ihres Vertrauens sowie auf Mitarbeiter und Kollegen. Beratungsresistenz steht am Eingang zur Hölle, Ihre Charakterveränderungen bemerken andere viel eher als Sie selbst.
Genießen Sie Ihren Erfolg, ohne arrogant zu werden.
Trainieren Sie Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit und lernen Sie zuzuhören.
Macht Ihnen Ihre Arbeit auf Dauer keinen Spaß mehr, ziehen Sie Konsequenzen.
Die Reihenfolge der Liste stellt keine Rangfolge dar. Jeder Lebensabschnitt erfordert eine andere Priorisierung. Folgende Fragen sollte sich jeder Aspirant für eine höhere Position am besten regelmäßig stellen: Was will ich im Leben erreichen und welchen Preis bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Jeder Absolvent einer Hochschule sollte sich zu Beginn der Karriere im Klaren darüber sein, welche Gipfel er beruflich erklimmen will: Steuert er im übertragenen Sinne den Mount Everest an, hat er mit extrem dünner Luft nach oben hin zu rechnen. Oder aber er entscheidet sich für den scheinbar harmloseren Harzer Brocken – aber auch dort kann ihm häufig ein kräftiger Wind um die Nase wehen. Diese Entscheidung setzt voraus, dass er seine eigenen Fähigkeiten ehrlich einschätzen kann. Weiterhin muss er als Teil eines Selbstmanagements realistische Kurz- und Mittelfristbudgets erstellen, diese ständig hinterfragen und entsprechende Forecasts festlegen.
2.3Die Lebensmittelwirtschaft als Teil des Agribusiness
Das folgende Kapitel stellt den Begriff Agribusiness als vollständige Wertschöpfungskette insgesamt dar. In Kapitel 4 erfolgt eine ausführliche Betrachtung jenes Teils, der sich mit der Lebensmittelwirtschaft, d. h. mit den Sektoren vier bis sieben und ihren zugehörigen Märkten, beschäftigt. In allen ist eine Managementleistung gefordert. Zusätzlich werden die Hochschulen betrachtet, die die Sektoren mit gut ausgebildeten Fachleuten zu versorgen haben.
Die gesamte Wertschöpfungskette mit ihren vor- und nachgelagerten Aktivitäten vom Acker bis zum Verbraucher („from farm to fork“) wird in der Literatur als Agribusiness oder Food Value Chain bezeichnet. Agribusiness vereinigt den weiten Bereich der Landwirtschaft mit dem der gesamten Lebensmittelwirtschaft und lässt sich in die folgenden sieben Wirtschaftssektoren gliedern (Strecker et al. 1996, Gabler Wirtschaftslexikon 2012):
I – Sektoren in dem der Landwirtschaft vorgelagerten Bereich: Saatzucht, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Landtechnik, Tierzucht, Futtermittel und Mischfutter, Tiergesundheit, Hofinnenwirtschaft und Stalltechnik
II – Sektoren im landwirtschaftlichen Bereich selbst (Produktionsbereiche): Ackerbau, Garten- und Zierpflanzenbau, Weinbau, Viehhaltung, Fischerei und Aquakultur
III – Sektoren in dem der Landwirtschaft nachgelagerten Bereich der Erfassungs- und Großhandelsstufe: Getreidehandel, Viehhandel, Obst- und Gemüsegroßhandel, Importeure, Exporteure sowie private und genossenschaftliche Landhandelsorganisationen, die sowohl den landwirtschaftlichen Bezug als auch Absatz betreiben
IV – Sektoren der ersten Verarbeitungsstufe (Verarbeitung des landwirtschaftlichen Rohproduktes): Getreide- und Mahlmühlen, Schälmühlen, Ölmühlen, Schlachthöfe und Zerlegebetriebe, Molkereien, Betriebe der Stärkeverarbeitung, Kellereien, Unternehmen der Obst- und Gemüseverarbeitung sowie der Herstellung von Eiprodukten, Fischverarbeitungsbetriebe, Zuckerfabriken, Mälzereien, Gewürzwerke
V – Sektoren der zweiten Verarbeitungsstufe (Veredelung von Rohprodukten): Brot und Backwaren, Nährmittel und Teigwaren, Fleischwaren, Süßwaren, Essigprodukte, alkoholfreie Getränke, alkoholische Getränke, sonstige Verarbeitungsprodukte und Fertiggerichte in unterschiedlichen Produktions- und Erscheinungsformen
VI – Sektoren in der Stufe des Lebensmittelhandels: Lebensmitteleinzelhandel, stationärer Lebensmittelgroßhandel (Cash & Carry), Lebensmittel-Zustellgroßhandel, Exporteure, Importeure
VII – Sektoren in der Stufe der Lebensmittelzubereitung als Großverbraucher: Gastronomie, Systemgastronomie und Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung (Betriebe, Krankenhäuser, Schulen etc.), Dienstleistungsunternehmen (Catering)
Zum Agribusiness gehört eine breite Palette an Dienstleistungen. Sie reicht von Beratungs-, Finanzierungs-, Transport- und Laborleistungen, Versicherungen, Gutachtertätigkeiten bis hin zu Verbandstätigkeiten und staatlichen Aktivitäten. Diese angebotenen Dienste ermöglichen es den Hauptakteuren innerhalb aller Sektoren, sich auf das Wesentliche ihres jeweiligen Arbeitsgebietes zu konzentrieren.
Die Lebensmittelproduktion weist im Vergleich mit den anderen Großindustrien Deutschlands einige Besonderheiten auf. Mit einer Vielzahl von selbstständigen Weinbauern, Metzger- und Bäckermeistern ist sie einerseits stark handwerklich geprägt und weist auf der anderen Seite hoch industrialisierte Betriebe der Getränke-, Fleisch- und Getreideverarbeitung auf. Abbildung 2.4 stellt die wesentlichen Charakteristika der beiden Pole gegenüber.
Abb. 2.4 Die beiden Pole der Lebensmittelherstellung
Die Großproduktion von Lebensmitteln ist im Wesentlichen durch economies of scale geprägt, im Zuge derer die Erhöhung der Produktionszahlen zu sinkenden Stückkosten führt und die Lebensmittel auf das in Deutschland bereitwillig in Kauf genommene niedrige Preisniveau sinken. Die Veredelung von Lebensmitteln und das „Design“ völlig neuer Produkte durch kreative Anwendung von Wissenschaft und Technik ist die Basis für die immense Zahl ständig neuer Lebensmittel. Trotz etwa 30 000 derartiger Innovationen jährlich bleibt die Gesamtzahl der Lebensmittel in Deutschland mit rund 150 000 (Stand 2012) aber weitgehend konstant. Die meisten Neuentwicklungen können am Lebensmittelmarkt nicht Fuß fassen, schon nach wenigen Monaten gibt es sie nicht mehr. Die Großbetriebe der Lebensmittelproduktion sind durch einen hohen Technikeinsatz geprägt. Aus ökonomischen Gründen kommt Spitzentechnologie (Hightech) zum Einsatz, die den höchsten Wirkungsgrad, die gleichmäßigste Verweilzeit, die schonendste Erhitzung und Vieles mehr gewährleistet, aber neben beträchtlichen Investitionssummen hoch qualifiziertes Bedien- und Servicepersonal erfordert. Der handwerklich ausgerichtete Betrieb kann sich derartige Techniken selten leisten oder wirtschaftlich nutzen, er benötigt maßgeschneiderte Maschinen auf adäquatem Niveau. Als Konsequenz muss er zum Teil deutlich höhere Stückkosten am Markt unterbringen, Öko- oder Bioware ist allein aus diesem Grund heraus teurer als ein Massenprodukt. Mischbetriebe, die sich zwischen beiden Polen bewegen, haben es am Markt zunehmend schwerer. Dies trifft auch auf Betriebe mittlerer Größe zu, deren Kostenstruktur z. B. bei Vertrieb und Marketing vergleichsweise hoch ist, wobei sie die Mengenvorteile nicht ausschöpfen können.
Unabhängig von der Dimension der Lebensmittelherstellung hat sich der Produktionsprozess mit den stofflichen Vorgängen physikalischer, chemischer und biologischer Art während der Verarbeitung zu befassen. Ziel ist die optimale Nutzung der eingesetzten Rohstoffe und deren Verarbeitung zu Lebensmitteln mit einem hohen Genuss- und Nährwert. Dabei gilt es, unter Einhaltung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards mit den vorhandenen ökologischen und ökonomischen Ressourcen schonend umzugehen. In der deutschen Lebensmittelwirtschaft herrscht noch ein ausgeprägter Wettbewerb. Eine Situation wie sie die oligopolartig strukturierte Mineralölindustrie aufweist, ist aufgrund der heterogenen Struktur und der vielfältigen Beschaffungsbasis derzeit nicht zu erwarten. Aufgrund des Wettbewerbs liegen die Nahrungsmittelpreise vergleichsweise niedrig und ermöglichen es dem Verbraucher, sich mit lediglich zehn bis elf Prozent seines verfügbaren Einkommens zu ernähren (Stand 2011). Menschen in Frankreich, Italien oder Spanien müssen prozentual deutlich mehr ausgeben, der Wert für die USA liegt mit 6–7 Prozent dafür messbar niedriger (FoodDrinkEurope 2012).
2.4Die Unternehmensstruktur als Handlungsrahmen
Die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft haben unabhängig von ihrer Größe oder Ausrichtung das wirtschaftliche Ziel, ein bestimmtes Produkt zu erzeugen und erfolgreich am Markt zu platzieren. In der betrieblichen Praxis strömt eine riesige Menge an Waren und Dienstleistungen in die Produktionsstätte, die zur Erstellung der betrieblichen Leistung benötigt wird. Jedes Unternehmen muss sich bestmöglich organisieren und die nötigen Fakultäten vorhalten, sodass ein Output mit optimalem Wirkungsgrad möglich ist. In Abbildung 2.5 wird der grundsätzlich erforderliche Input den zur Verarbeitung und Vermarktung nötigen Fach- und Managementabteilungen gegenübergestellt.
Ein Unternehmen kann als Organismus beschrieben werden, der zahlreiche Organe benötigt, um die angestrebten Ergebnisse zu erzielen. Ein biologischer Organismus hat das Ziel, sich zu vermehren, ein Unternehmen hingegen will profitabel wachsen. Wie die Organe in einem betrieblichen Organismus angeordnet werden können, wird in Kapitel 6 beschrieben. Die wichtigsten Managementaufgaben bestehen in der reibungsfreien Verzahnung der Abteilungen, in ihrer Zusammenarbeit ohne überflüssige interne Mauern und in der Vorgabe von Zielen, die in der Organisation kommuniziert und akzeptiert werden müssen. Das Management eines Unternehmens ist mit dem menschlichen Gehirn gleichzusetzen, das alle Messwerte der Körperorgane ständig überprüft und bei Abweichungen sofort Gegenmaßnahmen einleitet. Beim Menschen ist das angestrebte und einzuhaltende Ziel die Homöostase, beim Unternehmen die Übereinstimmung mit dem Plan. Entsprechend der Leistung des Gehirns, das bei drohenden Überlastungen des Körpers eingreift und ganze Organe blockiert, hat die Unternehmensleitung in Gefahrensituationen im Sinne des Ganzen zu reagieren.
Abb. 2.5 Ein Produktionsunternehmen als Organismus, der viele Produkte oder Dienstleistungen von außen aufnimmt und nach entsprechender Veredelung abgibt
2.5Die Wertschöpfungskette als zentrale Managementaufgabe
Letztendlich lebt jedes Unternehmen vom Verkauf seiner Produkte. Das können verzehrfähige Lebensmittel, aber auch Roh-, Hilfs- oder Zusatzstoffe sein, gleichfalls Beratungsdienstleistungen oder jede Art von Laborarbeiten. Allen gemeinsam ist, dass sie vor einer Vermarktung entwickelt und produziert werden müssen. Diese Phasen sind auch bei Dienstleistungen erkennbar – statt der Entstehung in einer Fabrikhalle durchlaufen sie einen eher geistigen Reifeprozess bis hin zum fertigen Produkt. Abbildung 2.6 verbindet die drei grundlegenden Phasen der Wertschöpfungskette, also Produktentwicklung, -erstellung und -vermarktung, auf der Zeitachse mit Managementaufgaben, die entlang der Kette abgearbeitet werden müssen und einen erheblichen Teil der Firmenkapazität abgreifen. Die Wertschöpfungskette ist in die Gesamtstruktur des Unternehmens oder Handwerksbetriebes eingebettet, dessen Organisation die notwendigen Fachbereiche selbst vorhält oder von außen zukauft. Compliance Management und Ethik schaffen einen Überbau und definieren erlaubtes bzw. verbotenes Handeln im Unternehmen generell und entlang des Prozesses. Die Grafik verdeutlicht, dass die einzelnen Fachbereiche unterschiedlich lang benötigt werden und ihre Verantwortlichen immer das Ganze im Auge behalten müssen.
Abb. 2.6 Die drei Phasen der Wertschöpfungskette und die auf der Zeitachse benötigten Managementleistungen
Das Controlling begleitet den gesamten Prozess vom Beginn der Entwicklung (z. B. durch F+E-Controlling, Einkaufscontrolling, Personalcontrolling) über die Produkterstellung (Produktionscontrolling, Einkaufscontrolling, Personalcontrolling) bis zum Vertriebscontrolling mit eingeschlossenem Produktcontrolling. Die zentrale Aufgabe des Controllings ist der ständige Soll-Ist-Vergleich, der bei Abweichungen vom Plan zu Gegenreaktionen führen muss.
Die Methoden des Innovationsmanagements werden bereits vor dem eigentlichen Entwicklungsprozess zur Ideenfindung, zur Bewertung von anderen existierenden Projekten in der Pipeline, zur Verwendung von Marketingerkenntnissen für die Entscheidungsfindung und für Vieles mehr eingesetzt (siehe Kapitel 10). Bereits in einem möglichst frühen Stadium der Entwicklung sind der Einkauf, der Vertrieb (beide siehe Kapitel 7), die Produktion, der Qualitätsverantwortliche, die Personalabteilung sowie das Marketing einzubinden. Alle Abteilungen sind auf diese Weise Teil eines Getriebes, bei dem die Zahnräder passgenau ineinandergreifen, um sich entlang der Kette vorwärtszubewegen. Die hohe Kunst des Managements besteht darin, die Betroffenen zur rechten Zeit zusammenzuführen, um den Wirkungsgrad zu optimieren. Vielfach wird dazu eine eigene Produkt- oder Projektmanagementstruktur geschaffen oder aktives Ressourcenmanagement betrieben, um die spezifische Verantwortung zu bündeln.
Die drei Phasen des Wertschöpfungsprozesses ihrerseits lassen sich je nach Situation weiter untergliedern. So gehören zur Produktentwicklung beispielsweise eine strukturierte Ideenfindung, Forschungsarbeiten im Labor, Basisentwicklungen im Technikum sowie erste Gehversuche in einer Pilotanlage. Der Produktionsprozess beinhaltet mindestens die eigentliche Produktion und die Verpackung. Die Vermarktung stützt sich u. a. auf ein spezifisches Produktmarketing, juristische Elemente der Vertragsgestaltung und den Vertriebsprozess selbst.
2.6Managementmodelle
Jedes Unternehmen besitzt eine spezifische Form der Organisation und des Umgangs der Menschen untereinander. Diese Eigenheiten eines Unternehmens schlagen sich u. a. aber auch in der Härte der Zielverfolgung, in der Fehlertoleranz, der Bedeutung von Innovationen, im Grad der individuellen Freiheit, im Ausmaß der Verantwortungsdelegation, im Entlohnungssystem und Führungsstil, im Selbstverständnis, im Glauben an Kennzahlen sowie in der Wertschätzung aller Stakeholder – nicht nur der Shareholder – nieder. Die Summe all dieser Eigenschaften bestimmt letztlich die sogenannte Firmenkultur. Weil dieser oft nicht expressis verbis ausformulierte Begriff alle Unternehmensbereiche, vor allem die mit direktem Einfluss auf Menschen, umfasst, ist er nur schwierig zu verändern. In vielen Unternehmen ist man sich nicht einmal richtig bewusst, eine Firmenkultur zu besitzen. Sie hat sich in der Haltung der Beschäftigten festgesetzt. Änderungen werden mit Unmut registriert, häufig offen oder verdeckt bekämpft. Fusionen, auch wenn sie wirtschaftlich und unter Marktaspekten richtig sind, scheitern nicht selten an inkompatiblen Firmenkulturen.
Die Unternehmenskultur zeigt sich nicht zuletzt darin, wie Produktentscheidungen getroffen werden. Welches Produkt kommt neu in die Innovationspipeline? Welche Merkmalsausprägungen eines Produktes sind für den Markt richtig, was ist also gut für den Kunden? Diese Fragen können top-down oder bottom-up entschieden werden. Unternehmen, die eher technik- oder produktorientiert „denken“, neigen dazu, die Entwickler oder Konstrukteure aufgrund ihres Wissens um die Produkte entscheiden zu lassen, welche Innovationen bzw. Erzeugnisse die nächsten sind, die der Vertrieb am Markt platzieren soll (bottom-up). Einfluss und Mitspracherecht der am Markt beteiligten Personen sind begrenzt, ihre Sinnesorgane (z. B. Augen und Ohren), mit denen sie die Bedürfnisse von Kunden erfassen, werden nicht oder kaum eingesetzt. Dieser Unternehmensstil war in der Vergangenheit die Domäne charismatischer Unternehmerpersönlichkeiten, die es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht selten gab und die in traditionellen Handwerksunternehmen (insbesondere im Weinbau) noch immer zu finden sind. Nach und nach wurde dieser Stil abgelöst und mehr oder weniger auf den Kopf gestellt. Zu den Aufgaben von Vertrieb und Marketing gehört es mittlerweile, Marktbedürfnisse frühzeitig aufzuspüren und top-down mit den Sparten Entwicklung und Produktion zu kommunizieren. Im Idealfall entwickelt sich daraus ein fruchtbarer Prozess, der Wünsche mit Machbarem in Einklang bringt. So hat beispielsweise die Weinbranche gelernt, wechselnde Trends der Kunden nach leichteren oder kräftigeren, nach frischen oder gereiften Weinen durch zielführende Arbeit in Weinberg und Keller zu befriedigen. Unabdingbare Voraussetzung hierfür war und ist es, die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden rechtzeitig zu kennen.
Ein wichtiges Element einer Firmenkultur ist das grundlegende Modell