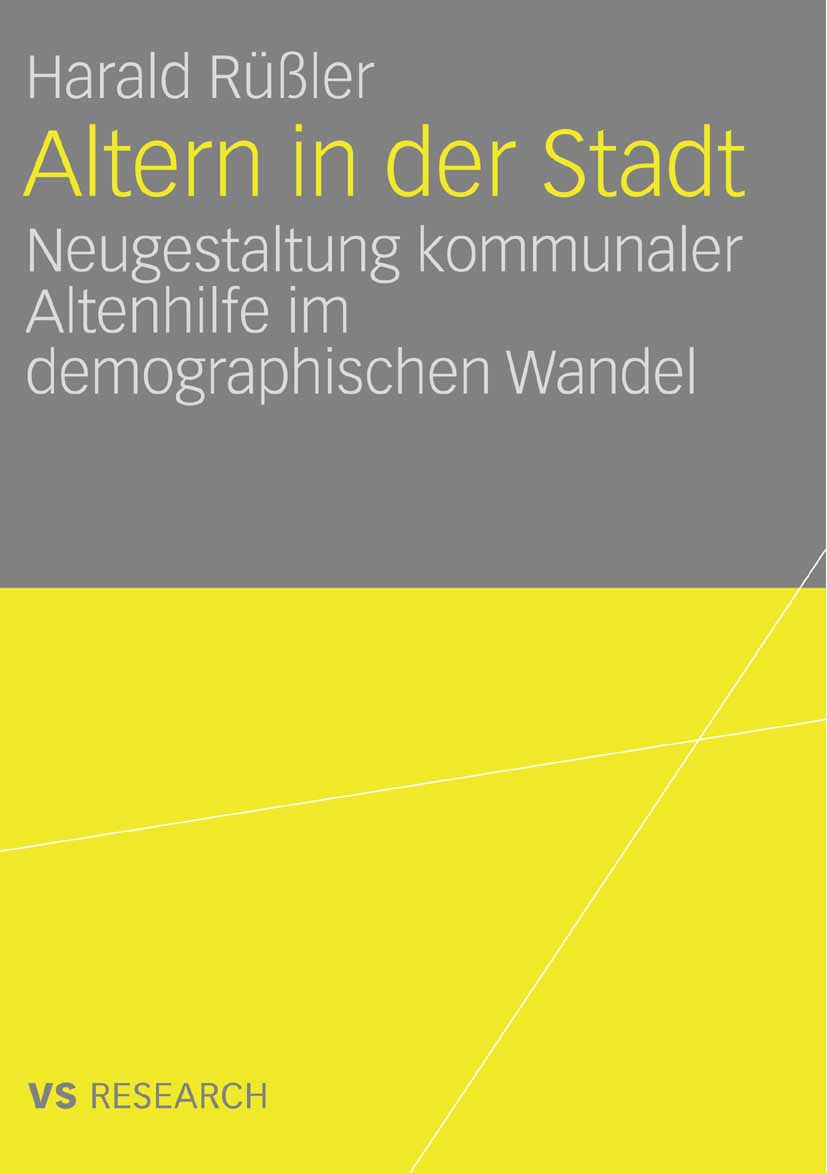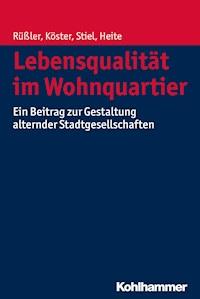
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alternde Stadtgesellschaften stehen vor der Herausforderung, in den Wohnquartieren ein "gutes" Leben im Alter zu ermöglichen. Das hier vorgestellte Forschungs- und Entwicklungsprojekt ("Lebensqualität Älterer im Wohnquartier") zeigt auf, wie Ältere zu Koproduzenten der Quartiersentwicklung werden können. Zentral ist die Frage des Zusammenhangs von Partizipation und Lebensqualität im Sozialraum; erörtert werden hierbei auch Aspekte sozialer Ungleichheit. Soziale Interventionen, (Lern-)Prozesse sowie Rahmenbedingungen und Kooperationen mit lokalen Akteuren rücken in den Fokus. Diskutiert wird u. a., inwieweit solche Entwicklungsprozesse einen Beitrag zur Stärkung der lokalen Demokratie leisten können. Ein Handlungsrahmen gibt Kommunen, Verbänden etc. Hinweise zur partizipativen Quartiersentwicklung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald RüßlerDietmar KösterJanina StielElisabeth Heite
Lebensqualität im Wohnquartier
Ein Beitrag zur Gestaltung alternder Stadtgesellschaften
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 17S05X10 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.
1. Auflage 2015
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-025792-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-025793-1
epub: ISBN 978-3-17-025794-8
mobi: ISBN 978-3-17-025795-5
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort
Dass gutsituierte „Best Ager“ und „Silver Ager“ sich aufmachen, das höhere Alter als Lebensphase mit vielerlei Chancen zu begreifen, prägt inzwischen die Wahrnehmung des Alters in der Öffentlichkeit durchaus entscheidend. Die Gruppe der sogenannten „Jungen Alten“ gibt die Vorlage, an der sich neue Bilder vom Alter formieren: selbstbewusst, körperlich und geistig mobil, vor allem aber nimmermüde aktiv sind sie, die neuen Alten. Mit ihren Aktivitäten haben sie nicht nur das eigene Wohlergehen im Blick, sondern in vielfältiger Weise auch Belange des Gemeinwohls, was in den steigenden Beteiligungsquoten älterer Menschen an Freiwilligenarbeit und Bürgerengagement zu erkennen ist. Empirisch zeigt sich allerdings, dass es vor allem Menschen mit (sehr) guten sozioökonomischen Ausstattungsmerkmalen sind, die sich – öffentlich wahrnehmbar – freiwillig, ehrenamtlich, bürgerschaftlich engagieren, während die Partizipationsraten bildungs- und einkommensärmerer Älterer deutlich niedriger sind.
In diesem Kontext sind die Ergebnisse der hier vorgelegten Studie „Lebensqualität Älterer im Wohnquartier“ (LiW) bemerkenswert, zeigen sie doch kommunale Handlungsspielräume auf, in denen der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bereich der Partizipation entgegen gewirkt werden kann. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt LiW wurde in den Jahren 2010 bis 2013 von der Forschungsgruppe „Alternde (Stadt-)Gesellschaften“ an der Fachhochschule Dortmund durchgeführt, gefördert im Rahmen der SILQUA-Förderlinie („Soziale Innovation für Lebensqualität im Alter“) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke wurde das Projekt umgesetzt, eine soziale Intervention zur partizipativen Quartiersentwicklung, die sich speziell an die ältere Bevölkerung des Stadtteils richtete. Im Zentrum der Studie stehen die Beschreibung und die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Lebensqualität und Partizipation in Stadtgesellschaften. Konkret geht es um die Frage, welche Praxisinterventionen die wechselseitigen Verbindungen zwischen einem ‚guten‘ Leben im Alter und der erweiterten Teilhabe im Stadtteil stärken können.
Die Ergebnisse der LiW-Studie zeigen zunächst einmal, dass es möglich ist partizipationsungewohnte, bildungs- und einkommensarme, oft alleinlebende ältere Menschen für Partizipationsprozesse im Quartier zu erreichen und auch nachhaltig einzubeziehen. Das allein ist schon ein starker Befund im Hinblick auf die oben skizzierten Daten zur sonst anzutreffenden sozialen Ungleichheit hinsichtlich der Partizipation älterer Menschen. Weiter zeigen die Ergebnisse: Es geht in begrenzten finanziellen Spielräumen, es geht in einer Stadt wie Gelsenkirchen, die wahrlich nicht auf einem komfortablen kommunalen Finanzpolster sitzt und sich kostspielige Experimente mit ungewissem Ausgang leisten könnte. Und weiter noch – und das sind unter den Gesichtspunkten von sozialer Innovation und Nachhaltigkeit vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie: Die Ergebnisse zeigen, wie es gehen kann, indem der Forschungsprozess tiefe Bedeutungsstrukturen der durchgeführten Maßnahmen rekonstruiert hat. Hier erkennt man, wie voraussetzungsreich das Gelingen solcher partizipativer Quartiersentwicklung ist. Es ist angewiesen auf eine kommunale Seniorenpolitik, die dem Partizipationsparadigma verpflichtet ist und entsprechende Strukturen bereits geschaffen hat und weiter entwickelt, und angewiesen auf Personen, die dies umsetzen, Bürgerinnen und Bürger wie Akteure aus Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung, Verbänden und Wirtschaft, die sich miteinander vernetzen und die Geduld aufbringen, die mühseligen und diskontinuierlichen Prozeduren partizipativer Gestaltungsprozesse durchzustehen. In Gelsenkirchen waren für all dies offenbar gute Voraussetzungen gegeben.
Wenn am Ende des Projekts ein beteiligter älterer Bürger resümierend sagt: „Ich komme jetzt aus nem Bereich, wo, wo, wo viele, wo viele Betroffene und Menschen sind, die ihr ganzes Leben bestimmt wurden. Die (…) sagen wir mal, nicht sehr ausgeprägten und sehr hohen Bildung im Arbeitsleben immer rein gingen als Hilfskraft et cetera. Die immer bestimmt wurden vom Vorarbeiter, vom vom Meister. (…) Und plötzlich im Alter wird der damit konfrontiert, da kommt einer und sagt ‚Hör mal zu: Du kannst jetzt mal sagen, was du möchtest. Du kannst jetzt mal machen, was du möchtest und kannst dich einbringen hier‘.“ – dann kann man daran zweierlei erkennen. Erstens: Persönliche Entwicklung kennt kein Alter, oder anders gewendet, es ist nie zu spät. Hier hat die Gelegenheit zu bürgerschaftlicher Partizipation den Anstoß für persönliche Entfaltung gegeben. Zweitens: Auf das, was dieser einzelne ältere Mann einzubringen vermag, sollten wir als Gesellschaft nicht verzichten wollen. Der Nutzen für die Stadtgesellschaft ist groß, sind doch die Bürger und Bürgerinnen Expertinnen und Experten ihres Alltags im Quartier und können als ältere Menschen, aus dem unmittelbaren Erleben ihrer aktuellen Lebenssituation in der Stadt, aber auch auf der Basis ihrer reichhaltigen Lebenserfahrungen, Perspektiven und Ideen beisteuern, auf die sonst niemand käme.
Der vorliegenden Veröffentlichung ist zu wünschen, dass sie breit rezipiert wird und dass sie bei den Leserinnen und Lesern aus Praxis und Wissenschaft schöpferische Unruhe erzeugt für die Umsetzung und Weiterentwicklung partizipativer Strukturen. Ansatzpunkte für kreatives Weiterdenken und Handeln bietet die Studie reichlich – das ist ein praxeologischer Forschungsansatz.
Dortmund, im April 2015
Prof. Dr. Luitgard Franke
Fachhochschule Dortmund – Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Ausgangslage und Fragestellungen
3 Theoretische Leitkonzepte
3.1 Lebensqualität und Lebenslage
3.2 Partizipation
3.3 Sozialraum- bzw. Quartiersbezug
3.4 Lernen im Alter
3.5 Zwischenfazit
4 Methodologischer Rahmen und Methodendesign
4.1 Methodologie
4.2 Methodendesign und Projektphasen
4.2.1 Phase I: Felderschließung
4.2.2 Phase II: Entwicklung von Pilotmaßnahmen
4.2.3 Phase III: Umsetzung der Pilotmaßnahmen
4.2.4 Phase IV: Ergebnisaufbereitung und Entwicklung eines Handlungsrahmens
4.3 Zwischenfazit
5 Ruhrgebiet im Fokus
5.1 Kommunale Rahmenbedingungen in Gelsenkirchen
5.2 Bestimmung eines Referenzgebiets
5.3 Zwischenfazit
6 Quartier im Fokus
6.1 Analyse vorhandener soziodemografischer Daten
6.2 Schriftliche Befragung
6.2.1 Inhalt und Ablauf der Befragung
6.2.2 Ausschöpfung und Generalisierbarkeit
6.2.3 Beschreibung der Stichprobe
6.2.4 Ergebnisse
6.3 Experteninterviews: Wie Schalke wahrgenommen wird
6.4 Experteninterviews: Zwischen Stellvertretung und Partizipation
6.5 Akteure in Schalke
6.6 Zwischenfazit
7 Soziale Intervention – Quartierskonferenzen
7.1 Prozessanalyse und -beschreibung
7.1.1 Soziodemografie der Teilnehmenden
7.1.2 Überblick über den Prozessverlauf
7.1.3 Phase I: Bestimmen der relevanten Handlungsfelder im Quartier
7.1.4 Phase II: Aneignen des Sozialraums in Arbeitsgruppen
7.1.5 Phase III: Maßnahmenplanung und -umsetzung
7.2 Arbeitsgruppen
7.2.1 Sicherheit und Sauberkeit
7.2.2 Wohnen und Wohnumfeld
7.2.3 Gemeinschaftliches Zusammenleben
7.2.4 Mobilität und Verkehrssicherheit
7.2.5 Öffentlichkeitsarbeit
7.3 Spannungen im Partizipationsprozess
7.3.1 ‚Soziale Stadt‘ und die Erneuerung des Kußweges
7.3.2 Rechtsextreme Einstellungen und „reflexive Stadtgesellschaft“
7.4 Partizipationsprozess und Lebensqualität
7.4.1 Wertschätzung
7.4.2 Lernen und persönliche Weiterentwicklung
7.4.3 Empowerment
7.4.4 Ortsidentität
7.4.5 Netzwerkeffekte
7.4.6 Bewertung des Outputs
7.5 Soziale Ungleichheit und Beteiligung
7.6 Handlungsrahmen für eine partizipative Quartiersentwicklung
7.7 Zwischenfazit
8 Diskussion und Zusammenfassung
9 Ausblick
10 Literatur
1 Einleitung
Bisher ist es nach wie vor nur eine Minderheit der Kommunen in Deutschland, welche die Gestaltung der demografischen Alterung als eine zentrale Aufgabe begreifen (Naegele, 2014). Die Stadt Gelsenkirchen gehört zu jenen Kommunen, die Demografiekonzepte in Form von Masterplänen entwickelt haben und auch entsprechend handeln. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Lebensqualität Älterer im Wohnquartier (LiW)“ konnte an diese Aktivitäten der Stadt Gelsenkirchen anknüpfen. Unsere Studie, die wir mit diesem Buch vorlegen, versteht sich auch als ein Beitrag oder besser als Impuls zur Entwicklung und Realisierung von kommunalen Demografiekonzepten zur Gestaltung alternder Stadtgesellschaften.
Bezüglich der Wohnwünsche älterer Menschen sprechen die empirischen Ergebnisse eine deutliche Sprache: Die überwiegende Mehrheit möchte selbstbestimmt älter werden und solange wie möglich in der eigenen Wohnung bzw. in vertrauter Umgebung leben (Kremer-Preiß & Stolarz, 2003, S. 8). Insbesondere im Alter kommt daher dem Quartier, wie immer es im Einzelnen begrifflich gefasst wird, eine herausragende Bedeutung zu. Als lebensweltlicher Nahraum ist das Wohnquartier ein zentraler Umweltbereich des Alter(n)s. Öffentliche Räume bzw. halböffentliche Übergangsräume (z. B. Hausflure, Gartenwege, Kirchplätze etc.) sind stets sozial produzierte und historisch gewachsene Orte. Im Sinne der Interdependenz von Person-Umwelt-Beziehungen beeinflusst das Wohnumfeld einerseits das Alter(n) bzw. die Lebensqualität im Alter; andererseits kann es als sozial produzierter Sozialraum auch (um)gestaltet werden (z. B. barrierearm). Die Studie zeigt, dass ältere Menschen hierbei durch Partizipation eine gewichtige Rolle einnehmen können, sind sie doch die Expertinnen und Experten ihrer alltäglichen Lebenswelt bzw. -umwelt.
Durchgeführt wurde das LiW-Projekt von der Forschungsgruppe ‚Alternde (Stadt-)Gesellschaften‘ an der Fachhochschule Dortmund in den Jahren von 2010 bis 2013; gefördert wurde es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der SILQUA-Förderlinie („Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter“). Das Projekt war von Beginn an eingebettet in die von der Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen (Praxispartner) auf den Weg gebrachte Neustrukturierung der Seniorenpolitik.1 Aufmerksam geworden auf diesen Reformprozess konnte die Forschungsgruppe der FH rasch eine Zusammenarbeit mit der Stadt vereinbaren, das Projekt beantragen und erfolgreich abschließen. Basis des seniorenpolitischen Reformprozesses der Stadt ist der „Masterplan Seniorinnen und Senioren in Gelsenkirchen“, den der Rat der Stadt am 27.10.2005 einstimmig beschlossen hatte. Leitbild ist eine generationensolidarische und barrierefreie Stadt. Die zentrale handlungsleitende Konzeption hierfür ist das Partizipationsparadigma. Die Reformpolitik richtet sich primär auf die Schaffung wohnortnaher Ermöglichungs- und entsprechender quartiersbezogener Angebots- und Netzwerkstrukturen (Stadt Gelsenkirchen, 2010). Es geht im LiW-Projekt um den Prozess des Alter(n)s in städtischen Sozialräumen – empirisch steht das Ruhrgebiet im Mittelpunkt. Mit Sicht auf diesen großstädtischen Agglomerationsraum (Stichwort: Metropole Ruhr), der sich schon seit Jahren im soziökonomischen Strukturwandel befindend, zeigt sich auch der demografische Wandel in ausgeprägter Weise. Insbesondere der relativ rasch voranschreitende demografische Schrumpfungs- und Alterungsprozess ist charakteristisch für diese Region, ein Prozess, der für andere Regionen erst in fünf bis zehn Jahren zutreffen wird (Naegele & Reichert, 2005). Dies gilt vor allem für ehemals klassische Industriearbeiterstädte wie z. B.: Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Duisburg (Naegele, 2010, S. 38).
Sinkende Bevölkerungszahlen und die „dreifache Alterung“ (Naegele, 2006) der Gesellschaft (Zunahme der Hochaltrigkeit, absoluter Anstieg der Anzahl älterer Menschen sowie das überproportionale Anwachsen Älterer bezogen auf das Verhältnis von jüngeren und älteren Menschen) gelten als Hauptkennzeichen des vieldiskutierten demografischen Wandels. Unmittelbar zeigen sich diese Veränderungen auf kommunaler Ebene. Hier korrespondieren sie noch mit sozioökonomischen Veränderungen (Strukturwandel, Prozesse sozialer und ethnischer Segregation, Pluralisierung privater Beziehungsformen, Entgrenzung von Arbeit und Leben etc.) und altersstrukturellen Wandlungsvorgängen (wie z. B. Feminisierung, Singularisierung, Heterogenisierung des Alters). Das demografische Altern ist auch sozialräumlich differenziert (Beetz, Müller, Beckmann & Hüttl, 2009, S. 28ff.). Regionen in Ostdeutschland und vor allem die vom Strukturwandel betroffenen altindustriellen Gebiete, wie Teile des Saarlands und nicht zuletzt das Ruhrgebiet, sind vergleichsweise ‚alte‘ Regionen (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2014). Auch innerhalb der Städte sind die Alterungsprozesse unterschiedlich verortet. Ebenso ist der allgemeine Trend zu sinkenden Bevölkerungszahlen nicht durchgängig. Sowohl innerhalb einer Region als auch innerstädtisch geht dieser häufig mit einem Bevölkerungsanstieg einher. Städte schrumpfen und wachsen gleichzeitig (Müller & Siedentop, 2004). Unter kritischer Beachtung der „Demographisierung des Gesellschaftlichen“ (Barlösius, 2007) haben demografische Prozesse nur eine begrenzte Erklärungskraft; denn häufig sind es Prozesse des sozialen und ökonomischen Wandels, die zur Erklärung gesellschaftlicher Veränderungen mit herangezogen werden müssen. Zudem sollten neben den ‚Risiken‘ des demografischen Wandels mehr die ‚Chancen‘ in den Blick geraten.
Es sind nicht wenige Studien, die vor diesem Wandlungshintergrund auf einen „Bedeutungsgewinn der Stadt“ (Läpple, Mückenberger & Oßenbrügge, 2010, S. 9) aufmerksam machen. Ob aber im Allgemeinen davon ausgegangen werden kann, „dass die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland aufgrund des spezifischen Infrastrukturbedarfs einzelner Bevölkerungsgruppen eine Rückkehr in die Stadt bewirken wird“ (Brühl, Echter, Frölich von Bodelschwingh & Jekel, 2005, S. 40), ist allerdings eine offene Frage. Aufgrund der Distanzempfindlichkeit des Alters wächst aber die Zahl der Menschen, „die auf spezifische, nahräumlich gebündelte Angebote angewiesen sind“ (Walther, 1998, S. 36). Und hierfür bietet die Stadt mit ihrer Dienstleistungs- bzw. Versorgungsdichte gute Voraussetzungen. So wächst der Wunsch, insbesondere bei ‚jungen Alten‘, „das oft eintönige Einfamilienhaus in Suburbia gegen ein lebendiges Wohnumfeld mit attraktiven Freizeitangeboten um die Ecke einzutauschen. Später ist eine intakte Infrastruktur in fußläufiger Entfernung mit Geschäften, Gastronomie und medizinischen Einrichtungen eine wichtige Voraussetzung, um möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können“ (Osterhage, 2007, S. 77f.). Zudem lassen sich in urbanen Sozialräumen eher neue Wohnformen (gemeinschaftliches Wohnen, Seniorenwohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen etc.) realisieren, „die das Bedürfnis älterer Menschen nach Kommunikation, Unterstützung und Selbstständigkeit aufgreifen“ (ebd., S. 78). Walther hat schließlich darauf hingewiesen, dass die urbane Lebensweise, die ja eher durch Unpersönlichkeit, Gleichgültigkeit und Distanz (Simmel, 1995) gekennzeichnet ist, dem urbanen Altern in der heutigen Zeit nicht entgegensteht. Die professionellen (ambulanten) Hilfsdienste für Ältere in den Städten „haben längst funktionale Äquivalente für solidarisch erbrachte Unterstützung aus Verwandten- und Bekanntenkreis hergestellt“ (Walther, 2007, S. 282). Hinzu kommt: „Bei schrumpfender Bevölkerung werden die Kosten des Umlandwohnens zunehmend bewusster als Kostenfaktor wahrgenommen und so wird z. B. das Zweitauto den höheren Wohnkosten in der Stadt gegenübergestellt“ (Brühl et al., 2005, S. 12). Wohnstandortsfragen unter Mobilitätsaspekten zu bedenken, dürfte ebenfalls für die anwachsende Gruppe der älteren Menschen relevant sein. Diese „könnten mit einer Rückwanderung in die Städte reagieren, weil hier der Lebensalltag bei eingeschränkten Mobilitätsbedingungen einfacher zu organisieren ist“ (Müller & Siedentop, 2004, S. 23). Mit anderen Worten: Die Nahräumlichkeit des Alters ‚profitiert‘ von der Dichte der Stadt, wegen ihrer kurzen Wege. Alles in allem kann daher angenommen werden, dass die Stadt als Wohnort gute Voraussetzungen bietet „für einen aktiven und selbstbestimmten Lebensabend“ (Osterhage, 2007, S. 77). Auch wenn die Plausibilität einer Wiederentdeckung der Stadt als Wohn- und Lebensort (auch) für ältere Menschen nicht von der Hand zu weisen ist, ist zu konstatieren, dass der Prozess der Reurbanisierung „nicht linear verläuft und zudem in lokal unterschiedlicher Weise“ (Brühl et al., 2005, S. 66). Ungeachtet der möglicherweise steigenden Bedeutung des städtischen Sozialraums für das Alter(n): Neuere Studien unterstreichen, dass die Reurbanisierung das bislang dominante Raummuster der Suburbanisierung, auch in schrumpfenden Stadtgesellschaften, „weitestgehend ablöst“ (Herfert & Osterhage, 2012, S. 107).
Die gesellschaftlichen und demografischen Wandlungsprozesse haben in den Städten auch Auswirkungen auf die kommunale Daseinsvorsorge. Zum einen kommt es zu einer Verlagerung der Wohlfahrtsproduktion auf nicht-staatliche Akteure und damit auch zu einer strukturellen Veränderung der Daseinsvorsorge. Neben öffentlichen bzw. kommunalen Instanzen und den in Deutschland traditionell Daseinsvorsorgeleistungen erbringenden Wohlfahrtsverbänden, werden heute auch gewinnorientierte Unternehmen (z. B. public-private Partnerships, stationäre/ambulante Pflegedienste) sowie Akteure der Zivilgesellschaft (z. B. im Stadtteil bürgerschaftlich Engagierte) in die soziale Daseinsvorsorge aktivierend mit einbezogen. Zum anderen ergibt sich aufgrund der krisenhaften gesellschaftlichen Umbrüche, mit denen die Stadtgesellschaften konfrontiert sind, eine Lastenverschiebung innerhalb der Daseinsvorsorge. „Von den Kommunen selbst oder anteilig zu finanzierende Pflichtleistungen binden in der Regel einen Großteil des kommunalen Sozialbudgets“ (Diakonie Deutschland, 2012, S. 9). Für Kann-Leistungen, mit denen die Kommunen auf spezifische Problemkonstellationen und Bedarfslagen reagieren könn(t)en, „bleibt dann häufig wenig Spielraum“ (ebd.). Diese Entwicklung verstärkt sowohl die soziale wie die sozialräumliche Ungleichheit (soziale Segregation) in den Städten als auch die Kluft zwischen reichen und armen Stadtgesellschaften (ungleiche Lebensverhältnisse). Für nicht wenige Stadtgesellschaften gerät daher vor allem die Gestaltung des sozialen und demografischen Wandels zu einem (finanziellen) Problem. Kommunalpolitische Entscheidungen „betreffen zunehmend den Rückbau der kommunalen Daseinsvorsorge“ (Wurtzbacher, 2014, S. 107). Dies gilt ganz besonders für schrumpfende Städte. Es kommt zu Rückgängen bei den Steuereinnahmen (z. B. des Einkommenssteueranteils) und den Länder-Finanzzuweisungen. Dagegen sinken die Pro-Kopf-Ausgaben nicht unbedingt in entsprechender Weise; infolge der Unterauslastung notwendiger kommunaler Infrastrukturangebote (Ausgabenremanenz) steigen sie tendenziell sogar (Bogumil, Heinze, Lehner & Strohmeier, 2013, S. 260f.). Demzufolge haben viele Städte und Kommunen vielschichtige Herausforderungen zu bewältigen.
Mit Sicht auf das Alter(n) geht es zum einen um den Ausbau von Unterstützungs- und Hilfesystemen im Wohlfahrtsmix vor allem infolge der zunehmenden Ausdünnung familialer Netzwerke (niedrige Geburtenraten, Kinderlosigkeit, Erwerbstätigkeit beider Geschlechter, Alleinlebende, Alleinerziehende, relativ hohe Scheidungsquoten etc.). Insbesondere ist der wachsende Pflegebedarf sicherzustellen, der mit der Zunahme der Hochaltrigkeit einhergeht, wenn auch keineswegs linear mit dieser. Zum anderen geht es im Wesentlichen darum, die Ressourcen und Potenziale des Alters zu erkennen und diese partizipativ mit einzubeziehen. Hierfür müss(t)en in den Kommunen Ermöglichungsstrukturen entwickelt und vor Ort, in den Quartieren, implementiert werden. Handlungsleitend ist ein Denken, das die vielfältigen Kompetenzen älterer Menschen sowie ihre Selbständigkeit und Selbstbestimmung beachtet bzw. anerkennt. Ohne die Risiken des (hohen) Alters aus den Augen zu verlieren: Ein solches Altersbild begreift das Alter(n) nicht in erster Linie als Belastung, sondern auch als Chance, die Zukunft mit zu gestalten und demokratisch mit zu bestimmen.
Ganz in diesem Sinne steht die partizipative Quartiersentwicklung im Fokus des LiW-Projekts, das sich in den Bereich der Kritischen (Sozial)Gerontologie mit Bezügen zu den (Angewandten) Sozialwissenschaften verorten lässt. Es geht v. a. darum, dass im Rahmen einer sozialen Intervention (moderierte Quartierskonferenzen) ortsansässige Ältere im Dialog mit verantwortlichen Akteuren aus Kommunalverwaltung und -politik, Zivilgesellschaft, Verbänden und Wirtschaft Maßnahmen entwickeln, die geeignet sind, die Lebensqualität heterogener Bevölkerungsgruppen Älterer und anderer Generationen im Quartier zu verbessern. Ältere Bürgerinnen und Bürger bestimmten die für sie relevanten Handlungsfelder und bearbeiten diese in mehreren Arbeitsgruppen, die in kontinuierlichen Zeitabständen zusammenkommen. Ältere avancieren so zu entscheidenden Mitgestaltern (Ko-Produzenten) ihrer alltäglichen sozialräumlichen Lebenswelt.
Die Lebensqualität älterer Menschen in ruhrgebietstypischen Sozialräumen steht somit im Fokus der folgenden Ausführungen, die derart gegliedert dargeboten werden: Im zweiten Kapitel werden Fragestellungen und Ausgangslage der Untersuchung expliziert. Die dem Forschungs- und Entwicklungsprozess zugrundeliegenden theoretischen Leitkonzepte (Heuristik) werden im dritten Kapitel vorgestellt. Daraufhin wird der Blick im vierten Kapitel auf den methodologischen Rahmen gerichtet und auf das Methodendesign, das sich auf die verschiedenen empirischen Phasen, die das Projekt durchlaufen hat, bezieht. Im fünften und im sechsten Kapitel rückt der Untersuchungsraum (Ruhrgebiet) bzw. das Referenzgebiet (Gelsenkirchen Schalke) ins Zentrum der Betrachtung. Die sich auf das Referenzgebiet beziehenden quantitativen und qualitativen Untersuchungen bilden den Hintergrund der partizipativen Quartiersentwicklung, die vom Projekt initiiert und evaluiert wurde. Die Prozessbeschreibung, die Darstellung der Ergebnisse der sozialen Intervention, die insbesondere auf den Zusammenhang von Partizipation und Lebensqualität aufmerksam machen, sowie die Explikation des transferfähigen Handlungsrahmens, der sich aus den Projekterkenntnissen zusammenstellen lässt, finden sich in Kapitel sieben. Kapitel acht diskutiert daraufhin in zusammenfassender Weise die wesentlichsten Projektergebnisse und ordnet diese in den (wissenschafts-)theoretischen Kontext ein. Das Buch endet mit einem Ausblick in Kapitel neun, der auf die vielfältigen, dem Projekt zuzurechnenden nachhaltigen Übertragungsformen hinweist.
1 Neben der Stadt Gelsenkirchen waren noch folgende Institutionen als Partner am Projekt beteiligt: das Senioren- bzw. Generationennetz Gelsenkirchen e. V., die Vivawest Wohnen GmbH, die Landesseniorenvertretung NRW, das Forschungsinstitut Geragogik (FoGera) und der Forschungsbereich „Planen und Bauen im Strukturwandel“ der Fachhochschule Dortmund.
2 Ausgangslage und Fragestellungen
Zur Darstellung der Ausgangslage der vorliegenden Untersuchung beginnen wir mit einer Erläuterung des Begriffs Alter(n), skizzieren ein neues Vergesellschaftungsmodell für das Leben in der nachberuflichen Phase, heben ab auf die Bedeutung des Wohnquartiers, des Partizipationsparadigmas und von Urban Governance für ein ‚gutes‘ Leben im Alter. Vor diesem Hintergrund kommen wir dann zur Entwicklung unserer Fragestellungen und – daran anschließend – zur wissenschaftstheoretischen Einordung unseres Forschungs- und Entwicklungsprojekts.
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen Alter und Altern (Kruse, 2007). Altern ist der gesamte unumkehrbare Prozess der biologischen, psychischen und sozialen Entwicklung eines Menschen, der aufgrund verschiedener (ungleicher) Lebensbedingungen individuell unterschiedlich verläuft. Alter ist eine Lebensphase2, die sozial und gesellschaftlich bestimmt ist (Backes & Clemens, 2013; Kolland & Wanka, 2014). Sie ist ein zentrales Merkmal sozialer Differenzierungen: Es ist auch eine Frage des Lebensalters, welche Möglichkeiten jemandem offen stehen. Es gibt drei Dimensionen des Alter(n)s, die mit Verlusten und Gewinnen verbunden sind: In der biologischen Perspektive ist mehr die Verringerung der organischen Leistungsfähigkeit festzustellen. In der psychologischen Sichtweise ist z. B. das Erfahrungswissen als Gewinn zu nennen, das sich über die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in früheren Lebensabschnitten aufgebaut hat. In der sozialen Dimension ist mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben oft die Erfahrung verbunden, keine verantwortungsvollen bzw. sinnstiftenden Aufgaben mehr wahrzunehmen, was nicht selten als Entwertung des Alters wahrgenommen wird (Köster, Schramek & Dorn, 2008, S. 161).
Besonders aus soziologischer wie sozialgerontologischer Perspektive betrachtet ist Alter(n) eine soziale Konstruktion. Der Verlauf des Alterns ist stark von der Lebenslage bestimmt: Einkommen, Bildungsstatus, Beruf, Geschlecht u. a. wirken auf den Alterungsprozess ein. Sie beeinflussen Gesundheit, soziale Netzwerke, Bildung, Engagement und Mobilität im Alter. Diese objektiven Gegebenheiten werden zudem durch die jeweilige subjektive Bewertung geprägt. aus denen sich das gesamte Bild der Lebenssituation älterer Menschen ergibt (Baumgartner, Kolland & Wanka, 2013, S. 19). Die Gruppe der älteren Menschen ist durch eine hohe Heterogenität gekennzeichnet. Altern ist ein differenzieller Prozess. Die Rede ist von einem jungen und einem alten Alter, von einem negativen und einem positiven Alter, von Risiken und Potenzialen des Alters. Auch interkulturell hat das Alter verschiedene (‚bunte‘) ‚Gesichter‘. Die Differenzierung des Alters führt auch zu neuen Altersbildern. Alter wird immer weniger als eine Lebensphase begriffen, die primär durch Leistungsabbau, Verfall und Hilfebedürftigkeit zu beschreiben ist. Vielmehr stehen Kompetenzen älterer Menschen im Vordergrund, die nach neuen Aufgabenbereichen bzw. Verantwortungsrollen suchen und dadurch auch in der letzten Lebensphase ein gelingendes und sinnerfülltes Leben anstreben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!