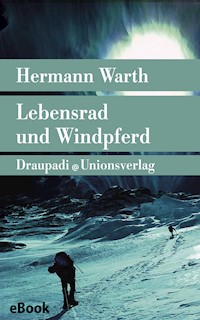
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwölf Jahre in Nepal – für Hermann Warth eine Schlüsselerfahrung in seinem Leben. Als Landesbeauftragter des Deutschen Entwicklungsdienstes und als Gutachter für verschiedene Organisationen lernte er das Land in den 1970er- und 1980er-Jahren kennen. Mehr als 14000 Kilometer ist er auf Nepals unzähligen Pfaden durch die wilde Natur gewandert. In diesem Band erinnert er sich an Erkundungen und Bergexpeditionen, an flüchtige Begegnungen und Weggefährten, die seinen Blick auf die Welt verändert haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Mehr als 14000 Kilometer ist Hermann Warth auf Nepals unzähligen Pfaden durch die wilde Natur gewandert. In diesem Band erinnert er sich an Erkundungen und Bergexpeditionen, an flüchtige Begegnungen und Weggefährten, die seinen Blick auf die Welt verändert haben.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Hermann Warth (*1940) lebte als Landesbeauftragter des Deutschen Entwicklungsdienstes in den 1970er- und 1980er-Jahren insgesamt neun Jahre in Nepal. In dieser Zeit lernte er sowohl die Menschen als auch die Natur des Landes zu schätzen.
Zur Webseite von Hermann Warth.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Hermann Warth
Lebensrad und Windpferd
Wege in Nepal
E-Book-Ausgabe
Draupadi @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Draupadi-Verlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
© by Draupadi Verlag, Heidelberg 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30883-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.11.2022, 21:03h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LEBENSRAD UND WINDPFERD
VorwortEinleitungTeil 1Ngawang Tenzing unterwegs — 1974, 1975, 1978, 1983Unterwegs mit Ang Chhopal — 1986BlutsbrüderRückständigeTotenwacheHimmel-Gewitter-PlatzEisen-Pferd, Feuer-Schwein und Eisen-SchlangeRückblickBeyul – Kraft im Verborgen — 1988Rückbesinnung: der neunte TagRückbesinnung: der achte TagRückbesinnung: der siebente bis dritte TagRückbesinnung: der zweite TagRückbesinnung: der erste TagDas ZielTeil 2Im Teashop — 1986Lebensinseln in den Wolken — 1993Unterwegs im MonsunEine SteuerungszentraleKraft der GemeinschaftHängende FelderKleingewerbe und Kleinhandel»Unterbeschäftigte«, »unbezahlte Arbeiterinnen«Übernatürlicher BeistandGhantu – Fest der ErneuerungArun — 1994–1995Das WehrKipatDer DämonYogamayaGefahrenDurga DeviArun heißt Sonne, LebenAufbruch zu neuer Balance — 1992–2006ErdungVerarbeitungEnttäuschungHoffnungDer übertroffene Alptraum — 1979, 1980, 2006, 2007Vielfalt in SchönheitDie HarpuneSysteme des ÜberlebensZerreißendes SicherheitsnetzVersagenDer übertroffene AlptraumDolpo – Leben im Grenzbereich — 2007, 2009, 1014FluchtVon Juphal nach RingmoVom Phoksumdosee über den Kang LaVon Shey nach Tsän-khangÜber den Sela La nach KhomaVon Shimen zum Ort der TragödieVom »Yakland« nach DagarjunRückkehrTeil 3Krieg — 1996–2006KrankenhausGewaltausbrücheEntstehung der MaoistenbewegungForderungen der MaoistenZehn Jahre und neun Monate BlutvergießenAuswirkungenBlutbefleckte ZeigefingerGravurenAusgrenzungKathmandu! Kathmandu!ZentralismusMächtige GrundherrenLandbesitzGaruda, der HimmelsvogelIm WirbelsturmSoziale Energie – Versuch einer AnnäherungFeigenbaumFrüchteZweige und Blätter: Vielfalt und ToleranzÄste: Flexibilität, Offenheit und MutStamm: Gegenseitigkeit und SubsistenzwissenWurzeln: Akzeptanz und Vertrauen in die »Welt«ZuversichtSchlussWorterklärungenLiteraturAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Hermann Warth
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Nepal
Zum Thema Asien
Zum Thema Berge
Vorwort
Etwa 12.000 Kilometer hatten mich meine Beine auf Nepals Wegen in fast alle Teile des Landes getragen. Ich war unterwegs als Landesbeauftragter des Deutschen Entwicklungsdienstes, als Gutachter und Tourist und war dankbar für jeden Meter, den ich auf Nepals Pfaden wandern durfte. Nach den ersten Touren war ich so begeistert, dass ich zu meiner Frau einmal sagte: »Ich möchte solange in Nepal wandern, bis ich in allen Teashops gerastet und mich an allen chautaras (Rastplätze unter Schatten spendenden Feigenbäumen) erholt habe.« Dietlinde erging es nicht anders. Ihr Kommentar nach jedem Trek war: »Zu kurz!« Am Ende meiner Vertragszeit mit dem Deutschen Entwicklungsdienst machte sie den Vorschlag, nun den längsten Trek in Nepal zu unternehmen. Ich hatte keine Vorstellung, welchen sie meinte. Sie ließ mich raten, bis sie sagte: »Durch ganz Nepal und zwar der Länge nach.« Es wurde ein 111-tägiges Unternehmen mit ungefähr 2.000 Kilometern, die wir zu Fuß bewältigten.1 Meist fühlte ich mich wie ein Pilger, wenn ich auch kein guter war. Ein rechter Pilger misst zum Beispiel nicht die Länge der zurückgelegten Strecke, sondern die Fortschritte in seiner charakterlichen Besserung. Viele Stunden verbrachte ich auch auf den Straßen und im Flugzeug und mit der Lektüre von Aufsätzen und Büchern über das Land und seine Menschen. Ich war dabei so manchen Lebenssituationen und Lebenswegen begegnet und hatte guten und weniger guten Einfluss auf die Nepali genommen. Doch ganz sicher habe ich mehr von ihnen erhalten als sie von mir.
Es gibt so ein paar Schlüsselerfahrungen im Leben. Die Jahre in Nepal gehören dazu. Sie waren ein bedeutender Einschnitt. Ich habe sie dem Zusammenspiel von glücklichen Umständen zu danken: Vom Deutschen Entwicklungsdienst (DED) wurde ich nach Nepal gesandt. So konnte ich durch meine Arbeit (als Landesbeauftragter des DED 1975–78 und 1980–84 und danach als Gutachter für verschiedene Organisationen) der nepalischen Gesellschaft wohl näherkommen als wenn ich mich als Tourist nur kurz in dem Land aufgehalten hätte. Gleichzeitig befand ich mich im körperlich leistungsfähigsten Alter und konnte meinem Hobby, dem Genießen möglichst wilder Natur, nachgehen. Ich war privilegiert und bin dankbar, dass ich mit den Nepali unterwegs sein konnte. Was habe ich mit ihnen erlebt auf diesen Wegen, Umwegen, Irrwegen im »Lebensrad«? Zu welchen Zielen waren wir unterwegs? Welche hatten wir uns vorgenommen? Welche wären möglich gewesen, warum haben wir sie nicht verfolgt? Welche liegen vor uns? Millionen Gebetswimpel in ganz Nepal – viele tragen das Bild des geschmückten und von Gebetstexten umrahmten »Windpferds« – senden unablässig die Sehnsucht und das Streben der Menschen nach Besserung ihrer Lebensumstände hinauf in den Himmel über dem Himalaya … Wird uns das Windpferd aus dem scheinbar unendlichen Kreisen des Rades hinaustragen zu Leidlosigkeit, Frieden und Glück? Woher kommt das Windpferd? Ist es in uns selbst?
Die nachfolgenden Kapitel sind eine Sammlung einiger Erfahrungen und Einsichten, die ich während insgesamt zwölf Jahren als Arbeitender, Wanderer und Bergsteiger in diesem Land gewinnen konnte. Es sind Beispiele des Wegsuchens, des Irrens und Wegfindens. Ich war Zeuge des Lebens im Rad und Zeuge von Versuchen, es zu verlassen, um die begehrten Früchte Kraft, Erkenntnis und Glück zu erhalten. Einige dieser Erlebnisse möchte ich mit den Lesern teilen. Sie mögen selbst entscheiden, welche Kapitel und Abschnitte der Symbolik des Lebensrades und welche derjenigen des Windpferdes zuzuordnen sind.
Die Auswahl ist höchst unvollständig. Millionen Nepali sind unterwegs, viele auf ganz unterschiedlichen Pfaden. Es ist naturgemäß unmöglich, sie angemessen zu beschreiben. Deshalb ist dieses Buch mit dem Lichtstrahl einer Taschenlampe zu vergleichen, der subjektiv gerichtet begrenzte Ausschnitte der nepalischen Wirklichkeit beleuchtet und Abschnitte der Wege in ihr. Der ländliche Raum steht dabei im Vordergrund, bedingt durch meine Arbeit und mein bevorzugtes Interesse an Lebensweisen außerhalb der Städte.
Die Beschreibungen sind außerdem oberflächlich, müssen es sein, da es unmöglich ist, ins Innere der Wandernden zu schauen. Als Nicht-Nepali blickt man von außen und mit »westlichen Augen« auf die Gesellschaft. Und auch wenn man viele Jahre in diesem Land verbringt, reicht das nicht aus, um es in seiner Vielfalt und Tiefe angemessen darzustellen. 47 Jahre lebte der amerikanische Historiker Ludwig F. Stiller in Nepal. Er sagte einmal: »Um Nepal wirklich zu erfassen, reicht ein Leben nicht.« So können die nachfolgenden Beschreibungen nur als Annäherung verstanden werden, als mein Sichaufdenwegbegeben, um Wege in Nepal zu erkunden und zu verstehen.
Vielen Kapiteln ist eine Jahreszahl vorangestellt, die anzeigt, wann ich Wegsuchenden in Nepal begegnete bzw. wann ich selbst als solcher in dem Land unterwegs war. Manche Kapitel mögen heutigen Nepalinteressierten und -reisenden nicht aktuell erscheinen und wie ein Abgesang auf eine vergangene Zeit wirken. »Doch das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen.« Diese Feststellung William Faulkners wird deutlich in den Kapiteln im zweiten und besonders im dritten Teil des Buches, wo beschrieben wird, wie geschichtliche Hypotheken der nepalischen Gesellschaft in die Gegenwart hineinwirken. Vom duldenden »stillen Schrei« in der Vergangenheit ist dort die Rede. Er hat sich zu lautem, teils gewalttätigem Aufbegehren in der Gegenwart gewandelt.
Die Veränderungen in Nepal scheinen immer schneller vonstatten zu gehen, verursacht durch Entwicklungszusammenarbeit mit westlichen Institutionen, durch temporäre Arbeitsaufenthalte Hunderttausender Nepali im Ausland, durch Tourismus, internationalen Handel, Elektrifizierung, Fernsehen, Internet und Straßenbau. In den Jahren 2006, 2007, 2009 und 2014 konnte ich als Tourist das Land wieder besuchen. Die Veränderungen sind offensichtlich. Doch sie beziehen sich vorrangig auf die Städte und die größeren Orte, die nun über Straßen erreichbar sind. Im Allgemeinen wird in den Dörfern abseits davon gearbeitet und gewirtschaftet, gefeiert und getrauert, soziale Nähe oder Distanz gepflegt wie zuvor. Wandel gibt es auch dort. Doch mit dem »Wirbelsturm« der Veränderungen in Kathmandu, Pokhara und in anderen großen Städten ist er noch nicht vergleichbar, noch nicht … Einige kleine, schlichte Erlebnisse verdeutlichen wohl besser als lange Erklärungen: Nach dem Essen in einem ländlichen Teashop im Westen Nepals bat ich den Wirt noch um heißes Wasser für meine Thermosflasche. Er füllte einen Topf, setzte ihn auf den Ofen und öffnete nochmals den Hahn der Gasflasche. Dann nannte er den Preis für das Essen. Ich bezahlte etwas mehr wegen der Zubereitung des heißen Wassers. Energisch lehnte er die zusätzlichen Rupien mit den Worten ab: »Nein, nein, wir sind hier nicht in Kathmandu!« Noch weiter westlich, am Ufer des Flusses Seti, traf ich mit meinen Begleitern auf einen Schnapsbrenner. Zum Kochen unseres Mittagessens überließ er uns einen Teil seiner Werkstatt, die Kochstelle und Brennholz und meinte: »Hier zu leben ist am besten. Man muss nicht für jeden kleinen Dienst zahlen und für einen Händler wie mich gibt es nicht so viele Vorschriften.« Er hatte offensichtlich nicht so gute Erfahrungen in der neuen, veränderten Welt gemacht …
Jedenfalls, gleichgültig ob sich Wandel in Nepals Gesellschaft in verschiedenen Regionen rasch oder sehr langsam vollzieht, ist es wohl reizvoll, Vergleiche anzustellen zwischen »damals« und »heute«, so wie es reizvoll ist, auf die Pfade anderer und die eigenen zu blicken.
Landsberg am Lech, im Pferd-Jahr 2014
Einleitung
Ein Kosmos voller Götter, Geister und Dämonen und zahllose Geschichten, die über sie immer wieder erzählt werden, Ursprungsmythen der verschiedenen Stämme, Legenden und Märchen, Riten und Gebräuche, Feste und Prozessionen, Tänze und Gesänge, Beschwörungen, Opfer und Gebete; Sadhus, Yogis und Schamanen, die großen Tempel und kleinen Steinskulpturen, Bildstöcke, Schreine, Butterlampen, Glöckchen und Bilder, die Gebetsfahnen, Manimauern und Chörten am Wege – Oberflächliche könnten meinen, die Nepali seien ein Volk von Träumern und Phantasten, das in einer Art Märchenwelt lebt. Doch man sollte sich nicht täuschen. Die allermeisten Nepali sind »stocknüchtern«, pragmatisch und immun gegenüber Spekulationen, Traumtänzereien und Verrücktheiten, denen sich mit schrecklichen Folgen Utopisten, Magier, Ideologen und ihre großen Gefolgschaften vor allem in der westlichen Hemisphäre der Welt hingegeben haben.
Viele Missverständnisse, Kommunikationsprobleme, falsche Beurteilungen und Vorurteile, Enttäuschungen und Irrwege entspringen dem Zusammentreffen von Realismus und Illusion. Die schlimmsten aktuellen Wunschvorstellungen und Verirrungen müssen, wenigstens in sehr kurzer Form, erwähnt werden, auch um Auswirkungen der Globalisierung auf die nepalische Gesellschaft in Wirtschaft, Handel und Politik, im Tourismus und in der Entwicklungszusammenarbeit verstehen zu können. Westlicher ideologischer Imperialismus verschiedener Ausprägung machte vor Nepal nicht halt.
Da haben wir zum Beispiel die Vorstellung des französischen Philosophen der Aufklärung Marie Jean Condorcet, die Menschheitsgeschichte würde sich mithilfe der autonomen Vernunft der intellektuellen Elite auf einem Pfad des Fortschritts (progrès) zu einem Paradieseszustand der Vervollkommnung von Industrie und allgemeiner Wohlfahrt hinbewegen und alle Gesellschaften würden der Zivilisation und Aufgeklärtheit Frankreichs und Anglo-Amerikas zustreben, vorneweg die Zivilisierten, dahinter die weniger Zivilisierten und Wilden und Letztere würden verschwinden. Das würde die unausweichliche Konsequenz des Fortschritts und freien Handels sein (Esquisse d’un Tableau Historique des Progrès de l’Esprit Humain, 1793). Wie euphorisiert begrüßt und beschreibt Condorcet die anbrechende neue Epoche der Menschheit auf ihrem Weg der Vervollkommnung und zählt Maßnahmen auf, um diese rasch zu verwirklichen. – So wird er mit seiner Vision der vereinheitlichten Menschheit gemäß französisch-angloamerikanischen Normen zu einem geistigen Wegbereiter der Zerstörung anderer Zivilisationen, die in seinem Verständnis allesamt rückständig sind: »Traditionelle« Gesellschaften haben der »Modernisierung« zu weichen.
Der französische Mathematiker und Soziologe Auguste Comte dachte sich als Ziel der Menschheitsentwicklung die glückliche industrielle Gesellschaft herbei unter der wissenschaftlichen Herrschaft von Intellektuellen, Finanzmagnaten und Industriekapitänen. Nach dem theologischen und metaphysischen Zeitalter der geistigen Menschheitsentwicklung sei jetzt das der positiven Wissenschaft angebrochen. Von Belang sei nur noch die Auseinandersetzung mit Sichtbar-Gegebenem, mit Mess- und Zählbarem (Positivismus). Die Beschäftigung mit dem Sinn des Lebens und der menschlichen Natur sei veraltet, überflüssig und nicht zulässig (Système Politique Positive, 1851–1854).2 – Ausgegrenzt sind hiermit alle nicht-industriellen und nicht-matieriellen Betätigungen und somit ein großer Teil der Menschheit, der sich mit ihnen befasst.
Der Beitrag deutscher Philosophen von Hegel über Marx, Nietzsche bis Heidegger war auch nicht geeignet, nüchtern auf Geschichte zu blicken als die Summe guter und schlechter Taten der Menschen. Er war nicht geeignet, Respekt vor anderen Kulturen zu erzeugen und ein allgemeines Bewusstsein vom Unrecht staatlich organisierten Mordens zum Zweck von nationaler Glorie, rassischer Reinheit und klassenloser Gesellschaftsordnung zu fördern. Er diente revolutionären Praktikern als Rechtfertigung für ihr Tun.
Der christlichen Heilsgeschichte bis hin zu ihrem jenseitigen Ziel kann man sich nur im Glauben annähern ebenso wie dem Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit. Das genügte Georg F. W. Hegel nicht. Er zwängte diese Glaubensinhalte in eine innerweltliche Geschichtskonstruktion, in der das jenseitige Göttliche, der »Geist«, sich entwickelt, in dialektischen Schritten zum »Weltgeist« wird und im menschlichen »absoluten Wissen«, d.h. im »reinen Fürsichsein des Selbstbewußtseins« des »reinen Ich« erkennbar wird und sich als »subjektiver Weltgeist« vollendet. Als »objektiver« vollendet er sich im »Staat«. Besonders in den europäischen Imperien eines Caesar, Napoleon und Friedrich II. wird das Walten des Weltgeists vorübergehend sichtbar. Um den dialektischen Vorgang zu unterstützen, empfiehlt Hegel den Regierungen, die Gesellschaft »von Zeit zu Zeit durch Kriege zu erschüttern«, damit das »Ganze nicht auseinanderfalle und der Geist verfliege«. Der »Endzweck« des Geschichtsprozesses ist erfüllt, wenn der Weltgeist vollendet und damit alle Abhängigkeit aufgehoben ist. Dann leben Mensch und Gesellschaft in »absoluter Freiheit«, frei von allen bisherigen Bindungen durch Philosophie und Offenbarung. In der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes von 1807 erklärt Hegel: »Daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaft näher komme, – dem Ziele, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein, – ist es, was ich mir vorgesetzt.« Offenbarung und Philosophie sind das »unentwickelte Einfache«, Ausdruck des »rohen Bewusstseins«. Jetzt, seit der Französischen Revolution und Hegel, »bilden sie die Schädelstätte des absoluten Geistes«. Um seine Konstruktion nicht zu gefährden, scheute sich Hegel nicht, die Geschichte anderer Gesellschaften entweder zu ignorieren oder sie so der europäischen anzugliedern, dass dieser das Privileg erhalten bleibt, Höhepunkt der Entwicklung und Maßstab für außereuropäische Gesellschaften zu sein. – Welch eine Einladung zu Staatshörigkeit, Eurozentrismus und Egomanie! Und welch eine Abkehr eines Philosophen vom Wesen der Philosophie als offener, suchender Wissenschaft, die er durch seine Gewissheit des Wissens und das »System der Wissenschaft« als das Ende und die Vollendung der Geschichte zu ersetzen versucht!
Karl Marx war wie seine Vorgänger und Zeitgenossen, die sog. Frühsozialisten Englands, Frankreichs und Deutschlands, erschüttert vom Arbeiterelend zur Zeit der beginnenden Industriellen Revolution. Er sah alle bisherige Geschichte als Geschichte des Klassenkampfes zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten und propagierte das klassenlose Reich absoluter Freiheit gegründet auf einer vom Menschen organisierten Welt des materiellen Überflusses, »wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat …, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, ohne je Jäger, Fischer oder Hirt … zu werden, wie ich gerade Lust habe«. Nicht Hegels Weltgeist sondern die ständige Verbesserung der materiellen Produktionsverhältnisse bestimmt nun den Fortgang der Geschichte. Dafür ist »eine massenhafte Veränderung der Menschen nötig, die nur in einer praktischen Bewegung, in einer Revolution vor sich gehen kann …, die die Arbeit beseitigt und die Herrschaft aller Klassen und die Klassen selbst aufhebt«. »Der Kommunismus schafft … die wirkliche Basis zur Unmöglichmachung alles von den Individuen unabhängig Bestehenden« und entwickelt sie zu »totalen Individuen«. Dazu gehört auch und im Besonderen die Befreiung von Philosophie und Religion (Die Deutsche Ideologie, 1844; Manifest der kommunistischen Partei, 1848). – Auch hier: Aufruf zu Egomanie des absolut freien, totalen Individuums, das aber – ein riesiger Widerspruch bei Marx – völlig von der Gesellschaft abhängig ist, die ja die materielle Produktion so regelt, dass das Individuum jederzeit tun kann, wozu es gerade Lust hat. Und ferner: Diese intellektuelle Arroganz, welche wider besseres Wissen die ganze Geschichte auf eine Geschichte des Klassenkampfs verengt und Erlösung durch revolutionäre Veränderung des Menschen verspricht; diese Engstirnigkeit, die ausschließlich Stufen des materiellen Fortschritts als relevant ansieht und philosophische und religiöse Einsichten anderer Menschen ausblendet!
Sprachgewaltig verkündete Friedrich Nietzsche, dass Gott nun tot sei, ermordet durch den »Übermenschen«, der sich an seine Stelle setzt. Er ist das Ziel der Menschheit und erscheint immer wieder in »höchsten Exemplaren« wie zum Beispiel als Caesar und Napoleon. Es ist ein Mensch zu entwickeln, der dem Menschen, wie er nun mal ist, übertrifft (Die fröhliche Wissenschaft, 1882; Also sprach Zarathustra, 1883–85; Ecce homo, 1888). – Solche »Philosophie« ist nicht nur selbstverliebte Theatralik, grandiose Vermessenheit und Selbstüberhebung im schriftlichen Werk eines Denkers sondern sie bietet die willkommene Berufungsgrundlage für revolutionärer Praktiker, um den »alten« Menschen durch den »neuen« zu ersetzen. Mit Theatralik und Selbstüberhebung wurde in den Ersten Weltkrieg gezogen, buchhalterisch-industriell durchgeführte Menschenvernichtung folgte im Dritten Reich, um für die »arische Rasse« Raum zu schaffen.
Aus der Wiederkunft Christi, die nur dem Glauben zugänglich ist, wurde im Denksystem Martin Heideggers das innerweltliche Sein, das sich im Seienden zeigt und verwirklicht und zum »Anwesen« und »Dasein« im verstehenden Ich wird, auf das es gerichtet ist. Der Mensch ist der Sinn gebende Grund der Wirklichkeit. Glaube und Philosophie werden durch Wissen ersetzt. Dabei ist Heideggers Sein nicht das jenseitig Absolute, sondern die »Ur-Zeit«, die »sich zeitigende Zeit: das sich je anders zuschickende Geschick«. In diesen Prozess des schicksalhaften Entbergens, Erscheinens und der Ankunft hat sich der Mensch zu fügen und ist aufgerufen, ihn mitzugestalten (Sein und Zeit, 1927; Einführung in die Metaphysik, 1953). – Und Heidegger fügte sich und zwar auch dem nationalen Ausbruch der Rassenideologie als Seinserscheinung. Von 1933–1945 war er Mitglied der NSDAP. Er gehörte zu den Rednern und Unterzeichnern des Bekenntnisses der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat. Der von Vielen zum Denker epochalen Formats emporgehobene Heidegger wirkte in Schrift und Rede mit am arischen »Tausendjährigen Reich«.3
Manche der geschilderten Endzustände kämen von selbst durch Evolution im Ablauf der Zeit, andere würden erreicht durch revolutionäres Tun. Mittlerweile wissen wir: Die Rassenideologie führte geradewegs in die Konzentrationslager, den Orten der »Endlösung«, die das deutsche Volk von allen Übeln befreien sollte; das erträumte Reich absoluter Freiheit endete im Gulag Stalins und auf Pol Pots Killing Fields und unter dem materiellen Fortschrittswahn leiden weltweit Mensch und Natur. Zu keiner Zeit wurde so viel wie im 20. Jahrhundert zerstört und gemordet. Auch das irrsinnigste Produkt technischen Fortschritts, die Bomben, die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden und alles Leben bis zum letzten Baby auslöschten, stammte aus der westlichen Hemisphäre.
Spekulationen und Phantastereien über einen innerweltlichen Glückszustand der Menschheit als Ziel der Geschichte sind den meisten Nepali fremd. Damit befinden sich Hindus und Buddhisten in Gemeinschaft mit abendländischen Denkern, die sich ebenfalls gegen ideologische Verengungen des Denkens verwahrt haben. Die Geschichte der westlichen Hemisphäre beinhaltet nicht nur geistige Verirrungen, Kriege, Mordorgien und Naturzerstörung sondern auch geistige Anstrengungen, welche die Grundlagen schufen für die Formulierung der Menschenrechte und für das Entstehen demokratisch verfasster Gesellschaften. Auch mit diesem Erbe ist die nepalische Gesellschaft in Kontakt, besonders nachdem 1951 die Grenzen für einreisende Ausländer und ausreisewillige nepalische Staatsbürger geöffnet wurden.
Für Platon und Aristoteles kann eine kranke Gesellschaft nur durch die Medizin der suchenden »Liebe zum Guten«, von dem sie sich ordnen lassen muss, geheilt werden. Sie ist allumfassend und betrifft das Göttliche, das Ich und die Mitmenschen. Sie ist Voraussetzung für »politische Freundschaft«, die den Bürgern »das Zuträgliche und Gerechte« zukommen lässt, und für »Eintracht im Gemeinwesen«. Die Denker der klassischen Philosophie, Heraklit, Platon und Aristoteles, waren zudem gefeit vor realitätsfernen Geschichtsspekulationen. Sie verstanden es, die Balance zu halten zwischen den im ganzen Kosmos gültigen Gesetz, dass Entstandenes wieder zugrunde geht und neu entsteht auf der einen Seite und dass in jedem Organismus Kräfte liegen, die auf seine Entwicklung und Vollendung zielen, auf der anderen. Sie nannten diese treibenden Kräfte im Menschen Liebe, Hoffnung und Glaube. Die Balance verhindert sowohl Weltflucht in paradiesische Endzustände als auch romantisch-fatalistische Hingabe an den Lauf der Dinge (Heraklit, Fragmente; Platon, Politeia, Nomoi; Aristoteles, Nikomachische Ethik, Politik).
Polybios der sich mit der Geschichte des griechisch-römischen Kulturkreises von 264–146 vor Christus befasste, kam zum Schluss, dass »Vernunft«, »Gerechtigkeit« und »das Vorherrschen des sittlich Guten« den positiven Zustand einer Gesellschaft hervorbringen, der sich ins Negative wendet, wenn unkontrollierte »Begierden« und »Hass« die Oberhand gewinnen. Um möglichst lange dem »inneren Verfall« einer Gesellschaft vorzubeugen, ist für Polybios Gewaltenteilung und die gegenseitige Kontrolle von Verfassungsorganen unabdingbar (Geschichte, Buch VI).
Niccolo Machiavelli schreibt 1531 in den Discorsi: »Denn die menschlichen Dinge sind immer in Bewegung, sie steigen oder fallen … infolge des Wechsels der Sitten.« »Wenn man den Schatten mehr als die Sonne liebt, ist das der Anfang des Verfalls.« Sollen Gemeinschaften lange bestehen, müssen sie »sich häufig erneuern …, Religion wie sie ihr Stifter gegründet hat und Gerechtigkeit erhalten und die guten Bürger achten und deren Tugenden«.
Henri Bergson spricht von der »geschlossenen und offenen Seele« und entsprechend von »geschlossenen und offenen Gesellschaften«. Erstere sind ausschließlich dem leiblichen Wohl zugewandt und deshalb steril, unfruchtbar und »gleichgültig«, ja »aggressiv« gegenüber den Mitmenschen. Offene Seelen und Gesellschaften dagegen sind charakterisiert durch »Empfangen und Weitergeben von Liebe«. Sie sind deshalb »in Bewegung«, lebendig, schöpferisch und erfinderisch im Überwinden von Schwierigkeiten (Les deux sources de la Moral et de la Religion, 1932).
Für Eric Voegelin ist eine Gesellschaft in guter Verfassung, wenn die Einsicht in die allen Menschen gemeinsame Natur (universal humanity) weit verbreitet ist und die Gesellschaft danach handelt. »Universal humanity« ist charakterisiert durch die menschliche Teilhabe an der materiellen und nichtmateriellen Wirklichkeit bis hin zum Bereich des fragenden Strebens nach dem göttlichen Grund der Existenz, aus dem sie sich ordnen kann. Mit dieser ganzheitlichen Teilhabe sind Bedürfnisse verbunden. Eine Gesellschaft in gutem Zustand ermöglicht deren Befriedigung (Order and History, 1956–2000; besonders Band IV: The Ecumenic Age).
Nach umfangreichen empirischen Studien kam Arnold Toynbee zu dem Schluss, dass Zivilisationsgesellschaften wachsen gemäß ihrer Fähigkeit, auf eine Reihe von äußeren Herausforderungen erfolgreich zu antworten, indem Probleme nicht negiert werden sondern nach Lösungen gesucht wird. Das schließt ein, dass sich eine Gesellschaft selbst als Gegenstand der Herausforderung erfährt. Ohne die Fähigkeit zur Selbstkritik gibt es keine Kreativität, die den Herausforderungen erfolgreich begegnen könnte. Die wachsende Selbstfindung und Selbstbestimmung verlagert sich also vom »Makrokosmos« zum »Mikrokosmos« der Gesellschaft. Nicht abstrakte Ideen oder Gesetzmäßigkeiten sind nach Toynbee die entscheidenden Triebkräfte der Geschichte, sondern das Wirken konkreter Menschen: Deshalb sind für ihren Untergang Zivilisationen selbst verantwortlich. »Sie sterben durch Selbstmord, nicht durch Mord«, wenn dem materiell-technischen Zuwachs nicht ein geistig-moralischer entspricht (A Study of History, 1934–1961). An anderer Stelle begründet Toynbee den Untergang einer Zivilisationsgesellschaft damit, dass sie übermäßig ins Militär investiert und erarbeiteten Wohlstand nicht gerecht verteilt (Mankind and Mother Earth, 1976).
Ganz im Sinne Toynbees schreibt der Nepali Dipak Gyawali: »Gesunde Veränderung bedeutet, dass die Gemeinschaft auf Änderungen natürlicher und menschlich verursachter Faktoren, wie Stress auslösend sie auch immer sein mögen, antworten kann ohne in Verzweiflung zu geraten. Fehlendes Zutrauen, solche Herausforderungen zu bewältigen, führt zu Reaktionen wie Rückzug in Fundamentalismus, ethnische Anpassung, Korruption und Fatalismus. Gesunde gesellschaftliche Systeme ziehen schmerzvolle Veränderungen freiwilligem Selbstmord vor, doch kranke, in ihrer törichten Angst vor der Zukunft, sind gelähmt und unfähig, Initiativen zu ergreifen. Das Ergebnis ist Verkümmerung und Verfall. Zu schnelle Veränderung verschlechtert oft die Situation« (Gyawali, Stress, Strain and Insults, 1992).
Das Geschichtsbild der Nepali gleicht den unzähligen Pfaden in ihrem gebirgigen Land. Es ist ein ständiges Auf und Ab, wobei das Aufwärts bestimmt ist durch tugendhaftes Verhalten und das Abwärts durch unkontrolliertes Ausleben der Leidenschaften. Man kann wohl von einer wellen- oder sinusförmigen Figur der Geschichte sprechen. Individuen, Familien, Sippen, Stämme und die ganze Gesellschaft sind dem ehernen Gesetz von Ursache und Wirkung (karma) unterworfen. Wenn die Mitglieder der Gesellschaft mehrheitlich Gutes tun, dann befindet sie sich in karmischem Aufstieg. Andere Mittel, die dem Menschen zuhanden wären, wie Abkürzungen zu Glück und Unsterblichkeit oder gar einen Automatismus, der zur Vervollkommnung führte, gibt es nicht.
Zwei Symbole stehen für das Geschichtebild des hinduistisch-buddhistischen Kulturkreises: Das »Lebensrad« (samsara, bhavachakra) – bedeutungsgleich mit »Rad des Werdens«, »leidvoller Kreislauf der Wiedergeburt« – ist Sinnbild des Verharrens in Verblendung, Gier und Hass, wodurch der Mensch wie in einem Laufrad gefangen bleibt. Es ist auf unzähligen Darstellungen zu finden. Das Verlassen des Rades wird durch das Glück bringende »Windpferd« (ashvavayu, rlung-rta) symbolisiert, dessen Bild Millionen von Gebetsfahnen tragen. Das Windpferd steht für das menschliche Bestreben, die leidvolle Existenz zu verlassen, was nur durch rechtes Tun (dharma) möglich ist. Es steht aber auch für die Hoffnung und Zuversicht, dass es dafür Hilfe von »außen«, überirdischen Beistand gibt.
Lebensrad
»Das Rad des Werdens ist … eine Darstellung … des leidhaften Wiedergeburtenkreislaufs (samsara), aus dem Befreiung zu finden jedermann bemüht sein sollte … Der grimmige, scharfzähnige Dämon des Todes (mara) hält das Werdensrad in seinen Krallen. Außerhalb des Rades, frei von der Wiedergeburt, stehen der Buddha und der Transzendente Bodhisattva (Avalokitesvara). Mit ausgestrecktem Arm weist der Buddha auf den vollen Mond, um so an die Vollmondnacht … zu erinnern, in der ihm der Weg aus dem Samsara offenbar und er selbst zum ›Erwachten‹ (buddha) wurde. Das Mitleid des Bodhisattva Avalokitesvara durchdringt alle Sechs Reiche, Welten oder Existenzformen der Wiedergeburt. Seine rechte Hand ist in der Gewährungsgeste nach unten ausgestreckt. Sinnfällig verkörpert durch Schwein, Schlange und Hahn jagen sich im Zentrum des Werdensrades die in die Wiedergeburt verstrickenden Leidenschaften Gier, Hass und Dummheit im Kreise. Der an das Zentrum angrenzende Ring deutet in der rechten Hälfte den karmischen Abstieg, in der linken den karmischen Aufstieg an: die beiden Möglichkeiten, zwischen denen jeder zu wählen hat. Die Sechs Reiche, Welten oder Existenzformen, in denen die Wesen je nach Taten und Tatabsichten wiedergeboren werden, sind in den sechs Sektoren des breiten Ringes dargestellt. In jeden der Sechs Reiche ist … Avalokitesvara bemüht, den Wesen dort Erleichterung ihres Loses … zu bringen. Der Außenring symbolisiert … die Stationen des konditionalen Entstehens …«
Hans Wolfgang Schumann, Buddhistische Bilderwelt, 74–81
»Entsprechend karmischer Gesetzmäßigkeit geht keine unserer Handlungen und keiner unserer Gedanken verloren. Jeder hinterlässt einen Eindruck in unserem Charakter, und die Gesamtsumme der so geschaffenen Eindrücke oder psychischen Tendenzen unseres Lebens bildet die Basis für das nächste. Solange aber die Menschen sich nicht dieser Kontinuität bewusst sind, handeln sie nur unter dem Zwang ihrer augenblicklichen Bedürfnisse und Wünsche oder entsprechend ihrer begrenzten Ziele, indem sie sich mit ihrer gegenwärtigen Persönlichkeit und Lebensspanne identifizieren. Auf diese Weise werden sie richtungslos von Existenz zu Existenz geworfen und finden nie eine Gelegenheit, die Kettenreaktion von Ursache und Wirkung zu durchbrechen.«
Lama Anagarika Govinda, Der Weg der weissen Wolken, 184
Die bildliche Darstellung des Lebensrades leitet sich aus den Texten her, wie sie Hindus und Buddhisten geläufig sind:
»Wie er handelt, wie er wandelt, so kommt er nach dem Tode zur Entstehung. Einer der gut handelt, kommt als Guter zur Entstehung, einer der schlecht handelt, als ein Schlechter.«
Upanishaden, BAU 4.4.6
»Die an Genuss und Herrschaft hängen … erlangen niemals die Weisheit der Entschlossenheit und kehren, o Arjuna, auf den Pfad des sterblichen Daseins zurück …«
Bhagavadgita II, 44; IX, 3
»Durch das Nichtverstehen, Nichtdurchdringen von vier Wahrheiten, ihr Jünger, haben sowohl ich als auch ihr diese lange Zeit des Daseins durcheilt, das Dasein durchwandert. Von welchen vier Wahrheiten? Durch das Nichtverstehen, Nichtdurchdringen der edlen Wahrheit vom Leiden, von der Leidens-Entstehung, von der Leidens-Erlöschung und den zur Leidens-Erlöschung führenden Pfad.«
»Von Gier, Hass und Verblendung getrieben, überwältigt und gefesselt wirkt man zum eigenen Schaden, zu des anderen Schaden, zu beiderseitigem Schaden …«
Buddha, nach Nyanatiloka, Das Wort des Buddha, 15, 39
Windpferd
»Dieses Glückssymbol stellt das Windpferd … mit dem flammenden Juwel … dar, das alle Wünsche erfüllt. Die Verbreitung des Wunsches, der allen Wesen Glück bringen soll, wird durch mythologische Tiere betont, welche die Weltrichtungen anzeigen und deren Namen in den Ecken angegeben sind: Tiger, Löwe, Urvogel und Drache. Die heiligen Formeln … gelten der Invokation von Vajrapani, Manjushri und Avalokiteshvara für Kraft, Weisheit und Barmherzigkeit.«
Blanche Christine Olschak / Geshé Thupten Wangyal, Mystik und Kunst Alttibets, 5
»Das Pferd ist Symbol für Glück und Sieg. Es heißt, es könne in den endlosen Himmel fliegen … Der Hengst symbolisiert die Bewegung von der unfreundlichen in die freundliche, von der schlechten zur guten Welt …«
Gyonpo Tshering, An astrological Guidebook for everyday Life, 11, 76
Manchmal ist das Windpferd in blauer Farbe dargestellt.
»Seine blaue Farbe lässt es als eine Manifestation des Adi-Buddha erkennen, der das letztliche Wesen der Wirklichkeit repräsentiert – endlos und ohne Gestalt wie der weite Himmelsraum.«
Bernbaum, Der Weg nach Shambhala, 1884
Die bildliche Darstellung des Windpferdes leitet sich aus den Texten her, wie sie Hindus und Buddhisten geläufig sind:
»Der höchste Urgeist wird erlangt durch Liebe, er, in dem alle Wesen sind, durch den die ganze Welt gemacht.«
»Wer für mich wirkt, mich als sein Ziel betrachtet, mich verehrt, frei von Begierde und ohne Feindschaft gegen alle Geschöpfe ist, der gelangt zu mir.«
»Die Weisen handeln sich mühend um der Menschheit Wohl.«
Bhagavadgita, VIII, 22; XI, 55; III, 25
»Sich dem sinnlichen Genuss … und sich der Selbstkasteiung hingeben, … diese beiden Extreme hat der Vollendete vermieden und den mittleren Pfad erkannt, der … zur Stillung, Durchschauung, Erleuchtung und zum Nirwahn führt. Was aber ist jener mittlere Pfad? Es ist jener edle Achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung.«
»Kein andrer Pfad wie dieser ist’s,
Der zur Erkenntnisreinheit führt.
Drum wandelt diesen Pfad entlang,
Dann wird der Mahr geblendet sein.
Denn wenn ihr diesem Pfade folgt,
Macht ihr ein Ende allem Leid.
Gelehrt hab’ ich den Pfad, erkannt
Wie man vom Stachel sich befreit.
Ihr selber müsst euch eifrig müh’n,
Die Buddhas zeigen bloß den Weg.
Wer diesem folget selbstvertieft,
Wird aus den Banden Mahrs erlöst.«5
Lebensrad und Windpferd – die Symbole aus dem hinduistisch-buddhistischen Kulturkreis sind Ausdruck zeitloser allgemeiner Erfahrung, wie auch die kurzen Ausführungen zu Platon, Aristoteles, Polybios, Machiavelli, Bergson und Toynbee zeigten. Zweieinhalbtausend Jahre nach Buddha schreibt der weit gereiste italienische Journalist und Schriftsteller Tiziano Terzani: »Ich bin zur einzigen Revolution übergegangen, die etwas bringt, nämlich die, die in einem selbst stattfindet. Wozu die anderen führen, siehst du ja. Alles wiederholt sich, immer wieder, denn ausschlaggebend ist letztlich die menschliche Natur. Und wenn der Mensch sich nicht ändert, wenn der Mensch keinen Qualitätssprung schafft, wenn er nicht auf Gewalt verzichtet, auf die Herrschaft über die Materie, auf den Profit, auf seinen Eigennutz, dann wiederholt sich alles bis in alle Ewigkeit.«6
Wie sich Partner im Dialog beeinflussen, so auch Gesellschaften und Kulturen, wenn sie aufeinander treffen. Es ist ein Geben und Empfangen. Seit 1951 wurde Nepal besonders durch westliche Entwicklungshilfe und Tourismus rasch und tiefgreifend beeinflusst, so intensiv, dass nepalische Analytiker immer wieder eine Denkpause fordern. Sie sei zu nutzen, um sich klar zu werden, welcher Art die Beeinflussung von außen wäre und welche Auswirkungen sie auf die nepalische Gesellschaft habe: Will man im Westen entwickelte Ideologien mit ihren Folgen zum Vorbild nehmen oder sich an den Vertretern einer offenen und ganzheitlich orientierten Gesellschaft ausrichten? Nepals westliche Partner haben beides im Gepäck und Angebot. Die Denkpause sei des Weiteren zu nutzen, um sich der selbstverschuldeten Missstände in der Gesellschaft – wovon ausführlich die Rede sein wird – sowie der eigenen ethischen und kulturellen Quellen bewusst zu werden. Herauszufinden wäre, welche der eingeschlagenen und einzuschlagenden Wege dem samsara und welche dem rlung-tra zuzuordnen wären. – Nepal zwischen Lebensrad und Windpferd.
Teil 1
Ngawang Tenzing unterwegs
1974, 1975, 1978, 1983
»… bis wir gelernt haben, Leben und Tod mit jenem Mut zu begegnen, der einzig aus dem Mitgefühl für alle lebenden und leidenden Wesen und der tiefen Einsicht in die wahre Natur aller Erscheinungsformen entspringen kann.«
Lama Anagarika Govinda, Der Weg der weissen Wolken
Nur ein einziges Mal hatte ich bei Ngawang Tenzing eine menschliche Schwäche erlebt. Mit ihm, Norbu Sherpa und Thimphu Sherpa wanderten meine Frau und ich im Herbst 1975 durch das Khumbu-Gebiet zu Füßen des Everest. Unser erster Urlaub in Nepal. Wir hatten die größeren Sherpa-Orte besucht und zwei Fünftausender und zwei Sechstausender bestiegen. Ein wenig beherrschten wir schon das Nepali, aber die Unterhaltung unserer Begleiter fand in der Sprache der Sherpa statt. So erfuhren wir erst später, als Ngawang sich unter Tränen bei uns entschuldigte, was der Grund für seinen Wutausbruch war. Die drei hatten sich offensichtlich lange Zeit geneckt, bis aus Spiel Ernst wurde. Der kleine Ngawang riss plötzlich faustgroße Steine aus der Mauer, die einen Kartoffelacker umgab, und warf sie Norbu und Timphu hinterher. Er schimpfte lauthals und sie rannten davon, die Köpfe hinter Rucksack und Ausrüstungskorb eingezogen, hoffend, dass sie nicht getroffen würden. Ngawang traf niemanden. Doch er war außer sich und konnte sich nur durch die Entschuldigung und sein Weinen wieder beruhigen. – Einige Jahre später erlebte ich, diesmal am Everest selbst, wieder einen in Tränen aufgelösten Ngawang. Doch sie flossen aus anderem Grund. Es waren Tränen der Trauer und totalen Erschöpfung …
Der Tibeter Ngawang Tenzing war von der »anderen Seite des Everest« über den eisbedeckten Nangpa Pass als Flüchtling nach Nepal gekommen und hatte sich in Namche Bazar niedergelassen. Er war beliebt bei den Sherpa wegen seiner Tüchtigkeit und seines Humors. Und er konnte mit Yaks, diesen schönen, nützlichen aber nie ganz ungefährlichen Tieren (s. Kap »Dolpo – Vom ‚Yakland’ nach Dagarjun«), umgehen wie kaum jemand sonst im Khumbu-Gebiet. Aber er war eben kein Sherpa. Auch anderswo dauert es seine Zeit bis Flüchtlinge ganz von der Gemeinschaft akzeptiert werden, oftmals besonders lange, wenn sie sehr tüchtig und erfolgreich sind. Vielleicht hatte der Streit mit Norbu und Timphu darin seine Ursache. Ngawangs Problem war, dass er nicht auffallen wollte, aber eben wegen seiner Tüchtigkeit doch auffiel. Und so wollte er 1974 mit Kurt Diemberger und mir nicht zum Gipfel des Shartse steigen, sondern in einem Hochlager auf dem scharfen Südgrat vier Tage lang auf wenigen ebenen Quadratmetern, umgeben vom Abgrund, auf unsere Rückkehr warten. Der mit der Erstbesteigung eines Siebentausenders verbundene Gipfelruhm erschien ihm gefährlich, das Klettern am gefährlichen Shartse dagegen ganz und gar nicht. Dasselbe wiederholte sich vier Jahre später. Ngawang war ganz offiziell bei der Regierung als Mitglied unserer Expedition registriert. Dennoch scheute er sich lange, mit Kurt Diemberger auf den Achttausender Makalu zu klettern. Er wollte sich auf keinen Fall exponieren und Neidgefühle aufkommen lassen.
Das Zelt unseres vierten Hochlagers am Shartse, diesem wilden östlichen Eckpfeiler des Everest-Lhotse-Massivs, stand unter einer riesigen, weit überhängenden Wechte, die uns vor dem so häufigen Weststurm mit seinen eisigen Schrotgeschossen schützte. Ich hatte dieser Wechte nicht getraut und deshalb vor einer Woche das Zelt etwas weiter oben auf einer blank gefegten, sicheren, doch dem Sturm ausgesetzten Stelle errichtet. Einem Kollegen war dieser Platz aber zu ungemütlich. Er trug das Zelt wieder hinunter und stellte es an die alte Stelle in den Schutz der weit überhängenden Schneemauer. Doch mein Instinkt sollte mir Recht geben. Einige Tage später brach die Wechte auf ihrer ganzen Länge ab und begrub alles unter sich. Der Druck des Eises hatte die Kochtöpfe zu Metallknäueln geformt. Zum Glück befand sich niemand im Lager, als es geschah.
Jetzt, noch vor dem Zusammenbruch des Wulstes war ich mit Ngawang hier. Wir hatten wieder einmal das schwierigste Gratstück unter uns bewältigt. Hinter uns lagen die Passagen, die jedes Mal den Adrenalinspiegel hochjagten: der »schwarze Turm«, ein fast senkrechter Grataufschwung, die »Klosterschwester«, eine weit ausladende Eishaube, der »Götterquergang«, eine schräg aufwärts verlaufende, sehr ausgesetzte Eispassage und der »Büßer«, ein in demütiger Haltung verharrender Eisüberhang. Dank der Wechte, in deren »Schutz« nun das Hochlager stand, vernahmen wir vom Weststurm nur ein dumpfes Brausen, das sich mit dem einschläfernden Summen des Kochers mischte. Von der Welt um uns herum sahen wir nichts, denn in die große Mulde zwischen Shartse, Pethangste und Makalu östlich von uns, legte der Sturm seine Fracht ab: Milliarden von Eiskristallen, welche die Leeseite des Grates in eine einzige milchige Wand verwandelten.
Es war warm und gemütlich im Zelt. Doch wir widerstanden der Versuchung, uns einen Nachmittagsschlaf zu genehmigen. Die bevorstehende elfstündige Nacht wollten wir nicht durch lange Wachphasen und ruheloses Wälzen in den Schlafsäcken noch unbequemer werden lassen. So war es uns recht, als wir auf ein Thema kamen, das uns beide interessierte, ja, das Ngawangs Hiersein erklärte: die Flucht vieler Tibeter nach Nepal und in andere Länder.
Ngawang wurde 1949, im Jahr des hölzernen Drachen, geboren. 1950 fiel die chinesische Armee in Osttibet ein. Einige Monate später befanden sich bereits tausende Soldaten in Lhasa, der Hauptstadt Tibets. Den disziplinierten Soldaten dieser Wochen und Monate folgten Verwaltungsbeamte, Ingenieure, Naturwissenschaftler, Geologen, Anthropologen, Ärzte, Krankenschwestern. Sie bauten Straßen, Staudämme, Wasserwerke, Schulen und gut ausgestattete Krankenhäuser. Doch bald gingen diese Flitterwochen der chinesischen Besatzer mit Tibet zu Ende. Die Regierung wurde entmachtet, das tibetische Militär der chinesischen Armee einverleibt und in den Dörfern folgte der alten harten tibetischen Rechtsprechung die neue der Besatzer: Bessergestellte wurden öffentlich zu Selbstkritik und Selbstbeschuldigung gezwungen. Viele wurden durchs Dorf geschleift, gefoltert und getötet.
Als 1956 die stolzen Khampa Osttibets ihre Waffen abliefern sollten, kam es zum Aufstand. Die Chinesen bombardierten daraufhin Klöster, Dörfer, Bauernhöfe. Alte Leute, Männer und Frauen, Mönche und Nonnen hatten Unmenschliches zu erdulden. Auch die Khampa verübten Gräueltaten an Chinesen und tibetischen Sympathisanten.
1959 breitete sich in Lhasa das Gerücht aus, der junge Dalai Lama wäre von den Chinesen zu einer Theatervorführung eingeladen worden, um entführt zu werden. Zunächst akzeptierte der Dalai Lama die Einladung. Als er aber von den Bedingungen der Chinesen erfuhr, musste er annehmen, es handele sich um mehr als ein Gerücht. Er sollte nämlich ohne seine offizielle Begleitung erscheinen und der Besuch sollte absolut geheim stattfinden. Es kam zu Massendemonstrationen in Lhasa mit dem Ziel, das Oberhaupt der Tibeter zu schützen und seine Entführung unter allen Umständen zu verhindern. Für fast zwei Wochen blockierten tausende Tibeter den Weg zwischen Sommerpalast, in dem der Dalai Lama wohnte, und dem militärischen Hauptquartier der Chinesen, in das er zu der Theatervorführung eingeladen worden war. 5000 tibetische Soldaten legten ihre chinesischen Uniformen ab und brachten sich in Position, um den Sommerpalast zu schützen. Auch das chinesische Militär bereitete sich auf eine gewaltsame Auseinandersetzung vor und feuerte Warnschüsse in den Garten des Palasts. Im Schutze der Nacht und eines starken Sandsturms begann die Flucht des Dalai Lama. Drei Tage später beschossen die Chinesen den Sommerpalast. Es kam zum Aufstand in Lhasa. In drei blutigen Tagen waren 10.000–15.000 Tibeter getötet worden. Die Opferzahl auf chinesischer Seite ist nicht bekannt. Es folgte eine erste Massenflucht in den Süden, der noch von den Khampas kontrolliert wurde und über die Grenze nach Indien. Bis Mitte 1960 waren ca. 60.000 Tibeter nach Indien geflohen. Während der folgenden Jahre, als die Zwangkollektivierung Hunger, Widerstand und Unterdrückung brachte, stieg die Zahl weiter an. Und Ungezählte starben in den Arbeitslagern.
1966 hetzte Mao seine Roten Garden in die Kulturrevolution. Die Vergangenheit sollte ausgelöscht werden durch die Zerstörung der alten Bräuche, Gewohnheiten und Denkweisen. Innerhalb von 10 Jahren wurden über 6000 Klöster zerstört, die heiligen Schriften verbrannt, Statuen verstümmelt bzw. nach China verschleppt; viele Mönche wurden umgebracht oder starben bei der Zwangsarbeit.7
1969 hielten sich ca. 10.000 Flüchtlinge in Nepal auf. Einer von ihnen war Ngawang. Sein Heimatdorf liegt nicht weit entfernt von der nepalischen Grenze, an der Nordseite des Everest. Ngawangs Eltern waren wohlhabend, sie besaßen über dreihundert Schafe und einige Yaks, die ihnen von den chinesischen Eroberern weggenommen worden waren. Der Vater wurde in einem Schauprozess als »Kapitalist« und »Ausbeuter« verurteilt und dann erschossen. Bald darauf starb die Mutter.
Zusammen mit seinem Bruder und zwei Freunden wagte der zwanzigjährige Ngawang den beschwerlichen Weg über den 5716 Meter hohen Nangpa La, einen vergletscherten Pass neben dem Achttausender Cho Oyu. Sie kamen mit ihren Rucksäcken auf der Südseite des Everest, in Namche Bazar an und wurden dort offiziell als Flüchtlinge registriert. Gemäß Verfassung konnten Flüchtlinge erst nach Beherrschen der nepalischen Sprache in Wort und Schrift und nach fünfzehn Jahren Aufenthalt in Nepal die Staatsbürgerschaft erhalten.
Ngawang heiratete die Tibeterin Samde und sie mieteten einen Raum im Erdgeschoß eines Sherpa-Hauses in Namche Bazar. Der Boden bestand aus gestampfter Erde. In der Mitte des Raumes ein Felsen, auf dem der zentrale Stützbalken des Hauses ruhte. In der Ecke ein Bett, in der anderen eine Holzkiste, ein Petroleumkocher und ein paar Blechtöpfe. An der Wand aus Feldsteinen hingen einige Kleidungsstücke. Darunter stand eine alte Nähmaschine. Das war alles. Die neue Heimat der Flüchtlinge. Im Allgemeinen werden im Erdgeschoß eines Sherpa-Hauses die Yaks untergebracht. Doch etwas Besseres konnten sich die beiden nicht leisten.
Ngawang zog aus der Deckeltasche seines Rucksacks die kleine rote »Mao-Bibel«. Sie ist in tibetischer Sprache verfasst. Darin zu lesen sei gut für die Schulung des Denkens, meinte er. Die chinesisch-nepalische Freundschaft müsse man argwöhnisch beobachten; auch in Tibet hätten die Chinesen Brücken und Straßen gebaut, um sich beliebt zu machen; so wie sie das jetzt in Nepal tun, dennoch unterdrücken sie so sehr die tibetische Bevölkerung. Größte Wertschätzung brachte er Edmund Hillary entgegen, der im Sherpaland mithilfe des Himalayan Trust Hospitäler, Schulen und Trinkwasseranlagen baut ohne irgendwelche politischen Absichten.
Ngawang begann mittellos und von ganz unten. Er scheute sich vor keiner Arbeit. Zerlegen eines geschlachteten Yaks ist nicht jedermanns Sache, doch Ngawang bot seine Dienste an. Das Schneiderhandwerk ist in Nepal nicht hoch angesehen. Bei den Hindus gehören Schneider zur untersten Kaste. Ngawang verdiente sich Geld, indem er reparierte und später sogar Daunenjacken fertigte und verkaufte. Dann gelang es ihm, Trekkinggruppen zu begleiten und schließlich für Expeditionen zu den Himalayariesen zu arbeiten. Samde knüpfte Teppiche, strickte und verkaufte an Markttagen chang (lokales Bier) und rakshi (lokaler Schnaps). Dann kam das Töchterlein Rinzing zur Welt, ein süßer Treibauf.
Als wir unsere Expedition zum Makalu vorbereiteten, wohnte meine Frau für ein paar Tage bei Ngawang und Samde. Sie konnten sich inzwischen eine etwas geräumigere Wohnung leisten und einen kleinen Laden dazumieten, den sie zusammen mit Ngawangs Bruder betrieben. Dietlinde beschrieb ihr Erlebnis mit dem kleinen Schalk Rinzing so: »Sie legt den Kopf schief und schaut mich prüfend an, beschließt dann, ich sollte den Tee trinken, der vor mir steht. Sie rührt kräftig darin und schiebt mir den Löffel verkehrt herum in den Mund. – ›Komm her, du musst mal schnäuzen.‹ Rinzing ist in dem Alter, in dem man noch alle Sprachen versteht, knapp eineinhalb Jahre. Sie hält brav die Schnute hin, nimmt mir dann das Taschentuch aus der Hand, um es mir an die Nase zu drücken. Wir schnäuzen uns so lange gegenseitig, bis gewiss nichts mehr drin ist. – Rinzing will spazieren gehen, sie erwischt meinen Zeigefinger und zieht mich durchs Dorf. Unser Auftreten lenkt eine Kinderschar sogar von einer Bonbons verteilenden Trekkinggruppe ab. Die Kinder von Namche sind den Anblick von Ausländern zwar gewohnt, doch scheuen auch hier die Kleinen normalerweise vor den Gesichtern der Helläugigen zurück. ›Ihr habt keine Augen!‹ Oder ›Eure Augen haben keine Farbe!‹ sagen sie. Nicht so Rinzing. ›Das ist doch Nawang Tensings Tochter‹, wundern sich die Dörfler. Unverwechselbar: die wilden Locken, die kurze Nase, der Mund mit den großen Schneidezähnen und der übermütigen Oberlippe. – Auf dem Rückweg sitzt Rinzing auf meinem Arm und zaust meine Haare. Am Abend schreiben wir gemeinsam unsere Erlebnisse ins Tagebuch. ›Tütütü‹, singt Rinzing und malt Striche mit Fingerabdrücken.8
Rinzing, Samde, Ngawang – das Glück der kleinen Familie musste groß gewesen sein. Der Neubeginn in der neuen Heimat war gelungen.
Ngawang war wohl jedem, dem er begegnete, ein leuchtendes Vorbild: Absolute Zuverlässigkeit, unbändiger Einsatz, Genügsamkeit, Geschicklichkeit, Erfindungsgeist und Humor: Diese Tugenden bildeten seine Persönlichkeit. Ich möchte sie beschreiben. Ich bin es Ngawang schuldig. Um nicht Täuschungen der Erinnerung zu erliegen, die ja oftmals Vergangenes verklärt und in zu positivem Licht erscheinen lässt, greife ich dabei auf schriftliche Notizen zurück, die von mir und anderen kurz nach dem Zusammensein mit Ngawang niedergelegt worden waren.
1973 am Dhaulagiri
»Young und Lyman … hielten ein Seminar mit den Sherpa zum Thema Sicherheit auf Gletschern … Wir wollten wissen, welche Grundkenntnisse über den Gebrauch des Seils und über Spaltenbergung vorhanden sind. Wir wussten, dass die Sherpa darin Kenntnisse hatten und wollten herausfinden, welche wir von jedem von ihnen erfahren könnten. Und wir erfuhren. Als Young mühsam das Knüpfen eines Boulinknotens vorführte – ein nützlicher Knoten für Bergsteiger, der aber von Amerikanern nicht oft angewandt wird –, beobachtete Nang Tenzing den Vorgang mit einiger Verwirrung. Er versuchte, Youngs komplizierte Bewegungen zu wiederholen, aber vergebens. Er bat ihn, nochmals den Knoten zu zeigen und war wiederum verwirrt. Er gab kopfschüttelnd das Seil mit dem Knoten an Young zurück. Da leuchtete plötzlich sein Gesicht. Er nahm das Seil und knüpfte in einer einfachen Dreh- und Ruckbewegung denselben Knoten. ›O.K, Sahib?‹ fragte er. Young verbrachte den Rest des Tages mit dem Üben von Nang’s Knoten.«
Andrew Harvard und Todd Thompson, Mountain of Storms, 1974, 93
1974 am Shartse
»Meist bin ich mit ihm (Hermann) und dem unerschütterlichen, immer zu Späßen aufgelegten Nawang Tensing unterwegs, einem fröhlichen Krauskopf … ›Very good shoes, very cold feet‹ (sehr gute Schuhe, sehr kalte Füße) ist eines seiner geflügelten Worte, ebenso wie ›many danger‹ (große Gefahr), wenn er in schwankender Lage im unter den Sturmböen knatternden Zelt Tee kocht … oder ›today many‹ (heute viele), wenn es ihm darum geht, die Anzahl der Darmblähungen der Zeltgemeinschaft zu charakterisieren. Er ist ein goldiger Kerl, absolut zuverlässig, den man beruhigt mit dem Auftrag ins Fixseil hängen kann, irgendwo eine Stufenleiter ins steile Blankeis der Luvseite des Grates zu schlagen. Nawang wird, tausend Meter Abgrund unter sich, fröhlich eine ganze Theatertreppe herauspickeln, singen und hin und wieder auf den Shar-Gletscher in der Tiefe spucken.«
Kurt Diemberger, Gipfel und Gefährten, 2001, 17
1974 am Shartse
»Die große Eiswechte, in deren Schutz das Lager IV am Shartse stand, war auf einer Länge von 50 Metern abgebrochen … Wir hatten stundenlang nach Wertvollem gegraben, fanden immerhin das Zelt und meine kniehohen Rentierpelzstiefel – Nawang: ›Ah, Yeti!‹ –, aber auch Kochtöpfe, zu faustgroßen Knäueln gepresst … Nawang hatte das Zelt wieder aufgerichtet (nach dem Wechtenbruch war der Platz jetzt absolut sicher). Er wollte nicht mit mir und Kurt (Diemberger) auf den Gipfel, sondern hier auf unsere Rückkehr warten, auf fünf Quadratmetern ebenen Schneebodens. Er wollte auch nicht an den Fixseilen hinunter. Angst vor Gipfelruhm und Treue zu uns beiden waren wohl die Gründe für seine Entscheidung (und vielleicht auch Sorge, sein Gipfelerfolg könnte den Neid seiner Mitmenschen im Khumbu wecken) … (Kurt und ich schafften die Erstbesteigung des 7502 Meter hohen Shartse). Am fünften Tag nach unserer Trennung treffen wir wieder Nawang, der einsame Wacht gehalten hatte. Er hatte nur von einer Dose ein wenig gegessen, sich sonst von Tee ernährt! Alle anderen ihm zugeteilten Rationen waren unberührt. Er meinte: ›Ich hatte ja nichts zu tun, darum brauchte ich auch nicht essen, und außerdem weiß man nie, was im Gipfelbereich so alles passiert und in welcher Verfassung eine Gipfelmannschaft zurückkehrt.‹ Nawang ist durch sein Fasten so geschwächt, dass ich beim Abstieg meinen leichten gegen seinen schweren Rucksack tauschen musste.«
Hermann Warth, Tiefe Überall, 1986, 29, 35
1975 im Khumbu
»Wir steuern einen unbenannten Gipfel an, den P 5687. Schönes, leichtes Klettergelände. Dazu ein strahlender, windstiller Tag. Man könnte in Hemdsärmeln gehen. Norbu und Nawang sind übermütig. Immer wieder schallen ›nepalische Jodler‹ zum Khumbu-Gletscher und zu den Trekkern hinunter. Auf dem flachen Felsgipfel genießen wir ein ausgiebiges Sonnenbad in unmittelbarer Nähe von Pumori, Everest und Lhotse. Norbu kocht auf der Gasflamme das Mittagessen, und Nawang, der im Rucksack einige Wacholderzweige heraufgebracht hat, entfacht ein kurzes Freudenfeuer. Oder ist es ein Dankesopfer an die Unsichtbaren, weil alles bisher so gut gegangen war? Plötzlich weckt er uns: ›Here Everest-View-Hotel, dinner is ready!‹ und serviert Norbus köstliche Erbsensuppe mit Luncheon Meat. Ja, das ist Leben!«
Hermann Warth, Tiefe Überall, 1986, 46
1978 im Anmarsch zum Makalu
»Nawang war vor mir mit einem Riesenwargel losgezogen. Jetzt kommt er bergab in der Spur zurückgesprungen, weicht aus und ertrinkt dabei fast im grundlosen Pulverschnee. Hat er etwas vergessen? Als ich den Platz erreicht habe, wo er seine Last abgestellt hat – jetzt sehe ich, dass es eigentlich zwei sind, also 60 kg – schnauft er mit einer Normallast von 30 kg daher. Nawang überholt, setzt ab und schickt sich an, zu dem Riesengepäck zurückzurennen. Er will doch wohl nicht allein 90 kg eine Tagesetappe weiter befördern? ›Nawang, was treibst du denn?‹ – ›Ah, today three load!‹ Was Nawang sich in den Kopf gesetzt hat, tut er auch. (Er selbst wiegt 56 kg.)«
Hermann und Dietlinde Warth, Makalu, 1980, 45
1978 am Makalu zwischen 7500 und 7800 Metern Höhe
»Keuchend bleiben Nawang und Ang Chhopal am von Hans und Nga Temba vor einigen Tagen eingerichteten stattlichen Materialdepot stehen; der bisher so gut begehbare Firn geht über in lockeren, immer tiefer werdenden Triebschnee, der über die Westwand gejagt wurde und sich auf der ruhigeren Leeseite absetzte. Wir hocken uns auf unsere Rucksäcke, etwas Tsampa von der dicken Kugel, ein paar Schluck Tee. Dann gehe ich voraus, schräg aufwärts auf eine steile Schneerinne zwischen einem Felssporn und dem Eisbruch zuhaltend. Eine fürchterliche Plackerei beginnt. Anfangs glaube ich immer, die Schneedecke hält, doch wenn ich mit dem vollen Körpergewicht den Fuß belaste, breche ich wieder ein, Schritt für Schritt, tiefe Löcher hinter mir lassend. 200 m mag ich so gespurt haben, da überholt mich bei einer der vielen Pausen Nawang, das kleine gedrungene Kraftbündel mit dem Kreuz wie ein Ringer. Na ja, Rotationssystem, ganz gut, denke ich. Doch ich täusche mich. Weder Ang Chhopal noch ich können Schritt halten mit der kleinen Maschine da vorne, die sich ohne Unterbrechung förmlich durch den Schnee frisst. Der Abstand zu uns wird immer größer. Ich stehe vor einem Rätsel. Woher hat der Kerl nur die Kraft, Energie, Kondition und Willensstärke? Auch Ang Chhopal schüttelt den Kopf. So ist er, der Nawang. Er weiß ganz genau, wenn eine ganze Expeditionsphase auf dem Spiel steht, die Versicherung eines wichtigen Abschnitts, der Aufbau eines Lagers oder gar der Gipfelversuch. Und er spürt auch, wenn andere einen Kräfteeinbruch erleiden, dann ist er da. Wie jetzt. Unerbittlich kämpft er sich höher, ohne umzuschauen. Schritt für Schritt. Jetzt nähert er sich dem markanten Felsen, und da erst macht er Rast, dreht sich nach uns um. Wohl um 300 m hat er uns abgehängt. Ich möchte jetzt die Führung in der Eisrinne übernehmen, ihn entlasten. Doch Nawang geht einige Sekunden vor mir los und wühlt sich hinauf, einen tiefen Graben reißend …«
Hermann und Dietlinde Warth, Makalu, 1979, 64
1978 am Makalu
»… in mir (Kurt Diemberger) schwebt die bange Frage, ob Nawang, den dieser überirdische Gipfelaufbau des MAKALU so sehr beeindruckt hatte, nicht doch im letzten Augenblick noch angesichts des Gipfels von seinen alten Zweifeln (es war lange Zeit schwer, ihm begreiflich zu machen, dass er auch als Nicht-Nepali vollwertiges Mitglied der ›Internationalen Makalu Expedition‹ war) befallen und nicht hinaufsteigen würde … Meine Sorge ist unbegründet: Nawang blickt zwar empor über die luftige, weiße Himmelsleiter, die über unermesslichen Tiefen zur höchsten Spitze des MAKALU hinaufführt, aber er zögert keinen Augenblick, und während er sich mit dem Pickel an der Schneewand sichert, denke ich: wie rasch er seine Schritte setzt! Aber dann folgt die wohl größte Überraschung dieses Tages, die mich mit Freude erfüllt, für die es keine Worte gibt: Nawang, der noch vor zwei Tagen zu mir gesagt hatte: ›If we get to the summit, you will be very happy – and I some‹ (falls wir den Gipfel erreichen, wirst du sehr glücklich sein, und ich ein wenig) umarmt mich auf dem schmalen Standplatz und sagt mir, wie glücklich er sei.«
Kurt Diemberger, Gipfel und Geheimnisse, 1991, 272f.
1979 am Everest
»Wir, schon im Lager 2, hörten diese Nachricht um 19 Uhr voll Freude: Alle Teilnehmer waren auf den Gipfel gelangt (d.h. auch die zweite Gruppe am 2.10.1979) … Doch die Freude wich der Bangigkeit, je weiter die Zeit vorrückte, denn es waren noch nicht alle vom Gipfel zum Südsattel ins Lager 4 zurückgekehrt. Hannelore (Schmatz), Ray (Genet), Sundare und Ang Jambu Sherpa fehlten. Stündlicher Funkverkehr. Immer die gleiche Nachricht: Sie fehlten! Um 22 Uhr war einer zurück, Ang Jambu. Er berichtete vom Biwak der anderen drei in etwa 8500 Metern Höhe in einer ausgehobenen Schneehöhle … Er hatte vergeblich versucht, Ray und Hannelore zu überzeugen, sich seiner Entscheidung zum Abstieg anzuschließen. Bevor er ging, hatte er noch zwei halbvolle Sauerstoff-Flaschen von dem Platz geholt, wo wir sie im Aufstieg deponiert hatten, und sie zu den dreien hinaufgetragen … Über Funk baten wir drei Sherpa im Lager 3, früh am Morgen den Vermissten mit Sauerstoff-Flaschen entgegenzusteigen … Bei Tagesanbruch sahen wir Nawang Tensing, den Stärksten der Expedition, der bereits viermal in den letzten Tagen mit Last, ohne künstlichen Sauerstoff zu benützen, den Südsattel (7986 m) erreicht hatte, und zwei Sherpa sich die Lhotseflanke hinaufarbeiten. Der Abstand zwischen Nawang und den beiden vergrößerte sich immer mehr. Nawang trug zwei Sauerstoff-Flaschen und musste zudem spuren. Die Sorge um die Verschollenen trieb ihn. In nur drei Stunden bewältigte er einen Anstieg, der sonst gut fünf Stunden dauert. Nach kurzer Rast auf dem Südsattel stieg er mit Til (Tilmann Fischbach) in den zum Südostgrat führenden Hang ein. Doch nach dem ersten Drittel kam ihnen Sundare entgegen, allein, schneeblind, verzweifelt: Ray ist oben im Biwak am frühen Morgen gestorben, Hannelore knapp unterhalb des Südgrates. Sundare war noch am Morgen, wie Ang Jambu am Tag zuvor, zu dem Depot mit den halbvollen Sauerstoff-Flaschen abgestiegen. Für Ray war seine aufopfernde Kraftanstrengung zu spät gekommen, doch Hannelore konnte er so den Südostgrat hinabführen bis zu der Stelle, wo der lange Steilhang zum Sattel hinunterleitete. Dort war dann Hannelores Flasche wieder leer. Nach der fürchterlichen Biwaknacht hatte sie keine Kraft mehr, die wenigen hundert Höhenmeter zum Sattel abzusteigen … Weinend und vor Erschöpfung torkelnd stürzte mir Nawang (nach seiner Rückkehr ins Lager 2) in die Arme. ›Um nur wenige Stunden habe ich die Memsahib verfehlt‹, schluchzte er und machte sich noch Vorwürfe, nicht noch schneller aufgestiegen zu sein!!«
Hermann Warth, Tiefe Überall, 1986, 104–110
1980 am Everest und Lhotse
»Wir (Ngawang und Kurt Diemberger) hatten gemeinsam am Shartse mit Wechten und Schlechtwetter gekämpft, gemeinsam waren wir auf dem Gipfel des Makalu gestanden; Nawang war immer fröhlich und gut aufgelegt, ging, ohne viel Umstände zu machen, direkt aufs Ziel los, und blieb dennoch vernünftig und vorsichtig. Er war religiös und warnte mich, ein zweites Mal den Gipfel des Everest zu besteigen – es sei schon genug, den Buddha einmal gestört zu haben. Sollte ich wirklich dort oben filmen, würde er am Vorgipfel bleiben … Mitten in der Lhotseflanke, wo ich für meinen Filmauftrag zum Südsattel war, piepste plötzlich das Walkie-Talkie … Teresa (Kurts Frau) ist am anderen Ende der Leitung. ›Kurt, brauchst du den Nawang Tenzing jetzt? Der Reinhold (Messner) möchte ihn für den Lhotse haben! Nur für ein paar Tage.‹ Natürlich bin ich völlig überrascht: Was ist geschehen? Aber Teresa erklärt mir den Sachverhalt und dass Reinhold derzeit ohne Sherpa ist … mir ist klar, dass Nawang für Reinhold der beste Mann ist, und so stimme ich zu.«
Kurt Diemberger, Der siebte Sinn, 2004, 289–292
1974 auf dem Pethangtse-Sattel, 6130 Meter
»Nawang Tenzings dunkle Augen unter dem widerspenstigen schwarzen Kraushaar blicken mit einem Ausdruck von nachdenklicher Wehmut auf die schneebedeckten Bergketten vor uns – irgendwo dort hinten ist er auf die Welt gekommen, liegt sein Heimattal … auf der anderen Seite des Everest … Nawang Tenzing ist Tibeter; als vor Jahren die Chinesen kamen und man die Yakherden seines Vaters forttrieb … gelang es ihm, nach Nepal zu flüchten. Dank seines manuellen Geschicks konnte er sich zunächst als Schneider durchschlagen, doch mehr und mehr wurde er wegen seiner unglaublichen Energie, seiner Ausdauer auch noch in größter Höhe … zum gesuchten und angesehenen ›Sherpa‹ für Himalajaexpeditionen. Ich schätze Nawang sehr für seine gerade und offene Art, ja, ich hatte den kleinen untersetzten Krauskopf aus Tibet, der immer guter Dinge war, bald ins Herz geschlossen! Seine unverwüstliche Fröhlichkeit – nach all dem Bitteren, was er erlebt hatte – beeindruckte mich sehr. Nur manchmal, wenn er von der grenzenlosen Weite seiner Heimat sprach, vom unermesslich sich dehnenden Hochland … von wüstenartiger Einöde, von Flächen, die sich plötzlich mit Tausenden von Blumen bedeckten …, dann nahm sein Gesicht diesen Ausdruck an wie jetzt, und seine Augen blickten durch alles hindurch … Einige Male war er für kurze Zeit wieder nach Tibet gegangen, über die Berge.«
Kurt Diemberger, Gipfel und Gefährten, 1990, 9
Ja, Ngawang war auch nach unserer Expedition zum Kangchendzönga 1983 – er war natürlich Mitglied dieses Unternehmens durch die gewaltige Nordwand – wohl einige Male nach Tibet gegangen, doch schließlich zu seinem Verhängnis … Wir trafen ihn nicht mehr. 1984 kehrten wir nach Deutschland zurück. 1986 waren wir für einige Wochen in Nepal und führten mehrere Trekkingruppen des Deutschen Alpenvereins. Dietlinde flog mit der letzten nach Hause. Ich blieb, um mit Ang Chhopal eine Wanderung ins winterliche Solu-Khumbu zu unternehmen (s. Kap. »Unterwegs mit Ang Chhopal«). Da erfuhr ich vom Tode Ngawangs: Er war im Frühjahr 1986 ermordet worden, als er abends in Boudanath zu einer Apotheke ging, um für sein krankes Kind Medizin zu besorgen. Da wurde ihm aufgelauert und sein Leben auf schreckliche Weise beendet. Hintergrund, so hieß es, sei Eifersucht gewesen. Ngawang habe sich mit seiner Ehefrau nicht mehr verstanden und sei nach Tibet gegangen, um eine neue Partnerin zu finden. Das wollte aber ein Tibeter, der in die von Ngawang Erwählte verliebt war, auf keinen Fall zulassen. Ngawang starb mit 37 Jahren.





























