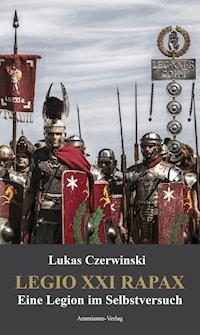
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ammianus-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Keiner aus der Wachmannschaft war jedoch im Zelt. In der abgestandenen Luft war jetzt zusätzlich eine vertraute Note, die Catos Nase als metallisch identifizieren konnte. Ein Blick auf den Boden genügte, um Gewissheit zu erlangen: Es handelte sich um Blut … Faszination römische Armee Dem Autor und Historiker Lukas Czerwinski ist es zu verdanken, dass die XXI. Legion Rapax nach beinahe zwei Jahrtausenden als Selbstversuch wiederauferstanden ist. Die Legionäre und Offiziere "seiner" Rapax fehlen seitdem auf keinem großen Römerevent in Europa. Das Buch verbindet eindrucksvoll die Geschichte und die Organisation mit dem tragischen Schicksal dieser bereits in der Antike legendären Einheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ammianus-Verlag
Der Autor
Lukas Czerwinski wurde am 29.07.1974 in Graudenz geboren.
Seit 1989 lebt er in Deutschland, an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein.
Nach dem Dienst bei der Bundeswehr als Soldat auf Zeit studierte er Geschichte in Polen.
Von Beruf ist er Altenpfleger und Dozent an Schulen und Universitäten.
In seiner Freizeit ist er leidenschaftlich als Römer mit der Legio XXI Rapax unterwegs.
Lukas Czerwinski
Legio Rapax
Eine Legion im Selbstversuch
Historisches Sachbuch
Impressum
Erste Auflage Juli 2017
© 2017 Ammianus GbR Aachen
Alle Rechte vorbehalten. Der Druck, auch auszugsweise, die Verarbeitung und Verbreitung des Werks in jedweder Form, insbesondere zu Zwecken der Vervielfältigung auf digitalem oder sonstigem Wege sowie die Verbreitung und Nutzung im Internet dürfen nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen. Jede unerlaubte Verwertung ist unzulässig und strafbar.
Umschlaggestaltung: Thomas Kuhn Wissenschaftliches Lektorat: Dr. Jörg Fündling, Michael Kuhn (M.A.)Fotos, Zeichnungen, Grafische Darstellungen: Cezary Wyszynski, Karol Rosinski
Printausgabe-ISBN: 978-3-945025-66-6
eBook-ISBN: 978-3-945025-82-6
www.ammianus.euwww.facebook.com/AmmianusVerlag
Danksagung
In erster Linie möchte ich mich beim Verlag dafür bedanken, dass dieses Buch tatsächlich entstanden ist. Die Geschichte, die Bilder und den Text in dieser materiellen Form in den Händen halten zu dürfen, bereitet mir großes Vergnügen. Für mich ist das gedruckte Buch immer noch die schönste Form, Wissen zu verpacken.
An zweiter Stelle will ich allen Menschen danken, die mit mir dieses wunderschöne Hobby teilen und die dazu beitrugen, das Projekt Legio XXI Rapax zu dem zu machen, was man heute in ganz Europa bewundern kann: eine Gruppe von Menschen, die unabhängig von ihrer Nationalität dieselbe Passion teilen und die Zeit finden, sich mehrere Male im Jahr zu treffen. Ohne diese Menschen hätte dieses Buch nicht entstehen können.
Ein besonderer Dank geht an meine Familie: An meine Eltern und meine Frau, die mir stets den Rücken freigehalten haben, damit ich meinen Traum leben konnte.
Zum Schluss möchte ich Krzysztof Laitl für ihren Einsatz ganz herzlich danken.
Auch den Autoren der Bilder, die diese Ausgabe schmücken, möchte ich besonderen Dank und Ehrung für ihren Einsatz aussprechen.
Paweł KurzawskiKarolina HarzCezary WyszynskiLukas Czerwinski
Vorwort
Seit mehr als einer Dekade beschäftigen wir uns im Rahmen des sogenannten Reenactments mit der römischen Armee und der XXI. Legion Rapax im Besonderen. Es sind so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu uns gekommen, dass wir auch zahlenmäßig mit einer römischen Centurie mithalten können. Das verleiht unserer Darstellung ein besonderes Flair.
Die europäischen Initiatoren der Römerdarstellung in England und Deutschland haben bereits in den achtziger Jahren den Weg für eine weltweite Auferstehung der Legionen geebnet. Deshalb können Besucher in den Museen und archäologischen Parks den römischen Streitkräften anlässlich der beliebten Römerfeste in natura begegnen.
Die Qualität dieser Darbietung besitzt eine erstaunliche Bandbreite. Das resultiert aus den oft widersprüchlichen Schriftquellen, der Vieldeutigkeit mancher antiker Bildquellen und einer im Vergleich zu anderen Epochen dünnen Fundlage an militärischen Gegenständen. Das lässt viel Raum für individuelle Interpretationen und Spekulationen, bis hin zu ernstzunehmenden experimentalarchäologischen Projekten.
Dennoch sollte diese Situation nicht dazu verleiten, dem Publikum auf Veranstaltungen etwas zu präsentieren, das eher auf den Produktionen der Filmindustrie als auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht.
Die Legio XXI Rapax verfolgt einen möglichst authentischen Anspruch. Aus diesem Grund brechen wir im Rahmen unserer Darstellung mit einigen Traditionen, die sich über die Jahrzehnte in der Szene manifestiert haben.
Nicht fundierte Interpretationen mögen für Karnevalsveranstaltungen passend sein, haben jedoch in Museen und archäologischen Parks nichts zu suchen.
Die realistische Darstellung eines römischen Soldaten ist eine kostspielige Angelegenheit, da die Ausrüstung in Handarbeit angefertigt werden muss. Die Erfahrung unserer Mitglieder zeigt, dass Massenware aus dem fernen Osten keine Alternative darstellt. Diese aus minderwertigen Materialien hergestellten Gegenstände eignen sich nicht für den Einsatz in der Rekonstruktion.
In der Legio XXI Rapax ist jedoch die persönliche Ausrüstung, die am Mann oder an der Frau getragen wird, noch nicht alles. Die Mitglieder der Gruppe leben die Vergangenheit 24 Stunden am Tag.
Das erfordert eine Unmenge an Ausrüstung, die der Soldat im Lager und auf dem Marsch benötigt. Vom Kochgeschirr über zusätzliche Kleidung und Unterwäsche bis hin zum Schlafplatz müssen die Mitglieder alles aus eigener Kraft stemmen.
Die Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, können durch kein Buch und keinen Film ersetzt werden. Die Freude und Faszination unserer Besucher treibt uns an, unsere Darstellung nach den neuesten Erkenntnissen von Forschung und Wissenschaft immer weiter zu verbessern.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!
Lukas Czerwinski
Die Organisation der Legion
Die Einheiten
In der Zeit zwischen Augustus und Domitian (31 v. Chr. - 96 n. Chr.) unterhielt Rom auf Staatskosten eine Armee von im Schnitt 25-27 Legionen; die Zahl der Soldaten in den Hilfstruppen war etwa gleich groß wie die der Legionäre. Hinzu kamen die Kohorten der Prätorianer, die Stadtkohorten, die Stadtwachen (Vigiles) sowie die Flotte. Insgesamt zählte diese Berufsarmee etwa 280.000 bis 300.000 Soldaten.
Die Hälfte von ihnen diente in den Legionen, deren Soldaten in Verbänden zusammengeschlossen waren, die eine klare Aufteilung und Befehlsstruktur hatten.
Der Name Legion, legio, geht auf den Mythos der Gründung Roms zurück.
Als Legionäre bezeichnete der erste Herrscher (Romulus) die Männer, die er ausgewählt hatte, ihm in den Krieg zu folgen (legere - auslesen).
In der für uns relevanten Zeit stand die gesamte Streitmacht unter dem Oberbefehl des Kaisers.
Eine Legion setzte sich aus folgenden Einheiten zusammen:
LEGION
5240 Soldaten
1. KOHORTE
800 Soldaten
- 5 CENTURIEN
1 CEN. - 160 Soldaten
2. - 9. KOHORTE
1 COH. - 480 Soldaten
- 59 CENTURIEN
1 CEN. - 80 Soldaten
KAVALLERIE / EQUITES
120 Soldaten
4 TURMAE
1 TURMA - 30 Soldaten
12 ALEN
1 ALAE - 10 Soldaten
Innerhalb der Centurie waren die Soldaten in Gruppen zu je acht Soldaten, ein Contubernium, eingeteilt. Die Zahlenangaben spiegeln dabei nur die »Papierstärke« bei durchschnittlich guter Personallage; die Größe der einzelnen Legion konnte stark fluktuieren (zwischen 4500 und 5500), und strikte Vorgaben existierten nicht. An der Spitze einer Gruppe stand ein Decanus.
Die Soldaten eines Contuberniums teilten sich ein Zelt oder einen Raum in der Baracke eines festen Lagers (»Winterlager« – castra hiberna).
Die Hilfstruppen bildeten keine Legionen. Sie waren wie die Prätorianer in Kohorten organisiert (500-800 Soldaten).
Zivilkräfte komplettierten das Gefüge der Legion. Sie ermöglichten den reibungslosen Ablauf des militärischen Alltags.
Hinzu kamen die Zug- und Reittiere wie Pferde, Maultiere und Ochsen, über die akribisch Buch geführt wurde. Neben dem Alter und dem Geschlecht des Tieres wurden auch der Reiter, die Farbe, besondere Merkmale sowie der Preis und das Kaufdatum vermerkt. Ebenfalls wurde festgehalten, ob der Benutzer jemals ein Tier verloren hatte. Jedem Kavalleristen stand ein Helfer (calo) zu Verfügung. Es ist unklar, ob dieser dem Sklavenstand angehörte oder als ziviler Angestellter für die Armee gearbeitet hat. Die Kombination von beidem ist denkbar.
Die große Anzahl an Pack- und Zugtieren wurde von Tierpflegern versorgt, die keine Soldaten waren, aber dennoch in den Legionslisten geführt wurden. Jedem Offizier war ein Diener und jedem Contubernium ein Helfer zugeteilt. Insgesamt benötigte eine Legion bis zu tausend zivile Arbeitskräfte.
Tacitus schreibt dem zivilen Tross eine wichtige, aber auch zuweilen unrühmliche Rolle zu. Er beschreibt die Anzahl der Männer und Frauen, die zusammen mit einer Armee unterwegs waren, als höher als die der Soldaten.
Zugleich betont er die destruktive Kraft dieser Menschen. Sie folgten der Armee in der Absicht, einen möglichst großen Gewinn aus den kriegerischen Handlungen zu ziehen (Plünderungen).
Die Konkubinen der Soldaten mit ihren Kindern, die Prostituierten, Kneipenwirte, Kaufleute, Händler und Handwerker komplettierten die Anzahl derer, die im Umfeld der Armee lebten oder von Militärangehörigen abhängig waren. Einige dieser »Freiberufler« waren ihrerseits Veteranen.
Die Legion bildete einen homogenen Körper mit feststehenden Hierarchien und Rechtsstrukturen, in der sich die Soldaten als Angehörige der römischen Streitkräfte erst einleben mussten, um ihren Dienst im Sinne der Befehlshaber zu erfüllen.
Nach den Quellentexten lassen sich die einzelnen Dienstgrade wie folgt definieren – so gut es das römische Denkmodell erlaubt, das weniger »eindimensional« als moderne Rangordnungen angelegt war.
Die Hierarchie
I
Legatus Legionis
Legionskommandant
II
Tribunus Laticlavius
Oberster Tribun
III
Praefectus Castrorum
Lagerpräfekt
IV
Tribunus Angusticlavius
5 Tribunen in der Legion
V
Primus Pilus
Höchster Centurio der 1. Kohorte
VI
Princeps Prior
Centurio der 2. Centurie
VII
Hastatus Prior
3. Centurie
VIII
Princeps Posterior
4. Centurie
IX
Hastatus Posterior
5. Centurie
X
Pilus Prior oder
Triarius Prior
Höchster Centurio der 2. - 10. Kohorte
XI
Princeps Prior
2. Centurie
XII
Hastatus Prior
3. Centurie
XIII
Pilus Posterior
4. Centurie
XIV
Princeps Posterior
5. Centurie
XV
Hastatus Posterior
6. Centurie
XVI
Aquilifer
Adlerträger der Legion
XVII
Signifer
Feldzeichenträger des Manipels
XVIII
Vexillarius
Standartenträger
XIX
z.B. Optio
Stellvertreter des Centurios
XX
z.B. Tesserarius
Wachhabender Unteroffizier der Centurie
XXI
z.B. Decanus
Gruppenführer
XXII
Miles
Legionssoldat
XXIII
Tiro
Rekrut
Die senatorischen Ränge (I bis II)
Die sogenannten senatorischen Ränge waren Vertretern des Senatorenstandes vorbehalten.
Die Führung einer Legion stellte einen Teil der politischen Karriere auf dem Weg zum Konsul dar. Der Legat war typischerweise Mitte bis Ende 30 und hatte ein Jahr als Prätor verbracht. Das Leben in der Legion kannte er aus seiner Zeit als Tribun. Die allgemein vorherrschende Meinung, dass diese Männer unerfahren und militärisch nicht ausgebildet gewesen waren, ist zu pauschal. Viele Senatsfamilien verfügten über eine umfassende Bibliothek mit militärhistorischer Literatur und private Lehrer, die Kampftechniken und körperliche Ertüchtigung vermittelten.
Der Legat wurde vom Princeps ernannt und unterstand dem Befehl des Provinzstatthalters, der das Oberkommando über die in seiner Provinz stationierten Truppen innehatte. Für den Fall, dass eine Legion in der Provinz stationiert war, war der Legat in Personalunion auch der Statthalter. Anders als die Inhaber der traditionellen Ehrenämter wurde der Legat aus einer der Staatskassen besoldet – worüber man selten sprach. Er blieb zwei bis drei Jahre im Amt.
Der Stellvertreter des Legaten, der Tribunus laticlavius, stand hingegen am Beginn seiner Karriere. Er blieb nur ein Jahr im Amt. Zusätzliche Dienstzeiten waren möglich, aber selten.
Der höchste Tribun war somit der unerfahrenste und jüngste Offizier. Die militärischen und politischen Karrieren waren in der Ständegesellschaft Roms nicht von besonderen Fähigkeiten, Ausbildung, Erfahrung oder Mut auf dem Schlachtfeld abhängig. In erster Linie zählten Geburt und Standeszugehörigkeit. Für Personen ohne den richtigen sozialen Hintergrund waren solche Führungspositionen unerreichbar.
Die Tribunen (III bis IV)
Diese beiden Ränge standen den Mitgliedern des römischen Ritterstandes, equites, mit einem Besitz ab 400.000 Sesterzen offen.
Ritter übernahmen außer den militärischen auch organisatorische und juristische Posten in der Verwaltung des Imperiums. Tribune waren nicht nur mit militärischen Aufgaben betraut, denn sie mussten auch eine Fülle von administrativen Angelegenheiten im zivilen Sektor erledigen.
Der höchste und erfahrenste dieser Offiziere, der Lagerpräfekt, war für Befestigungen, Gebäude und den Sanitätsdienst verantwortlich. Während des Marsches unterstand ihm der Tross, und im Falle einer Belagerung befehligte er die Artillerie und beaufsichtigte den Bau der Belagerungsmaschinen. In vielen Fällen haben während der Kaiserzeit Centurionen dieses Amt ausgeführt, wenn sie ihren Dienst als Primipili beendet hatten.
Die fünf Tribuni angusticlavi befehligten vermutlich je nach Lage eine bis zwei Kohorten. Zudem unterstanden ihnen mutmaßlich die Versorgung, die Standortabsicherung, die Straßenposten, die Kontrollpunkte und die Steuerbehörde.
Den Befehl über die Legionskavallerie hatte wahrscheinlich ein sechster Offizier, der Tribunus sexmenstris, inne, der diesen Posten aber nur sechs Monate bekleidete.
Die Centurionen (V bis XV)
Mit den Centurionen, auch primi ordines genannt, beginnen die Dienstgrade, die theoretisch jeder Soldat erreichen konnte. Für manche stellte der Aufstieg zum Primus pilus den Höhepunkt ihrer militärischen Karriere dar.
Einige antike Autoren beschreiben die Gruppe der Centurionen als das Rückgrat der Armee. Sie übertraf die höheren Dienstgrade an Erfahrung und Mut und entschied oftmals die Schlacht. Bei dieser Darstellung handelt es sich jedoch um einen Mythos. In der Praxis mussten die Centurionen zwar über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, wozu außer umfangreichen Kenntnissen in Verwaltung, Buchführung und Messtechnik auch Mut und körperliche Fitness gehörten, wenn man in der ersten Schlachtreihe bestehen wollte. Es waren aber nicht nur diese Eigenschaften, die für die Postenvergabe entscheidend waren. Wie jede römische Karriere war auch die der Centurionen von der Familie des Kandidaten abhängig. Neben lang gedienten, aus den niederen Rängen aufgestiegenen Soldaten standen Söhne aus dem Dekurionenstand (den Mitgliedern der verschiedenen Stadträte) und Angehörige des Ritterstandes, die praktisch sofort Centurio werden konnten.
Die Legion verfügte über 59 Centurionen. Einige Quellen nennen sogar 60 bis 63. Zu erklären sind diese Zahlen mit Funktionsdiensten im Stab oder anderen Bereichen. Sie führten nicht den Befehl über eine Centurie und wurden als Supernumeralis (überzählige Offiziere) in den Listen geführt.
Der Primus pilus befehligte die Erste Kohorte, die aus fünf Doppelcenturien bestand. Er war der ranghöchste Centurio und nahm an den Beratungen des Stabs teil.
Ein Pilus prior befehligte jeweils eine der weiteren neun Kohorten.
Die übrigen Centurionen führten ihre jeweiligen Centurien, wobei der Hastatus posterior den niedrigsten Dienstgrad dieser Gruppe darstellte. Weil der Dienst in der Ersten Kohorte mehr Prestige und größere Centurien bedeutete, standen ihre fünf Centurionen im Rang über dem der Zweiten bis Zehnten Kohorte.
Die Fahnenträger (XVI bis XVIII)
Die Gruppe der Fahnenträger kann man anhand der Bedeutung ihrer jeweiligen Standarten ordnen. Bei den Feldzeichen gab es solche mit symbolischer wie auch solche mit rein taktischer Bedeutung.
Der Aquilifer war für das wichtigste Symbol, den Legionsadler, verantwortlich. Eingeführt kurz vor 100 vor Christus, unter dem Konsul Marius, symbolisierte er die staatliche Macht, bildete aber auch das Symbol des Kampfgeistes einer Legion und wurde kultisch verehrt. Der Aquilifer rekrutierte sich aus den Reihen der Veterani oder Evocati. Er war ein Soldat, der wahrscheinlich kurz vor seiner Entlassung stand und sich durch besondere Leistungen ausgezeichnet hatte. In seinen Händen lag außerdem die Aufsicht über die Pensionskasse der Legion, in die der Legionär gezwungenermaßen einen Teil seines Soldes einzahlte.
Das Gleiche gilt für den Imaginifer, der das Bild des amtierenden Kaisers trug. Es ist unklar, ob nur die aktuellen Herrscher mitgeführt wurden. Möglicherweise gab es mehrere, einen für jeden zum Staatsgott erklärten Kaiser.
Der Signifer trug ein taktisches Zeichen, das zusammen mit den akustischen Signalen des Cornicens die Truppenbewegungen während der Schlacht und beim Exerzieren koordinierte. In der Regel gab es für einen Manipel (zwei Centurien) einen Signifer. Er war auch für die Auszahlung des Solds und die Führung der Soldatenkonten zuständig. Als Duplicarius empfing er den doppelten Sold, und gehörte der Gruppe der Principales an. In der römischen Armee bezeichnete man so Soldaten, die mit einer Befehlsgewalt ausgestattet waren.
Bei einem Vexillarius ist die Zuordnung umstritten. Das Vexillum war eine Standarte, die eine Einheit ganz unterschiedlicher Größe, eine Vexillatio, kennzeichnete, die zeitweilig aus der Legion herausgelöst worden war. Vermutlich wurde es auch als taktisches Zeichen verwendet.
Die Kavallerie führte an Stelle des Signums ebenfalls ein Vexillum. Mit dem Begriff sub vexill, bezeichnete man im Gegensatz zum normalen Dienst (sub signis) die zusätzlichen Dienstjahre der Veteranen. Möglicherweise wurde das Vexillum also auch einer Einheit von Veteranen vorangetragen. Der Vexillarius empfing ebenfalls den doppelten Sold und gehörte zu den Principales.
Die Unteroffiziere (XIX bis XX)
Auf der Ebene der Centurie gab es Dienstgrade, die dem Centurio zur Unterstützung seiner Aufgaben zur Seite standen.
Der Optio war der Stellvertreter des Centurios. Sein Aufgabenbereich unterschied sich grundsätzlich nicht von dem seines Vorgesetzten. Der Optio konnte den Centurio vorübergehend oder auch dauerhaft ersetzen und seine Aufgaben übernehmen. Im Alltag unterstützte er ihn beim »Papierkrieg«, wie etwa den Berichten über Anzahl und Verwendung der jeweils dienstfähigen Soldaten. Als Principalis empfing er den doppelten Sold. Der Dienstgrad des Optios war nicht nur innerhalb der Centurie vertreten. Auch im Stab, im Funktionsdienst, in den Büros der Tribunen und im Sanitätswesen waren Optiones mit verschiedenen Aufgaben betraut. Eine separate Gruppe bildeten die Optiones, die unmittelbar vor der Ernennung zum Centurio standen. So ein Soldat trug den Rang Optio ad spem und stand als Dienstgrad über dem Signifer.
Der Tesserarius, Wachführer, zählte ebenfalls zu den Principales, bekam aber als Sesquiplicarius nur den anderthalbfachen Sold. Sein Aufgabenbereich bezog sich auf die Einteilung der Wachen und die Ausgabe der Tagesparole, die Tessera. Die Parole und die Tagesbefehle wurden den Empfängern in schriftlicher Form auf einer Tafel übergeben.
Offiziere und Unteroffiziere fungierten nicht nur als Befehlshaber, sondern auch als Ausbilder. Ihre Aufgabe bestand in der Ausbildung an den Waffen, dem Formaldienst, dem Formationsdrill etc. Überliefert sind sie als Campidoctor, Magister campi, Optio campi, Doctor armorum und Exercitator.
Die Mannschaften (XXI bis XXIII)
Die Mannschaften waren keineswegs eine homogene Masse von Männern, die einander völlig gleichgestellt waren.
Der gemeine Soldat, der Miles gregarius, konnte in den unterschiedlichsten Funktionen diverse Dienstgrade und Titel erreichen.
Der Rekrut, der Tiro, befand sich nach der Musterung noch in der Grundausbildung, die in der Regel drei bis vier Monate dauerte. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgte der Schwur, das Sacramentum, auf den Princeps, die Götter, die Vorgesetzten und die Legionsstandarten. Von da an durfte er sich als vollwertiges Mitglied der römischen Armee fühlen. Den Schwur musste er jedes Jahr am ersten Januar erneuern.
In der römischen Armee hatten die Soldaten gleich mehrere Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten, die nicht nur einen leichteren Dienst, einen höheren Sold und militärische Ehren nach sich zogen, sondern auch einen sozialen Aufstieg außerhalb der Armee mit sich brachten. Der Dienst in der Legion war damit ein soziales Sprungbrett, vor allem für den einfachen Bürger.
Die Soldaten der Legion kann man nach modernen Maßstäben drei unterschiedlichen Waffengattungen zuordnen: Infanterie (Pedites), Artillerie (Ballistarii) und Kavallerie (Equites).
Ein Teil der Infanterie kämpfte vor den Standarten (Antesignani) als eine Art Schutzwall für das Feldzeichen. Sie waren nicht so zahlreich wie ihre Kameraden (Postsignani), die sich hinter den Feldzeichen aufstellten.
Die Artillerie setzte sich aus Legionären zusammen, die aus den Kohorten und Centurien zugeteilt wurden. Jeder Soldat konnte von dieser Abstellung betroffen sein, weil der Gebrauch der Geschütze ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung war. Das Kommando über die Artillerie lag in den Händen des Lagerpräfekten.
Die Kavallerie bestand in erster Linie aus Meldereitern und Kundschaftern. Vor der Schlacht gingen sie gemeinsam mit den Plänklern vor und verfolgten nach dem Sieg die fliehenden Feinde. Große Kavallerieattacken wurden von den berittenen Auxiliaren durchgeführt.
Im Alltag besonders wichtig war die Frage, ob ein Soldat als so genannter Munifex alle lästigen Routinepflichten wie Wach- oder Latrinendienst verrichten musste, oder ob er von ihnen befreit war (Immunis). Der Immunis simplaris war ein Soldat, der zwar den Munera entkommen war, aber weiterhin höheren Sold bezog. Gegenüber den Munifices bildeten die Immunes die deutlich kleinere, privilegiertere Gruppe. Unter ihnen wiederum ragten die Principalis heraus, also alle Soldaten, die Befehle erteilten und meist den doppelten oder anderthalbfachen Sold bezogen.
Nochmals deutlich höher lag der Sold eines Centurios.
Innerhalb der Legion gab es zusätzlich einige Personenkreise, die den Tribunen oder dem Präfekten untergeordnet waren und die zu Spezialaufgaben herangezogen wurden.
Die Evocati bildeten eine solche Einheit, die neben dem Praetorium lagerte. Es waren Veteranen, die sich über ihre reguläre Dienstzeit hinaus weiter verpflichtet hatten. Sie galten als loyal und erfahren und erhielten den doppelten Sold. Viele Centurionen rekrutierten sich aus ihren Reihen.
Die Frumentarii waren ursprünglich eine Sondereinheit, die mit der Getreideversorgung betraut war. Obwohl sie in den Legionslisten geführt wurden, hatten einige von ihnen ihre Dienststelle in Rom. Frumentarii wurden teils im direkten Auftrag des Kaisers, teils des Legaten oder der Tribunen als Nachrichtendienst genutzt.
Die Beneficiarii waren eine besonders privilegierte Gruppe. Der Legat und der Statthalter stellten aus jeder Legion einige Dutzend Soldaten für die Wahrnehmung verschiedener hoheitlicher Aufgaben wie Finanzaufsicht, Zivilverwaltung und öffentliche Sicherheit ab. Sie dienten teils im Hauptquartier in der Provinzhauptstadt, teils auf verschiedenen Außenposten. Ein Benefiziarier im Außendienst wurde (vermutlich nach etwa einem Jahr) versetzt, damit keine Korruption einreißen konnte. Da meist nur ein oder zwei Benefiziarier am selben Standort gleichzeitig dienten, war diese gut bezahlte, äußerst unabhängige Verwendung sehr prestigereich.
Anwerbung und Musterung
Der Militärdienst in der Legion wurde während der Kaiserzeit in der Regel von Freiwilligen, den Voluntarii, bestritten, konnte jedoch in Krisenzeiten auch nach einer Aushebung (dilectus) erfolgen.
Bevor ein Rekrut seine Ausrüstung erhielt und zur Grundausbildung zugelassen wurde, musste er sich einer genauen Herkunfts- und Tauglichkeitsprüfung unterziehen, der Probatio.
Das Betreten einer Rekrutierungsstelle der Legion erforderte einige Vorbereitungen, da eine illegale Anmeldung zum Dienst als Verbrechen geahndet wurde.
Grundsätzlich konnte jeder Mann, der römischer Bürger war, also weder Nichtbürger noch Sklave war, von der Pflicht zum Dienst unter den Adlern, dem Stipendium, erfasst werden. Als Soldat (Miles) erhielt er eine Befreiung von den zivilen Pflichten und galt als abwesend in staatlichen Angelegenheiten. Aus mehreren Briefen von Armeeangehörigen und Provinzstatthaltern können wir uns ein ziemlich konkretes Bild davon machen, welche Kriterien ein Probatus erfüllen musste, um die Tauglichkeitsprüfung zu bestehen.
Das Wichtigste war die Klärung der gesellschaftlichen Stellung und des persönlichen Status angesichts des bestehenden Rechts.
In der Korrespondenz zwischen Plinius dem Jüngeren, dem Statthalter von Pontus und Bithynien, und dem amtierenden Princeps Trajans wird deutlich, wie wichtig der rechtliche Status war.
Der Statthalter fragte, was er im Fall von zwei Soldaten unternehmen sollte, die bereits ihren Eid abgelegt hatten und die sich seit einiger Zeit im Dienst befanden, deren Angaben bezüglich ihres Standes jedoch nicht der Wahrheit entsprachen. Es handelte sich nämlich um Sklaven.
Plinius war bewusst, dass die Verheimlichung der Herkunft eine Straftat darstellte. Nur die Tatsache, dass die beiden Sklaven bereits den Schwur abgelegt hatten, verunsicherte ihn und veranlasste ihn dazu, beim Oberbefehlshaber nachzufragen, auf den sie vereidigt waren.
Die Antwort Trajans war eindeutig. Am Tag der Rekrutierung hatte der angehende Rekrut die Wahrheit zu sagen. Dabei war gleichgültig, ob er freiwillig oder unter Zwang zur Armee gekommen war. Der Umstand, dass er bereits den rechtlichen Status eines Soldaten (miles) erlangt hatte, war nicht von Bedeutung. Die Sklaven sollten sofort mit dem Tod bestraft werden. Außerdem forderte der Kaiser die Einleitung einer Untersuchung, um die Umstände der Rekrutierung aufzuklären und die Mitglieder der Einstellungskommission zur Verantwortung zu ziehen.





























