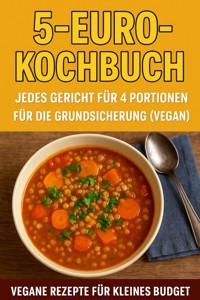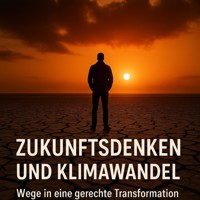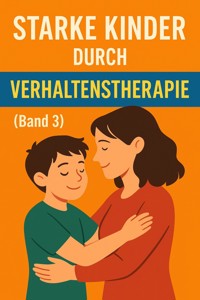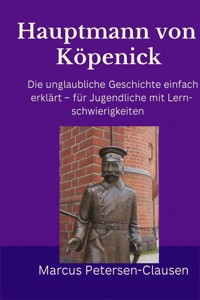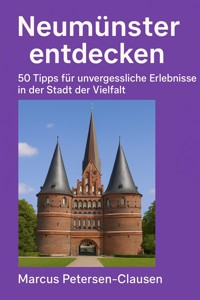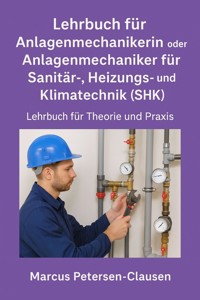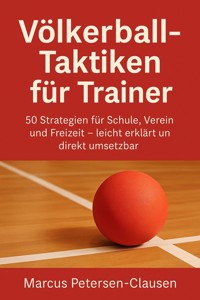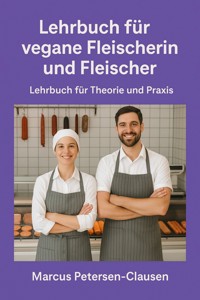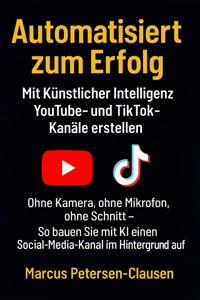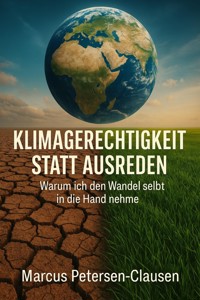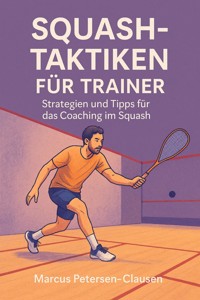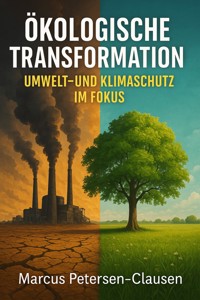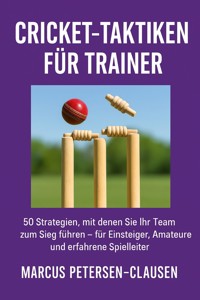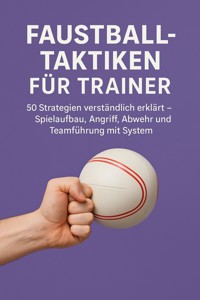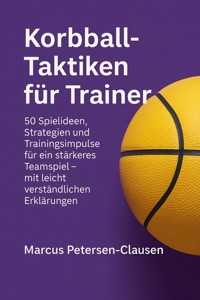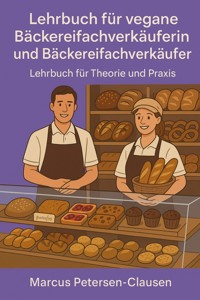
Lehrbuch für vegane Bäckereifachverkäuferin und Bäckereifachverkäufer E-Book
Marcus PC Petersen - Clausen
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dieses praxisnahe Lehrbuch richtet sich an angehende Bäckereifachverkäuferinnen und Bäckereifachverkäufer, die in veganen, glutenfreien und alkoholfreien Bäckereien arbeiten möchten. In klarer, verständlicher Sprache und mit über 49 ausführlichen Kapiteln führt das Buch Schritt für Schritt durch alle wichtigen Themen: von Hygiene über Kundenberatung bis zur Thekengestaltung und Zusatzverkauf. Die Inhalte sind speziell für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten konzipiert und vermitteln sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Handlungssicherheit im Alltag. Jedes Kapitel endet mit zwei alltagsnahen Tipps – aus Theorie und Praxis. Dazu bietet Kapitel 50 insgesamt 100 Prüfungsfragen mit Antworten zur idealen Vorbereitung auf Prüfungen und den Berufsalltag. Achtung: Marcus Petersen-Clausen verwendet zum Erstellen seiner Texte meistens künstliche Intelligenz (und muss das angeben, was er hiermit macht)! Köche-Nord.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lehrbuch für vegane Bäckereifachverkäuferin und Bäckereifachverkäufer
Untertitel:
Lehrbuch für Theorie und Praxis
Vorwort
Herzlich willkommen zu Ihrem neuen Lehrbuch! In diesem Buch begleiten wir Sie auf dem Weg, alles Wichtige über vegane Backwaren und den Verkauf zu lernen. Sie brauchen keine Vorkenntnisse in der Backstube oder im Verkauf. Wir erklären jeden Schritt in leichter, verständlicher Sprache. Sie erfahren, warum jeder Arbeitsschritt wichtig ist und wie Sie ihn ganz praktisch umsetzen. Am Ende jedes Kapitels finden Sie zwei nützliche Tipps: einen zur Theorie und einen zur Praxis. So können Sie alles Gelesene sofort ausprobieren und verinnerlichen.
Viel Freude beim Lernen und viel Erfolg in Ihrem neuen Beruf!
Freundliche Grüße,
Marcus Petersen-Clausen
https://www.Köche-Nord.de
(MITGLIED IN DER PARTEI MENSCH, UMWELT, TIERSCHUTZ - TIERSCHUTZPARTEI.DE)
Haftungsausschluss
Die in diesem Buch enthaltenen Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Weiterbildung. Trotz sorgfältiger Prüfung können inhaltliche Fehler vorkommen. Wir übernehmen keine Haftung für gesundheitliche oder materielle Schäden, die sich aus der Anwendung dieser Anleitungen ergeben. Dieses Buch wurde mit Unterstützung einer künstlichen Intelligenz erstellt. Bitte prüfen Sie alle Angaben eigenverantwortlich und ergänzen Sie bei Unsicherheiten Ihre persönliche Erfahrung oder das Fachwissen erfahrener Kolleginnen und Kollegen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Was ist pflanzliche Ernährung – die Basis für veganes Backen
Kapitel 2: Vegan versus vegetarisch – warum jede Zutat zählt
Kapitel 3: Pflanzliche Mehlarten kennenlernen
Kapitel 4: Verwendung von glutenfreien Mehlsorten
Kapitel 5: Alternative Bindemittel statt Ei
Kapitel 6: Pflanzliche Fettquellen verstehen
Kapitel 7: Zuckerarten und Süßungsmittel in der veganen Bäckerei
Kapitel 8: Milchfreie Produkte und Ersatzstoffe im Detail
Kapitel 9: Schokoladen- und Kakaoführung in veganen Backwaren
Kapitel 10: Die Kunst der Teigbereitung – Mischen, Kneten und Ruhen
Kapitel 11: Sauerteig ansetzen und pflegen
Kapitel 12: Hefeteig vegan zubereiten und formen
Kapitel 13: Glutenfreie Teige richtig verarbeiten
Kapitel 14: Teigruhe und Gärzeiten im Blick behalten
Kapitel 15: Formen und Schneiden von Teigen
Kapitel 16: Backprozesse und Backzeiten
Kapitel 17: Backstubenhygiene und Reinigung
Kapitel 18: Arbeitsschutz und sichere Abläufe
Kapitel 19: Lagerung von Rohstoffen – Frische bewahren und Qualität sichern
Kapitel 20: Haltbarkeit und Verderb erkennen – Sicherheit geht vor
Kapitel 21: Kennzeichnungspflichten für Inhaltsstoffe
Kapitel 22: Nährwertangaben pro Portion
Kapitel 23: Broteinheiten berechnen
Kapitel 24: Allergene und Kennzeichnung
Kapitel 25: Umgang mit Kunden mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Kapitel 26: Warenpräsentation im Verkauf
Kapitel 27: Dekorations- und Anrichtungstechniken für vegane Backwaren
Kapitel 28: Kundenberatung und Verkaufsgespräche mit Herz und Verstand
Kapitel 29: Grundlagen der Verkaufskommunikation – Klarheit schafft Vertrauen
Kapitel 30: Konfliktlösung im Kundenkontakt – Ruhe bewahren und Lösungen finden
Kapitel 31: Preisgestaltung und Kalkulation – Was kostet ein gutes Brot?
Kapitel 32: Bestell- und Nachbestellprozesse – Damit nie etwas fehlt
Kapitel 33: Warenannahme und Qualität prüfen – Der erste Eindruck zählt
Kapitel 34: Kassenführung und Zahlungsabwicklung – Genauigkeit schafft Vertrauen
Kapitel 35: Umgang mit elektronischen Kassensystemen – Technik sicher nutzen
Kapitel 36: Reklamationsmanagement – Beschwerden professionell bearbeiten
Kapitel 37: Hygienevorschriften im Verkaufsbereich – Sauberkeit sichtbar machen
Kapitel 38: Der Aufbau einer Produktbeschreibung – Kundinnen und Kunden mit Worten begeistern
Kapitel 39: Das Frühstücksgeschäft – Schnell, freundlich und gut organisiert
Kapitel 40: Saisonale Aktionen gestalten – Vielfalt schafft Neugier
Kapitel 41: Verkaufsgespräche mit älteren Kundinnen und Kunden – Geduldig, herzlich und klar
Kapitel 42: Vegan und regional verkaufen – Herkunft sichtbar machen
Kapitel 43: Kundenbindung durch Stammkundenpflege – Vertrauen wächst mit Wiedererkennung
Kapitel 44: Brotverkostung organisieren – Probieren überzeugt
Kapitel 45: So präsentieren Sie Ihre Theke – Ordnung, Übersicht und Appetit machen
Kapitel 46: Zusatzverkäufe erkennen und nutzen – freundlich und ehrlich beraten
Kapitel 47: Verkauf bei Wetterumschwung – Angebote anpassen und Stimmungen verstehen
Kapitel 48: Die Arbeit im Team – gemeinsam statt nebeneinander
Kapitel 49: Berufsstolz entwickeln – Warum Ihre Arbeit wichtig ist
Kapitel 50: Prüfungsfragen und Antworten (Teil 1 von 2)
Kapitel 50: Prüfungsfragen und Antworten (Teil 2 von 2)
Nachwort
Kapitel 1: Was ist pflanzliche Ernährung – die Basis für veganes Backen
Die Grundlage jeder veganen Backware ist die pflanzliche Ernährung. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Pflanzlich bedeutet, dass alle Zutaten aus Pflanzen stammen und keinerlei tierische Erzeugnisse verwendet werden. Während in traditionellen Backrezepten Eier und Milch oft unersetzlich erscheinen, lernen Sie hier, welch große Vielfalt an pflanzlichen Alternativen es gibt und wie sie sich geschmacklich und funktional unterscheiden. Stellen Sie sich zum Beispiel eine cremige Pflanzenmilch vor, deren zarte Süße einem Kuchen eine feine Note verleiht. Denken Sie an Nussöle, die mit ihrem kräftigen Aroma den Teig geschmeidig machen und ihm eine besondere Geschmacksnuance verleihen. Oder an Hülsenfrüchte, die Sie zu feinem Püree verarbeiten, um Ei im Teig zu ersetzen und zugleich Proteine und Ballaststoffe einzubringen.
Sie erfahren außerdem, welche pflanzlichen Zutaten besonders reich an wichtigen Nährstoffen sind und warum ihr Einsatz nicht nur gesundheitlich sinnvoll, sondern auch ökologisch von Bedeutung ist. Denn pflanzliche Rohstoffe beanspruchen im Anbau häufig weniger Wasser und Fläche als tierische Produkte. Da dieses Buch zudem komplett glutenfrei ausgelegt ist, lernen Sie, wie Sie Mehle aus Reis, Hirse, Buchweizen oder Mais einsetzen, um köstliche Backwaren herzustellen, die auch Menschen mit Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit begeistern.
Theorie-Tipp: Denken Sie bei jeder neuen Zutat darüber nach, welche Rolle sie im Rezept übernimmt – ist sie vor allem für die Struktur, den Geschmack oder die Bindung zuständig? Notieren Sie Ihre Überlegungen, um ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln.
Praxis-Tipp: Richten Sie eine kleine Verkostungsstation im Verkaufsraum ein, bei der Kundinnen und Kunden verschiedene pflanzliche Mehlarten probieren können. So sammeln Sie direktes Feedback und können später gezielt Empfehlungen aussprechen.
Kapitel 2: Vegan versus vegetarisch – warum jede Zutat zählt
Oft werden die Begriffe „vegan“ und „vegetarisch“ durcheinandergebracht, obwohl sie sich grundlegend unterscheiden. Bei der vegetarischen Ernährung wird auf Fleisch und Fisch verzichtet, während Eier und Milch weiterhin eingesetzt werden dürfen. Vegane Rezepte gehen einen Schritt weiter und schließen sämtliche tierischen Produkte aus. Das bedeutet, dass Sie für veganes Backen nicht nur auf Fleisch verzichten, sondern auch auf Milch, Eier, Honig und Gelatine. Stattdessen setzen Sie pflanzliche Milchalternativen wie Hafer-, Reis- oder Sojadrink ein, deren cremige Konsistenz für saftige Böden sorgt. Anstelle von Honig verwenden Sie flüssige Süßungsmittel wie Agavendicksaft oder Reissirup, die eine feine, dezente Süße verleihen, ohne das Aroma zu dominieren.
Ein ganz besonderes Kapitel ist der Ersatz von Ei. In konventionellen Rezepten sorgt Ei für Struktur, Feuchtigkeit und Volumen. Vegan können Sie diese Aufgaben mit einem Mix aus gemahlenen Leinsamen und Wasser übernehmen oder mithilfe von Johannisbrotkernmehl eine stabilisierende Gelstruktur erzeugen. Sie lernen die genaue Zubereitung: Wie lange muss die Mischung quellen, damit sie ihre bindende Wirkung optimal entfaltet? Und wie variiert das Ergebnis, wenn Sie statt Leinsamen Apfelmus verwenden? Solche feinen Unterschiede beeinflussen Textur und Geschmack, und Sie erarbeiten ein Gespür dafür, welche Alternative für welches Gebäck ideal ist.
Im Verkaufsgespräch ist es unerlässlich, Ihren Kundinnen und Kunden den Unterschied zwischen vegetarischen und veganen Backwaren klar und einfühlsam zu erklären. Sie üben, wie Sie Nachfrage erkennen, Unsicherheiten ausräumen und sowohl Laien als auch erfahrene Pflanzenköstlerinnen und -köstler kompetent beraten.
Theorie-Tipp: Überlegen Sie sich drei häufige Fragen, die Kundinnen und Kunden zu tierfreien Backwaren stellen könnten, und formulieren Sie präzise, leicht verständliche Antworten darauf.
Praxis-Tipp: Führen Sie ein Beratungsgespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen durch, in dem Sie vegan lebende Kundinnen und Kunden gezielt nach Vorlieben und Unverträglichkeiten befragen und passende Produkte empfehlen.
Kapitel 3: Pflanzliche Mehlarten kennenlernen
In der veganen Bäckerei spielt die Wahl des Mehls eine zentrale Rolle, denn Mehl bildet das Gerüst für jede Teigware und bestimmt maßgeblich Geschmack, Textur und Verträglichkeit. Pflanzliche Mehlarten reichen von klassischen Getreidemehlen bis hin zu alternativen Mehlen aus Pseudogetreiden und Hülsenfrüchten. Weizenmehl kennen viele Menschen gut, doch in unserem glutenfreien Konzept nutzen Sie stattdessen Reis-, Mais- oder Buchweizenmehl. Reismehl überzeugt durch seine feine, helle Farbe und einen neutralen Geschmack, während Maismehl mit seinem leicht süßlichen Aroma besonders gut zu herzhaften Gebäcken passt. Buchweizenmehl hingegen bringt eine nussige Note mit, die sich wunderbar mit Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen kombinieren lässt und Broten eine kernige Tiefe verleiht. Hirse- und Teffmehl ergänzen das Spektrum um eine warme, erdige Geschmacksnuance, die besonders in Vollkornmischungen geschätzt wird.
Daneben existieren Mehle aus Hülsenfrüchten, etwa aus Kichererbsen oder grünen Erbsen. Diese Mehle punkten mit einem höheren Proteingehalt und bringen eine angenehme festigende Wirkung in den Teig. Sie eignen sich hervorragend, um Brötchen eine festere Krume zu verleihen und gleichzeitig den Ballaststoffanteil zu erhöhen. Achten Sie jedoch darauf, Hülsenfruchtmehle nur in Anteilen von maximal zehn bis zwanzig Prozent in die Mehlmischung zu geben, da ihr intensiver Geschmack ansonsten dominieren kann. Ergänzend können Sie Mehle aus Nüssen wie Mandeln oder Haselnüssen verwenden, die dem Gebäck eine buttrige Fülle und feine Nussaromen schenken. Solche Nussmehle sind ideal, um Muffins, Kekse oder feine Tortenböden zu verfeinern.
Beim Kennenlernen dieser Vielfalt ist es hilfreich, kleine Probenmischungen anzulegen. Nehmen Sie sich Zeit, jede Mehlart einzeln zu backen und zu verkosten. Beobachten Sie die Farbgebung der Kruste, die Porung des Innenraums und den Nachgeschmack. So entwickeln Sie ein Gespür dafür, welche Mehlkombinationen in welchen Backwaren besonders gut harmonieren. Im Verkauf können Sie dann nicht nur fachkundig beraten, sondern auch gezielt auf Vorlieben Ihrer Kundinnen und Kunden eingehen und Proben anbieten.
Tipps:
Theorie-Tipp: Machen Sie sich zu jeder Mehlart Notizen zu Geschmack, Farbe und Backeigenschaften, damit Sie später die optimale Mischung für verschiedene Produktgruppen zusammenstellen können.
Praxis-Tipp: Richten Sie im Verkaufsraum eine kleine Verkostungstheke mit vier verschiedenen rein pflanzlichen Mehlproben ein und notieren Sie die Rückmeldungen Ihrer Kundschaft zu Aroma und Textur.
Kapitel 4: Verwendung von glutenfreien Mehlsorten
Wenn Sie glutenfreie Backwaren herstellen, ist das richtige Zusammenspiel der Mehlsorten entscheidend, denn Gluten verleiht normalen Teigen Elastizität und Stabilität. Ohne dieses Klebereiweiß müssen Sie andere Wege finden, um eine geschmeidige Teigstruktur zu erreichen und ein gleichmäßiges Aufgehen zu garantieren. Eine bewährte Basis bildet dabei eine Mischung aus mindestens drei Mehlarten: Zum Beispiel Reismehl für Leichtigkeit, Buchweizenmehl für Aroma und Kartoffelstärke für lockere Krume. Ergänzt wird diese Basis häufig durch Tapiokastärke oder Maisstärke, die Feuchtigkeit bindet und den Teig geschmeidig hält. Wichtig ist, dass Sie die Anteile genau abmessen und notieren, denn kleine Variationen können das Backergebnis stark verändern.
Die Kunst liegt darin, die verschiedenen Mehle so zu kombinieren, dass sie einander in Geschmack und Funktion ergänzen. Buchweizen und Reismehl harmonieren meist gut im Verhältnis von 1:1, hinzugefügt wird etwa 20 Prozent Stärke, um die Struktur zu festigen. Gerne können Sie kleine Gruppen von Mehlmischungen anlegen und sie mit Wasser zu einem einfachen Rührteig ohne weitere Zutaten verarbeiten. Anschließend backen Sie dünne Fladen, um zu prüfen, wie elastisch und porös das Ergebnis ist. So erhalten Sie ein direktes Feedback darüber, ob die Konsistenz stimmt.
Auch die Flüssigkeitszufuhr spielt eine Rolle: Glutenfreie Mehle saugen oft mehr Wasser, deshalb ist es ratsam, den Teig flüssiger anzusetzen und ihn während des Ruhens immer wieder leicht zu dehnen und zu falten. Auf diese Weise verteilen sich die Stärken und Mehle gleichmäßig, und der Teig erhält mehr Volumen. Wenn Sie diesen Teig in der Praxis einsetzen, achten Sie darauf, die Ruhezeiten einzuhalten: Mindestens zwanzig Minuten braucht der Teig, um die Feuchtigkeit aufzunehmen und sich optimal zu entwickeln. In der Verkaufsküche kann das bedeuten, dass Sie vorgefertigte Portionen in kleinen Behältern ansetzen und bei Bedarf nur noch zu Brötchen oder Brotlaiben formen und backen.