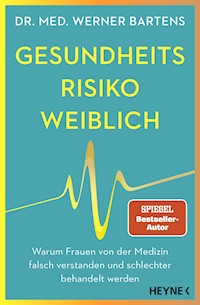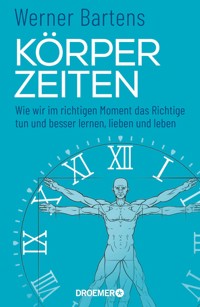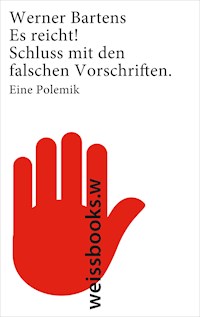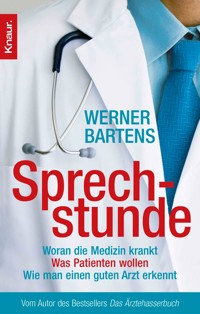29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Aderlässen und Amputationen ohne Narkose zu Gentherapien und Schlüsselloch-OPs – die Medizin hat sich enorm entwickelt. Doch es gibt verblüffende Kontinuitäten und Traditionslinien, die Jahrhunderte zurückreichen. Was macht uns krank? Welchen Einfluss hat die Seele auf unseren Körper? Lässt sich Gesundheit durch den Lebensstil oder die Ernährung aktiv herstellen? Höchst kenntnisreich führt uns Werner Bartens durch die Menschheits- und Medizingeschichte. Lebensnah und manchmal blutig erzählt er von Helden der Medizin, vergessenen Dramen und erstaunlichen Entdeckungen, ohne die die Welt heute anders aussähe. Bartens zeigt, was wir von der Viersäftelehre übernommen haben, wie Schneewittchens Glassarg und der Boom der Obduktionen zusammenhängen und weshalb der erste Herzkatheter, den sich Werner Forßmann 1929 selbst einsetzte, vom großen Chirurgen Sauerbruch ignoriert wurde. Wer unsere heutige Medizin verstehen will, dem eröffnet Bartens ein Panorama, das uns die Ideen und Weltanschauungen hinter der medizinischen Praxis erklärt. Ein ebenso lehrreicher wie kurzweiliger Blick auf die Wissenschaft vom Menschen mit all seinen Ängsten und Nöten, Wünschen und Hoffnungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Werner Bartens
Leib und Seele
Eine Reise durch die Geschichte der Medizin
Über dieses Buch
Von Aderlässen und Amputationen ohne Narkose zu Gentherapien und Schlüsselloch-OPs – die Medizin hat sich enorm entwickelt. Doch es gibt verblüffende Kontinuitäten und Traditionslinien, die Jahrhunderte zurückreichen. Was macht uns krank? Welchen Einfluss hat die Seele auf unseren Körper? Lässt sich Gesundheit durch den Lebensstil oder die Ernährung aktiv herstellen?
Höchst kenntnisreich führt uns Werner Bartens durch die Menschheits- und Medizingeschichte. Lebensnah und manchmal blutig erzählt er von Helden der Medizin, vergessenen Dramen und erstaunlichen Entdeckungen, ohne die die Welt heute anders aussähe. Bartens zeigt, was wir von der Viersäftelehre übernommen haben, wie Schneewittchens Glassarg und der Boom der Obduktionen zusammenhängen und weshalb der erste Herzkatheter, den sich Werner Forßmann 1929 selbst einsetzte, vom großen Chirurgen Sauerbruch ignoriert wurde. Wer unsere heutige Medizin verstehen will, dem eröffnet Bartens ein Panorama, das uns die Ideen und Weltanschauungen hinter der medizinischen Praxis erklärt. Ein ebenso lehrreicher wie kurzweiliger Blick auf die Wissenschaft vom Menschen mit all seinen Ängsten und Nöten, Wünschen und Hoffnungen.
Vita
Dr. med. Werner Bartens ist leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der «Süddeutschen Zeitung». Er gilt als einer der einflussreichsten deutschen Publizisten zum Thema Gesundheit. Seine Bücher «Was Paare zusammenhält», «Körperglück» und «Glücksmedizin» waren «Spiegel»-Bestseller. 2018 erschien «Emotionale Gewalt», 2020 «Lob der langen Liebe», das ebenfalls zum Bestseller wurde und über das die «Welt» schrieb: «Ein gut gelauntes, mutmachendes Buch.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Schlangenillustration Frank Ortmann
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung desposithphotos; Getty Images; Heritage Library
ISBN 978-3-644-01682-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort: Gesundheit – das Schweigen der Organe
Seit es Menschen gibt, haben sie Krankheiten zu ertragen, Schmerzen zu erdulden und körperliche Beeinträchtigungen hinzunehmen. Plötzliches Leid, unerträgliche Pein und unerwarteter Tod sind Teil unserer Existenz. Die Medizin hat seit ihren Anfängen in der Antike bewundernswerte Fortschritte zu verzeichnen und kann mittlerweile etliche Leiden lindern, viele heilen und die Lebensqualität von chronisch Kranken deutlich verbessern. Doch körperliche Beschwerden lassen sich nicht gänzlich wegtherapieren, vielmehr gehören sie zu den Grundbedingungen des Lebens.
Obwohl die Lebenserwartung nie so hoch und der medizinische Standard auf einem so exzellenten Niveau war wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, stand das Bewusstsein für Alterungsprozesse, Schwächephasen und chronische Krankheit sowie das Bedürfnis nach medizinisch-therapeutischer Zuwendung nie so sehr im Mittelpunkt wie zu unseren Zeiten. Befinden, Gesundheit und Wohlergehen nehmen enormen Raum auch außerhalb des professionellen Kontextes der Arztpraxen, Krankenhäuser und therapeutischen Einrichtungen ein. Die Erklärungsmuster wie auch die Praktiken und Gesundheitsideologien sind extrem vielfältig. Von tradierter Selbstbehandlung bis hin zu magischen Ritualen, von Naturbeschwörung und Sternendeutung bis hin zu konventioneller akademischer Heilkunde inklusive Hightech-Medizin ist alles dabei.
Wohlbefinden und Gesundheit werden von Ärzten wie von Laien meist als Gegenteil von Krankheit verstanden. Doch die Grenzen sind alles andere als eindeutig. Gesundheit ist vielmehr ein flüchtiger Zustand der Selbstvergessenheit, der sich – ähnlich wie Liebe oder Glück – nicht herstellen oder erarbeiten lässt. In dem Moment, in dem man ständig in sich hineinhorcht, ob man tatsächlich gesund (oder glücklich oder verliebt) ist, ist man es meist schon nicht mehr. Die Unbeschwertheit macht einem nagenden Unbehagen Platz. Das selbstvergessene, beschwerdefreie Wohlbefinden ist einem Zwischenzustand gewichen: Man fühlt sich nur noch gesund auf Probe.
Klar, man kann etwas für das eigene Wohlergehen tun und die Wahrscheinlichkeit steigern, dass man gesund bleibt. Aber auch Nichtstun kann gesund sein. Nichtstun, nicht daran denken, sich keiner Gesundheitsdoktrin unterwerfen. Eine der schönsten Beschreibungen von Gesundheit stammt von dem französischen Chirurgen René Leriche (1879–1955): «Leben im Schweigen der Organe»[1]. Doch das lassen wir immer seltener zu. Gesundheit und Wohlbefinden müssen mittlerweile systematisch beobachtet und erarbeitet werden, statt einfach vorhanden zu sein. So wird Gesundheit zu einem paradoxen Lebensmotto – ähnlich der Aufforderung: «Sei spontan!» Das ist das Gegenteil von unbeschwerter Selbstvergessenheit, denn das Ziel ist aktives Sichwohlfühlen, um das gerungen werden muss wie um die tägliche Schrittzahl, bis der Fitnesstracker endlich die gewünschten zehntausend anzeigt.
Auch wenn sich Diagnostik, Behandlungsverfahren und Krankheitsverständnis in der Medizin über Jahrtausende weiterentwickelt, verändert und in teils gegensätzliche Richtungen ausdifferenziert haben, gibt es Grundfragen im Verhältnis von Mensch und Medizin, die sich seit jeher kaum verändert haben: Was macht uns krank? Womit lassen sich Schmerzen lindern? In welchem Ausmaß bestimmt die Seele über den Körper? Wie beeinflussen Umwelt, Lebensstil und Ernährung die Gesundheit? Was tun, wenn in uns etwas wächst oder wuchert, was da nicht hingehört?
Um diese ewigen Konstanten in der Menschheits- und Medizingeschichte soll es hier gehen, diese Fragen werden in einem Aufriss quer durch die Jahrhunderte in den Blick genommen, nach Themen geordnet, aber mit chronologischer Etikettierung. Weitere medizinspezifische Spannungsfelder und Themen kommen hinzu: Was verrät der Blick in den Körper? Was kennzeichnet das Verhältnis zwischen Arzt und Patient? Wie grenzt sich die Medizin gegen andere heilkundliche Verfahren ab? Und wie werden die Grenzen des Gesunden, und damit auch des «Normalen», überhaupt definiert?
Die Darstellung weist zwangsläufig Lücken auf, was bei der enormen Themenvielfalt und zeitlichen Ausdehnung unvermeidbar ist. Zudem dominiert der eurozentrische Blick; die Volksmedizin auf anderen Kontinenten und die Entwicklung der Heilkunde und der Gesundheitssysteme dort verdienen eine eigene Schilderung.
In der Geschichte haben sich schon früh Traditionslinien und Denkmuster gebildet, die sich – wenngleich unter anderem Namen und in anderem Gewand – noch in der Medizin von heute wiederfinden, auch wenn die Wurzeln oft Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückreichen. Nebenbei entsteht so ein Überblick über die Ängste, Nöte und Hoffnungen des leidenden Menschen quer durch die Epochen.
So großartig einzelne Persönlichkeiten und Fortschritte in der Medizingeschichte sein mögen, wurde (und wird) teilweise durch neu gewonnene Erkenntnisse der Blick auf den Menschen nicht erweitert, sondern verengt.[2] Das jahrhundertealte Wissen der Medizin um Ernährung, Lebensführung («Diätetik») und um die Bedeutung von Zuwendung und Empathie gerät beispielsweise mit der Verwissenschaftlichung der Medizin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Hintergrund und wird erst Jahrzehnte später wiederbelebt – manchmal allerdings als «ganzheitliches» Geraune an den Grenzen zur Esoterik.
An historischen Fakten entlang erzählt dieses Buch die Geschichte von Helden und Opfern der Medizin, von teils namenlosen Patienten, aufopferungsvollen Ärzten und erstaunlichen Entdeckungen, ohne die die Welt und die Heilkunde heute anders aussehen würden. Wichtig sind dabei vor allem die Ideen, Ideologien und Weltanschauungen hinter der jeweils populären Praxis. So entsteht eine facettenreiche Geschichte über eine Wissenschaft, die den Menschen zum Gegenstand hat und ihn doch vor lauter Detailverliebtheit manchmal aus den Augen zu verlieren droht.
1.Begegnungen und Beziehungen, Halbgötter und Henker
Wer heilen durfte, wer schneiden musste, woran ein Arzt zu erkennen ist und wie man den richtigen Ton trifft
Kommt ein Mann zum Arzt … Was der klischeehafte Beginn von Medizinerwitzen ist, war in der Geschichte der Heilkunde längst nicht immer selbstverständlich. Das heutige Setting – Patienten suchen eine medizinische Praxis auf, der Arzt empfängt sie in seiner Sprechstunde – ist sogar vergleichsweise jung. Irgendwann aber hat alles seinen Anfang genommen, haben sich die Menschen nicht mehr nur an ihre nahen Angehörigen gewandt, wenn sie Schmerzen hatten, verletzt waren oder anderes Leid erdulden mussten. Irgendwann wurde die Suche nach Rat und Hilfe ausgelagert: zunächst an erfahrene Heiler oder «weise Frauen», die zumeist in der gleichen Siedlungs- oder Lebensgemeinschaft heimisch waren wie die Kranken. Dann sprach es sich herum, wo jene Kundigen zu finden waren, die Krankheiten lindern und womöglich gar heilen konnten. Der Stand der Heilkundigen bildete sich heraus, auch wenn es lange dauerte, bis das Berufsbild des Arztes definiert und gefestigt war. Von den notorischen «Halbgöttern in Weiß», von denen in unseren Tagen sowohl anerkennend als auch despektierlich gesprochen wird, konnte lange nicht die Rede sein. Der soziale Status des Heilers unterlag im Laufe der Geschichte etlichen Schwankungen, und nicht immer war der Heilberuf mit hohem Prestige verbunden. Skepsis und Medizinkritik aus der Gesellschaft begleiteten die Ärzte von Anfang an, das Rollenverständnis prägte sich auf beiden Seiten erst nach und nach aus.
Barbiere und Bader, Heiler und Henker
Dass die meisten Unfälle im Haushalt passieren, davon ahnten die Menschen in der Antike noch nichts. Solche Missgeschicke waren kaum der Rede wert. Zudem war das ärztliche Leistungsspektrum seinerzeit noch stark eingeschränkt. Es gab keine geregelte medizinische Ausbildung, demnach auch weder Kardiologen, Urologen, HNO-Ärzte noch andere Spezialisten. Man muss sich als damals dominierende Facharztrichtung den «Arzt für Kriegs- und Jagdfolgen» vorstellen. Zumindest in Homers (wahrscheinlich 8. Jahrhundert v. Chr.) großen Epen, der «Ilias» und der «Odyssee», waren es ausschließlich Wunden und andere im Kampf erlittene Verletzungen, die einer Behandlung bedurften. Es ging vor allem um medizinische Notfälle, die sich die antiken Helden in kriegerischen Auseinandersetzungen oder auf der Jagd zuzogen.
Andere Leiden und Beschwerden fasste man hingegen oft gar nicht erst als medizinisch relevante Fälle auf. Sie wurden als Einschränkungen oder Behinderungen verstanden, die entweder einer Laune des Schicksals entsprangen oder eine von den Göttern gesandte Strafe waren. Gegen beides war demzufolge auch kein Kraut gewachsen – nicht etwa, weil es keine Abhilfe gegeben hätte, sondern weil man diese Beschwerden akzeptierte und als selbstverständlich hinnahm, statt sie durch menschliches Handeln lindern zu wollen.
Die ersten Ärzte waren Heiler, die Erfahrungswissen angesammelt hatten und die man in der eigenen Gemeinschaft aufsuchte. In den frühen, antiken Quellen ist ansonsten vor allem von Heilkundigen die Rede, die entweder inmitten des Getümmels auf dem Schlachtfeld oder hinter den Frontlinien Erste Hilfe leisteten und Wunden verbanden oder heilsame Kräuter und Tinkturen auftrugen. Antike Waffen wie Schwert, Pfeil, Lanze und Keule führten zwar nicht zwangsläufig zu tödlichen Verletzungen, doch die Wunden waren oft tief und blutig, infizierten sich häufig und verteilten sich besonders über Kopf und Rumpf – sofern man nicht gerade eine überempfindliche Achillesferse hatte.
Zwar gab es immer wieder Bemühungen, die medizinische Ausbildung zu regeln, doch zumeist wurden die heilkundlichen Fähigkeiten von erfahrenen Meistern an ihre Schüler weitergegeben, ohne dass es dafür notwendigerweise einen geregelten Lehrkanon gab. Hatte ein medizinischer Novize genügend Kenntnisse angesammelt, trennte er sich von seinem Lehrer und versuchte den Beruf auf eigene Faust auszuüben. Als Schüler eines berühmten Medicus konnte man zwar zunächst auf dessen Ruf aufbauen, musste sich aber bald selbst behaupten.
An manchen Orten wurde das Wissen der Heilkundigen gesammelt und von ihnen weitergegeben. Das antike Heiligtum des Asklepios auf der griechischen Insel Kos enthielt eine frühe Medizinschule, ebenso gab es die Schule von Knidos und die Alexandrinische Schule, doch die im 10. Jahrhundert entstandene Ärzteschule von Salerno gilt als erste allgemeine Ausbildungsstätte für Mediziner in Europa. Besonders in den Jahren zwischen 1100 und 1180 wurden in der Kleinstadt südlich von Neapel die Grundlagen für die Medizin des Mittelalters gelegt. Hier wurde die auf den antiken Schriften von Hippokrates und Galen beruhende scholastische Medizin begründet und ein hauptsächlich auf theoretischen Studien aufbauender Lehrplan erstellt. Im Jahr 1225 verlieh der Stauferkaiser Friedrich II. (1194–1250) der Hochschule universitätsähnliche Privilegien und schuf Regularien für die Ausbildung von Ärzten, die als eine frühe Approbationsordnung angesehen werden können. Friedrich II. war an den Wissenschaften und Künsten interessiert und baute das Medizinstudium 1240 weiter aus. Er erließ eine Verordnung, die Unterricht in Logik, Medizin (inklusive Anatomie und Chirurgie) und Arzneimittelkunde sowie ein einjähriges Praktikum bei einem Arzt vorschrieb.
Mittelalterliche Darstellung der Schule von Salerno, die als älteste Medizinschule Europas gilt. Von ihr gingen entscheidende Impulse für die Medizin aus.
Trotz dieser Professionalisierung der Ausbildung in Salerno und an den bald darauf anderswo entstehenden Medizinschulen und Universitäten blieb es bis ins Mittelalter und die frühe Neuzeit hinein uneinheitlich geregelt, wer an Patienten Hand anlegen und Verletzte oder Kranke versorgen durfte. Grundsätzlich unterschieden wurde die Behandlung «innerer» und «äußerer» Leiden. Für die inneren Leiden waren die studierten «Physici» oder «Medici» zuständig. Sie hatten vor allem Empfehlungen zur gesunden Lebensführung sowie Arzneimittel und Kräutermischungen zu bieten. Ansonsten blieben ihnen die Allheilmittel Aderlass, Abführen und Ausbrennen, die sich aber bereits mit der «äußeren» Medizin überschnitten.
Um die Behandlung der äußeren Leiden, die chirurgisch angegangen werden mussten, gab es erhebliche Konkurrenz. Sie waren oft akuter und dringlicher zu versorgen als Beschwerden im Inneren des Körpers, die trotzdem über Jahrhunderte als der Kern der Medizin galten und die Ausbildung an den Universitäten bestimmten. Allerdings umfassten die chirurgischen Tätigkeiten ein größeres medizinisches Feld, fielen doch mindestens die heutigen Fächer der Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie, Urologie, Augenheilkunde, Dermatologie und Zahnheilkunde darunter.
Aufgrund der Trennung von äußeren und inneren Leiden waren Chirurgen bis weit in die Neuzeit zumeist keine ausgebildeten Ärzte, sondern Handwerker. Sie boten ihre Dienste in Ergänzung zu oder im Wettbewerb mit dem studierten, medizinischen Stand der Medici an, der sich vor allem auf Rezepturen, Ratschläge und nicht invasive Tätigkeiten wie die Harnschau oder die Anleitung zum Einlauf beschränkte. Den handwerklich geschulten Praktikern ohne geregelte Ausbildung standen also die Theoretiker von den Medizinschulen und Universitäten gegenüber; Können und Wissen klafften in beiden Lagern oft auseinander.
Das mal blutige, mal kraftraubende chirurgische Handwerk wurde hauptsächlich von «körpernahen» Berufen, darunter jenen der Barbiere, Bader, Zahnbrecher und Wundärzte ausgeübt. Beim Haareschneiden, Baden und Zähneziehen fielen ihnen schlecht verheilte Wunden, Eiterbeulen und Abszesse auf, die sie gleich zu kurieren versuchten. Dennoch waren diese Berufsgruppen nicht so geachtet wie die ausgebildeten Doktoren, obwohl sie durch ihre praktische Erfahrung oft bessere Fachkenntnisse und mehr feinmotorisches Geschick besaßen als die Mediziner. Barbier zu sein galt gar als unehrenhafter Beruf, zu dem es anfangs lediglich gehörte, den Kunden Bart und Haare zu schneiden. Allerdings durften die Vorgänger der heutigen Friseure einen Aderlass vornehmen, was bemerkenswert ist für einen Berufsstand, der ansonsten lediglich für die Haarpflege zuständig war, denn die Venen zu punktieren und Blut abzulassen, ist immerhin ein invasives Verfahren. Viele der Barbiere wagten sich sogar an kleinere chirurgische Eingriffe heran und operierten damit buchstäblich in einer standesrechtlichen Grauzone.[3]
Ähnliches galt für die Bader, die den Menschen bei der Körperpflege behilflich waren und deren Aufgaben sich heute mit den Berufsfeldern der Bademeister, Masseure und Fußpfleger überschneiden würden. Auch sie waren darüber hinaus in die Haut- und Wundversorgung eingebunden. Dem Volk war der Bildungsweg der Behandler zumeist egal. Wer heilte, hatte recht. Und wer besser heilte, wurde beim nächsten Mal als Erster gefragt.
Der Konkurrenzkampf zwischen den Barbieren und den studierten Medici, von denen sich einige der Chirurgie widmeten, zog sich über Jahrhunderte hin, wobei die Barbiere anfangs die Oberhand behielten, weil sie zahlenmäßig überlegen und gut organisiert waren.[4] Das änderte sich im 16. Jahrhundert. In England beispielsweise schlossen sich 1540 die Gilden der Chirurgen und der Barbiere in London unter Heinrich VIII. (1491–1547) zu einer gemeinsamen Vereinigung zusammen, der United Company of Barbers and Surgeons. Innerhalb dieser ersten Standesorganisationen wurde versucht, die Ausbildung zu vereinheitlichen und die Kompetenzen festzulegen.
Diverse Dekrete von örtlichen Behörden oder gar dem englischen König regelten penibel die Befugnisse der in Gilden organisierten medizinischen Praktiker – und wer diese Art von Tätigkeit keinesfalls ausüben durfte. So wurde ihnen gestattet, vier Leichname von hingerichteten Straftätern jährlich zu sezieren, um ihre Anatomiekenntnisse aufzufrischen. Zudem erhielten sie jetzt offiziell die Erlaubnis, äußere Manipulationen am menschlichen Körper vorzunehmen, also beispielsweise Wunden zu versorgen, Gelenke einzurenken und Hautleiden zu behandeln. Hexerei und Zauberei waren den «Barbers and Surgeons» wiederum strengstens untersagt, das wurde ausdrücklich betont. In London mussten zur beruflichen Eignung Prüfungen vor einer Kommission abgelegt werden; die Zulassung nahmen anschließend der Bischof oder der Dekan der St Paul’s Cathedral vor.
Der Beruf wurde institutionalisiert und professionalisiert und gewann damit an öffentlichem Ansehen. Ausgeschlossen von der Praxis der Barbiere und Chirurgen waren andere Handwerker, etwa Weber und Schmiede, sowie Frauen. Dennoch gab es auf dem Gesundheitsmarkt auch weiterhin eine Vielzahl von Anbietern, die weder studiert hatten noch anderweitig gut ausgebildet waren. Als Patient traf man mit Glück auf einen erfahrenen und geschickten Heiler – konnte aber auch ebenso gut in die Hände eines sich selbst überschätzenden Stümpers geraten.
Regeln zur Berufsordnung gab es bald auch außerhalb von England, beispielsweise war in der Nürnberger Medizinalordnung von 1592 festgelegt, dass die Wundärzte und Barbiere Patienten nicht «mit innerlichen Arzneimitteln» behandeln durften, sondern sich im Wesentlichen auf Verbände und Aderlass zu konzentrieren und «bei gefährlichen Verwundungen» verpflichtend einen «richtigen», also einen studierten Arzt hinzuzuziehen hatten.
Es war üblich, dass die Barbiere und Wundärzte zusätzlich als sogenannte Starstecher tätig waren. Bei einer Linsentrübung, dem grauen Star, etablierte sich schon in der Antike und im Mittelalter eine vergleichsweise einfache Behandlungsmethode: Mithilfe einer Sonde oder einer speziellen Nadel wurde die nicht mehr transparente Linse nach unten gedrückt. Im Anschluss an den Eingriff verbesserte sich das Sehvermögen oft schlagartig wieder. Diese Form der Therapie hielt sich lange; erst um 1710 setzte sich ein anderes Vorgehen durch, auch wenn die ältere Behandlungsform weiterhin Bestand hatte: Die getrübte Linse wurde fortan nicht mehr verschoben, sondern mithilfe einer Lanzette, einer Art kleinem Skalpell, aus dem Auge entfernt.[5]
Teilweise gehörten die Starstecher oder «Okulisten» zum fahrenden Volk, hatten keine geregelte Ausbildung durchlaufen und boten ihre Dienste auf Messen und Jahrmärkten an. Allerdings gab es unter ihnen auch Scharlatane und Kurpfuscher, die ihr Handwerk nicht verstanden. Es ist ungewiss, wie viele Menschen nach einem unsachgemäßen Eingriff ihr Augenlicht verloren oder mit hartnäckigen Infektionen zu kämpfen hatten, die ihre Sehkraft gefährdeten. Der angesehene Dresdner Wundarzt Georg Bartisch (1535–1607), der ein Lehrbuch mit dem einprägsamen Titel «Ophthalmodouleia. Das ist Augendienst» verfasst hatte, wetterte gegen die «losen Vetteln, Zahnbrecher, Ratten und Meusemenner, Spitzbuben, Kesselflicker und anderes leichtfertiges und unnützes Gesindel», das sich «alles dieser edlen Cur aus grosser vermessenheit und Frevel vorsetzglich anmasset und unterstehet» und nicht mit der notwendigen Sorgfalt an die Arbeit ging.[6]
Ein weiterer häufiger Eingriff sowohl der nicht studierten Wundärzte als auch der Chirurgen war die Amputation. Hände, Unterarme und Unterschenkel wurden abgeschnitten, sobald eine größere Wunde oder Quetschung im Bereich der entsprechenden Gliedmaße nicht ausreichend versorgt werden konnte. Verletzungen im Alltag und während der Arbeit konnten der Grund dafür sein, zudem führten Kriege den Heilkundigen immer wieder neue Patienten für diese Art des Eingriffs zu.[7]
Mit der rabiat anmutenden Methode der Amputation sollte verhindert werden, dass Infektionen, Fäulnis und Mangeldurchblutung andere Organe in Mitleidenschaft zogen. Die Vorsicht war durchaus berechtigt, denn sobald sich aus einer infizierten Wunde eine Blutvergiftung entwickelte und auf den gesamten Organismus übergriff, sank die Überlebenschance der Patienten rapide. Das Risiko war beträchtlich: Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts starben mehr Soldaten an Wundinfektionen als an ihren ursprünglichen Verletzungen.[8]
Allerdings waren auch die Fähigkeiten zur Amputation unter den Heilkundigen unterschiedlich ausgeprägt. Es gab wahre Meister ihrer Kunst, aber auch unachtsame und schlecht ausgebildete Chirurgen, die trotz ihrer professionellen Mängel das Messer ansetzten. Der Wundarzt Wilhelm Fabricius Hildanus (1560–1634) kritisierte beispielsweise das Vorgehen unerfahrener Barbiere: «Die legen die Hand oder die Finger auf einen Tisch oder eine Bank, setzen einen Beitel oder eine Axt darauf und trennen dann zugleich Haut und Fleisch mitsamt den Knochen auf einmal ab.»[9] Hildanus, der zunächst in Köln und später als Stadtarzt von Bern tätig war, entwickelte hingegen differenzierte Operationstechniken, mit denen die Gliedmaßen schonender abgenommen werden konnten. Dazu mussten die verschiedenen Gewebeschichten einzeln und mit unterschiedlichen Techniken versorgt werden.
Die Gleichstellung der chirurgisch tätigen Heiler mit den Medici oder Physici, also den universitär ausgebildeten Doktoren, ging nur zögerlich vor sich. Im Jahr 1731 wurde die Académie Royale de Chirurgie in Paris als eine der ersten in Europa gegründet und erhielt bald danach einen ähnlichen Rang wie eine Medizinfakultät. Damit waren die akademisch ausgebildeten Chirurgen mit jenen Ärzten, die heute als Allgemeinmediziner oder Internisten bezeichnet würden, immerhin auf einer Ebene. Erfahrung und Geschick waren den meisten Patienten jedoch wichtiger als entsprechende Papiere. Aufgrund ihrer Expertise und der Nachfrage durch die Bevölkerung wurden etliche der nicht offiziell geschulten Bader, Barbiere und Wundärzte durch fürstliche oder königliche Dekrete oder staatliche Heilverordnungen als autorisierte Heilpersonen anerkannt und durften ihre Dienste weiter anbieten.
In etlichen Orten war eine Branche chirurgisch tätig, die ein höchst fragwürdiges Ansehen genoss – die Rede ist von Henkern und Scharfrichtern. Diese tatkräftigen Kenner des Körpers waren nicht nur dafür zuständig, mit dem Schwert oder dem Henkersbeil die zum Tode Verurteilten zu enthaupten (wobei der Kopf im Idealfall mit einem Schlag vom Rumpf abgetrennt werden sollte), sondern sie hatten auch Hand anzulegen, wenn Folter oder «Körperstrafen» ausgeführt werden mussten, also Züchtigungen mit der Peitsche oder andere Torturen.[10]
Dieser vielfältigen Berufspraxis verdankten die Henker und Scharfrichter beachtliche anatomische Kenntnisse, die ihnen einen lukrativen Nebenverdienst durch chirurgische Tätigkeiten ermöglichten. Zudem umgab die Henker die geheimnisvolle Aura, über ein Arsenal an magischen Substanzen zu verfügen. In der Volksmedizin wurde Leichenfett und anderen Mitteln, die aus den Überresten von Hingerichteten gewonnen wurden, besondere Kräfte zugeschrieben. Die gesunde wie die kranke Bevölkerung hatte Interesse an den Geheimrezepturen, sei es zur Heilung, zur Linderung von Beschwerden oder als Aphrodisiaka. Dass Henker und Scharfrichter Wunden versorgten, wurde ihnen mancherorts von lokalen Fürsten und Stadtverordnungen gestattet, die Behandlung der inneren Organe blieb ihnen hingegen ähnlich wie den Badern und Barbieren verwehrt. Stellten sie sich geschickter an als der örtliche Medicus, wurden sie von der Bevölkerung allerdings dennoch für diese Art von Leiden zurate gezogen.
Heutige Operateure hören es vermutlich nicht gerne, doch die Branche der Henker und Scharfrichter brachte ideale Voraussetzungen für die Chirurgie mit. Sie wussten in ihrem Berufsalltag einen sauberen Schnitt zu setzen und kannten die Anatomie der abgetrennten Organe aus nächster Anschauung. Deshalb waren sie gut geeignet, das Messer zu führen, auch wenn das Ziel der Behandlung in diesem Fall gegenteilig zur sonstigen Berufspraxis nicht das Sterben, sondern das Überleben der ihnen anvertrauten Klientel war.
Ein Bild von einem Arzt: Harnglas, Stethoskop und Kittel
Lassen Sie mich durch – ich bin Arzt! Während Mediziner heute bei Notfällen in der Bahn, auf der Straße oder im Theater gelegentlich erst ihre berufliche Eignung erwähnen müssen, bevor sie Hilfe leisten können, waren Status und äußere Merkmale früher eng verbunden. Harnglas oder Stethoskop etwa spiegelten als wichtige Insignien des ärztlichen Standes die sinnlichen Erfahrungen im Alltag der Mediziner wider – also das, was der Medicus an seinen Patienten sehen, hören, tasten, riechen und schmecken konnte. Auch wenn Darstellungen von Ärzten aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit oftmals Stilisierungen sind, um die Akteure und ihre Funktion kenntlich zu machen, so zeigen sie doch, wie zentral bestimmte Hilfsmittel im Alltag der Mediziner waren.
Im Mittelalter und bis weit in die Neuzeit hinein war das Harnglas das typische Attribut der Ärzte, ein birnenförmiges, durchsichtiges Gefäß, das es in unterschiedlichen Größen gab. In etlichen bildlichen Darstellungen ist der Arzt daran zu erkennen, dass er ein Harnglas am Gürtel oder in seiner Tasche mit sich trägt. Er hält es in der Hand oder hat es neben sich abgestellt, während er einen Patienten untersucht. Oft ist zu sehen, wie er es gegen das Licht hält, um diagnostische Schlüsse aus dem oft noch körperwarmen Inhalt zu ziehen.
Die Harnschau gehörte über Jahrhunderte hinweg zu den wichtigsten Diagnosemethoden der Ärzte – doch nicht immer konnten die Medici den Kampf gegen den Tod gewinnen, wie dieser Holzschnitt aus dem «Heidelberger Totentanz» (15. Jahrhundert) nahelegt.
Die Idee, Urin zu Diagnosezwecken zu untersuchen, wird Aldobrandino da Siena (gestorben ca. 1299) zugeschrieben, dessen Buch «Le Régime du Corps» 1256 erschienen ist. Auf den Arzt aus Siena geht auch die alltagsgesättigte Vermutung zurück, dass Bier schlechten Atem verursache und den Kopf, den Magen und die Zähne schädige. Anhand der Farbe, des Aussehens, Geschmacks und Geruchs des Urins, also unter Zuhilfenahme seiner Sinne, konnte der Heilkundige im Mittelalter etliche Krankheiten diagnostizieren. Früh bekannt war, dass sich die Zuckerkrankheit erkennen ließ, wenn der Urin der Patienten süßlich schmeckte. Der Name Diabetes mellitus – wörtlich «honigsüßer Durchfluss» – geht auf Geschmackserfahrungen früher Ärztegenerationen zurück. Doch nicht nur Diabetes, auch andere Leiden waren offenbar an den Eigenheiten des Urins zu erkennen. Gemäß der Viersäftelehre, die im nächsten Kapitel näher beschrieben wird, zeigten sich diverse Störungen der Gesundheit an einem Ungleichgewicht der Körpersäfte, also auch am veränderten Urin. Der frisch gelassene Morgenurin der Patienten galt als besonders aussagekräftig für die Diagnose.
Heute spielt die Urinuntersuchung in der Medizin eine eher untergeordnete Rolle – und fordert in keinem Fall mehr den Geschmackssinn, sondern nur die Überwindungskraft heraus. Zwar wird bei Gesundheitschecks oftmals der «Mittelstrahlurin» auf Bakterien, Proteine, eventuelle Beimischungen von Blut und andere Bestandteile getestet und kann auf Infektionen, Nierenleiden oder eine Schwangerschaft hinweisen. Doch die Blutwerte bestimmen zu lassen, hat mittlerweile einen weitaus größeren Stellenwert als die Urinanalyse.
Gegen Ende des Mittelalters, in der von Seuchen gezeichneten Krisenzeit des 14. Jahrhunderts, waren die Ärzte notgedrungen an anderen Merkmalen zu erkennen. Als die Pest besonders im 14. Jahrhundert die Bevölkerung Europas stark dezimierte, versuchten sich die Doktoren ebenfalls vor der Seuche zu schützen. Schnabelförmige Masken, die mit Kräutern gefüllt waren, kamen erst im 17. Jahrhundert auf, bestimmten aber rückblickend das Bild des Pestarztes, der teilweise gar als «Schnabeldoktor» bezeichnet wurde. Schutzbrillen, Handschuhe, Pesthüte und Pestmäntel sollten die Krankheit ebenso abwehren helfen wie Sonden mit extra langem Stiel und andere Instrumente für die Untersuchung, die in Stabform gefertigt waren. Noch wusste man ja nicht, wie die Pest übertragen wurde. Distanz zu halten war prinzipiell eine gute Idee, doch der Infektionsschutz war fast immer lückenhaft, sodass Ansteckungen nicht verhindert werden konnten.
Ein römischer Pestdoktor aus dem 17. Jahrhundert, von Zeitgenossen auch «Dr. Schnabel» genannt. Mithilfe von Maske, Mantel und Stab versuchten Ärzte, die Krankheit auf Abstand zu halten.
Das Ansehen der Ärzte hatte während der Pest stark gelitten. Mit ihren Pesthüten und Mänteln waren die Doktoren äußerlich leicht zu erkennen, und ihr Auftreten signalisierte einen gewissen Aktivismus im Kampf gegen die Krankheit. Da sie keine nennenswerten Erfolge in der Therapie vorzuweisen hatten, schrumpfte ihre professionelle Glaubwürdigkeit jedoch erheblich, und sie genossen kaum einen Vertrauensvorschuss gegenüber den umherziehenden Badern, Barbieren oder allerlei selbst ernannten Wunderheilern. Vertraute man sich jemandem zur Behandlung an, lag dies meist weniger an dessen fachlichem Hintergrund, sondern hatte mehr mit der persönlichen Überzeugungskraft zu tun. Oft wurde über die Doktoren in ihrer aufwendigen Pestkleidung gar gespottet, schließlich konnten sie ja doch nichts gegen die Seuche ausrichten. Weil sich einige Ärzte aus Angst vor einer Erkrankung selbst aus dem Staub machten, statt ihrer Arbeit nachzugehen, litt ihr Ruf zusätzlich, Standeskleidung hin oder her.
Während in Zeiten der Pest die Sinnesorgane teilweise verhüllt wurden, weil sie Eingangspforten für eine Ansteckung sein konnten, blieben Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken und Hören in späteren Jahrhunderten die entscheidenden Hilfsmittel des Arztes. Mit Erfindung des Stethoskops 1816 durch René Laënnec (1781–1826) wurde das Hörrohr das zentrale Instrument für den Arzt, der seine Patienten während der körperlichen Untersuchung eben nicht nur abklopfte, sondern auch abhörte, am ganzen Körper berührte und in ihn hineinlauschte.
Der Legende nach waren es spielende Kinder vor dem Pariser Louvre, die Laënnec an einem Nachmittag im Oktober 1815 auf die Idee brachten. Der junge Arzt aus der Bretagne spazierte vor dem berühmten Museum entlang, als er sah, wie ein Junge mit einem Nagel am Ende eines Astes herumkratzte. Seine Kameraden hatten ihre Ohren auf das andere Ende des Astes gelegt und freuten sich über die Geräusche, die sie hören konnten, weil sie vom Holz übertragen wurden.
Ein paar Monate später musste Laënnec an diese Beobachtung denken, als er zu einer Patientin gerufen wurde. Der Arzt hatte erst vor Kurzem eine Stelle am berühmten Hôpital Necker in Paris angetreten, doch eine herzkranke Patientin stellte ihn vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Aufgrund ihrer Leibesfülle wäre es wenig ergiebig gewesen, die junge Frau abzuklopfen oder ihr gar die Hand auf die Brust zu legen, um eine Diagnose zu stellen, erkannte der Arzt.[11] Die bis dahin gebräuchliche Methode, die «direkte Auskultation» mit dem Ohr auf der Brust der Kranken, verbot sich für Laënnec ebenfalls, da aus seiner Sicht das Geschlecht und das Alter der Patientin dagegensprachen. Andere Mediziner hatten entweder weniger diagnostischen Ehrgeiz oder legten nicht so viel Wert auf Diskretion. Jahrhundertelang war es üblich gewesen, dass Mediziner ihr Ohr auf den Brustkorb der Patienten legten, um Herz und Lunge bei der Arbeit zu lauschen – egal, wie beleibt sie waren oder welches Geschlecht sie hatten.
Laënnec wollte an jenem 17. Februar 1816 jedoch Abstand halten. Er ließ sich ein Papierheft geben, rollte es zusammen und setzte es der Patientin in der Herzgegend auf die Brust. Zu seinem Erstaunen waren Herz- und Atemgeräusche der Lunge – trotz des Abstandes – deutlicher zu hören als mit der direkten Methode. Außerdem bot das neue Hilfsmittel eindeutig Vorteile gegenüber der alten Form der Auskultation: Die von Laënnec beschriebenen und noch heute sogenannten «Rasselgeräusche» der Lunge ließen sich besser von gesunden Lungengeräuschen unterscheiden, die Herztöne auch.
Auf immerhin neunhundert Seiten beschrieb der Arzt die Technik der «mittelbaren Auskultation» («l’auscultation médiate»), und wie damit Leiden von Herz und Lunge diagnostiziert werden konnten. Laënnec, nach Angaben von Zeitzeugen «ein kleiner, hagerer Mensch, der ebenso krank aussah wie seine Patienten», erwies sich als ausgezeichneter Beobachter.[12] Er beschrieb mehrere Erkrankungen als Erster, darunter die Bronchiektasen (eine Erweiterung der Bronchien) und das Lungenemphysem (Lungenblähung), er kategorisierte die verschiedenen Phasen der Lungenentzündung und des Lungenkrebses und identifizierte die Stadien der Tuberkulose bis zum Zerfall des Lungengewebes. Dieser Krankheit sollte er im Alter von fünfundvierzig Jahren selbst erliegen.
Diagnose über das Ohr: Der Erfinder des Stethoskops René Laënnec untersucht einen Patienten, in seiner linken Hand hält er eine frühe Form des Hörrohrs.
Das neue Instrument wurde zunächst starr aus einem durchbohrten Holzstab gefertigt («Ein Zylinder aus Holz, in seinem Centrum 3 Linien Durchmesser gebohrt»[13]) und war für den Gebrauch mit einem Ohr gedacht. Unter Ärzten wurde es schnell populär. Gut zwanzig Zentimeter lang waren die ersten Exemplare, vier Zentimeter im Durchmesser, aus zwei Teilen, die miteinander verschraubt werden konnten und mit abnehmbaren Endstücken. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die starren Rohre zunehmend durch Gummischläuche ersetzt, deren Enden mit Stöpseln in beide Ohren eingesetzt werden konnten, was das Instrument noch flexibler machte. Allerdings benutzen Hebammen und Geburtshelfer bis heute gerne das feste Hörrohr aus Holz oder Kunststoff.
Das Stethoskop war in den ersten Jahren nach seiner Erfindung nicht so verbreitet, wie sein späterer Siegeszug vermuten lassen könnte. Einige Ärzte verweigerten den Gebrauch des Hörrohrs beharrlich. Nach Laënnecs Tod 1826 galt das Stethoskop in manchen Pariser Kliniken eine Weile als so unbeliebt, dass dort nur direkt – das heißt mit dem Kopf auf der Brust – auskultiert wurde. Laënnec habe sich geirrt, indem er sein Instrument für unverzichtbar hielt, urteilten einige Zeitgenossen, wie der Soziologe Jens Lachmund in seinem Buch «Der abgehorchte Körper» nachgezeichnet hat.[14] Andere Mediziner waren irritiert, dass es plötzlich so viele Beschreibungen für Lungengeräusche geben sollte. Die bisherige Nomenklatur der Krankheiten geriet durcheinander: «So gleicht die französische Zeichenlehre immer mehr der chinesischen Schriftsprache, insofern sie nach und nach für jede Krankheit und für jede Modifikation der Krankheit ein bestimmtes Zeichen ausklügelte und schließlich einen solchen Wust von Zeichen haben werden, dass dieselbe nur den wenigen in den Tempeln der Capitale fungierenden Mandarinen verständlich bleibt», befürchtete ein zeitgenössischer Arzt.[15]
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde das Stethoskop dennoch zum wichtigsten Hilfsmittel der Ärzte. Seine Bedeutung für die Diagnostik kann mit den 1895 entdeckten Röntgenstrahlen verglichen werden. Selten noch gab es Skeptiker wie jenen Arzt, den Arthur Conan Doyle, Schöpfer von Sherlock Holmes, 1894 in seiner Kurzgeschichte «Ein Relikt» porträtiert hat: «Er soll sogar abfällige Dinge über Laënnec gesagt und das Stethoskop als ein ‹neumodisches französisches Spielzeug› bezeichnet haben. Er hat ein Stethoskop in seinem Hut, aus Rücksicht auf die Erwartungen seiner Patienten, aber er hört sehr schlecht, so daß es keine große Rolle spielt, ob er es benutzt oder nicht.»[16]
Im ärztlichen Alltag hatte sich das akustische Hilfsmittel längst durchgesetzt. Mit dem Stethoskop hielt eine grundlegende Neuerung Einzug in die Medizin: Direkter Hautkontakt war fortan nicht mehr nötig; das Instrument vergrößerte die Distanz zwischen Arzt und Patienten. Das Stethoskop war zudem das erste Instrument, das innere Körpervorgänge diagnostisch zugänglich machte, ohne dass der Patient dafür bei lebendigem Leib aufgeschnitten oder bereits tot sein musste. «Der lebende Körper war endlich kein Buch mit sieben Siegeln mehr – die Pathologie konnte nun bei Lebenden angewandt werden», vermerkt der Medizinhistoriker Roy Porter.[17] Zuvor hatten sich die Ärzte bei der Untersuchung ausschließlich auf Äußerlichkeiten beschränken müssen – das Abklopfen des Rumpfes, das Abtasten, das Fühlen des Pulsschlags und in mittelalterlicher Tradition: den Geschmack des Urins. Diese Techniken gaben allenfalls indirekt Auskunft über das, was im Inneren der Patienten vorging.
Mit dem neuartigen Instrument wurde der Arzt «zum unumgänglichen Spezialisten» für die Prozesse im Körperinneren, wie Jens Lachmund feststellt.[18] Und er erlangte damit einen neuen Status. Das Sozialprestige des Mediziners war damals keineswegs so gefestigt wie heute, er konkurrierte mit nichtärztlichen Heilern, mit Lebenskundigen wie mit Besserwissern, die mal hilfreiche Kräuter und Tinkturen aus der Familientradition aufboten, mal gefährliche Mixturen. Der Arzt musste sich und sein Tun im Umfeld des Kranken behaupten und rechtfertigen. Das Laienpublikum schaute dem Mediziner kritisch auf die Finger und bewertete das «Geschick» des Doktors.[19]
Mit dem Stethoskop veränderten sich die Rollen, denn die Geräusche aus den Tiefen des Brustkorbs waren nur dem Mediziner mithilfe seiner neuen Technik zugänglich. Schnell wurden sie für die Diagnose wichtiger als die Schilderungen des Patienten selbst. Die subjektive «Krankengeschichte» trat in den Hintergrund. Mit dem Stethoskop wurde zum ersten Mal ein technisches Instrument zur «Grundlage der ärztlichen Wahrnehmung». Mit diesem «komplexen kulturellen Prozess» veränderte sich die Beziehung zwischen dem Kranken, insbesondere dessen Körper, und dem Arzt.[20] War zuvor das «Krankenexamen», also die ausführliche Befragung des Patienten nach seinen Lebensumständen und Beschwerden, wegweisend für die Diagnose gewesen, existierte nun ein technisches Werkzeug, das die Geräusche aus dem Körperinnern nach außen leitete, verstärkte und damit Aufschluss über die Krankheit gab.
Auch bei der Beschreibung von Krankheiten leitete das Stethoskop einen Wandel ein. Bevor die diagnostische Hörhilfe populär wurde, kannten Mediziner beispielsweise sechzehn verschiedene Formen der Schwindsucht, wie die Tuberkulose damals genannt wurde. Für Laënnec lag hingegen nur dann eine Tuberkulose vor, wenn krankhafte Höhlen im Lungengewebe, sogenannte Tuberkel, beim Abhören identifiziert wurden. Mit der Einführung des Stethoskops wurden nebenbei also auch diagnostische Kategorien und Krankheitsstadien neu definiert.
Das schlanke Instrument wurde bald zum innigen Teil der Arzt-Patienten-Beziehung. Zwar konnte man auch andere Körperregionen damit abhören, aber besonders für die Geräusche von Herz und Lunge (und die des Magen-Darm-Trakts) gewann es immer mehr an Bedeutung. Somit stellte das Abhören, die Auskultation, die ideale Methode dar, um die dominierenden Krankheiten des 19. und 20. Jahrhunderts – die Tuberkulose, die Lungenentzündung und die zum Herzinfarkt führende Koronarsklerose – genauer zu untersuchen.
Heute bilden verschiedene Techniken, bei denen der Arzt dem Patienten nahekommt, die Grundlage der ärztlichen Untersuchung. Es handelt sich buchstäblich um Handarbeit. Dazu gehören die Auskultation mit dem Stethoskop sowie die Palpation, also das Abtasten beispielsweise des Bauchraumes, um etwa eine vergrößerte Leber oder Widerstände im Bauch aufzuspüren. Auch die 1761 erstmals vom Wiener Arzt Leopold Auenbrugger (1722–1809) beschriebene Perkussion gehört dazu. Dabei werden Brustwand, Rücken und Bauch abgeklopft, indem mit dem Mittelfinger der einen Hand auf den am Körper anliegenden Mittelfinger der anderen Hand geklopft wird. Ist der Ton beim Abklopfen des Brustkorbs am Rücken dumpfer, kann das für einen Erguss, also eine krankhafte Flüssigkeitsansammlung oder Entzündung sprechen. Das vierte Verfahren ist die Inspektion: Bei genauer Betrachtung des Körpers können Asymmetrien, Einziehungen beim Atmen, Vorwölbungen an Bauch oder Rücken und andere Krankheitszeichen entdeckt werden.
Diese Techniken sind keineswegs veraltet oder modernen Verfahren unterlegen. Erfahrenen Doktoren ist es auf diese Weise und mithilfe einer ausführlichen Krankenbefragung (Anamnese) möglich, neunzig Prozent aller Erkrankungen korrekt zu diagnostizieren. Ein Umstand, an den man sich bei allen Innovationen und technischen Fortschritten in der Medizin (inklusive ihrer Kosten) erinnern sollte – und der die Entdeckung Laënnecs vor mehr als zweihundert Jahren in das richtige Licht zu setzen hilft.
Aktuelle Umfragen ergeben immer wieder, dass ein Stethoskop mit Abstand dasjenige Accessoire ist, das Ärzte am vertrauenswürdigsten erscheinen lässt und ihren Berufsstand symbolisiert.[21] Reflexhammer, Augenspiegel oder Piepser folgen mit großem Abstand, wenn es darum geht, den guten Ruf des Arztes anzuzeigen.
Das mag an der besonderen Untersuchungssituation liegen. Sobald er das Stethoskop aufgesetzt hat, sind Arzt und Patient einander nahe. Der kalte Metallring mit der aufgespannten Membran dazwischen berührt die Haut am Brustkorb. Alles ist still, jetzt nicht reden, der Patient muss die Luft anhalten. Ein nahezu feierlicher Augenblick. Der Kranke ist womöglich etwas angespannt. Er horcht in sich hinein – und der Arzt in den Kranken. Es ist ein untrügliches Zeichen für den Patienten, dass sich ihm der Arzt jetzt voll und ganz zuwendet und die körperliche Untersuchung begonnen hat.[22] Es ist zwar keine Nabelschnur, die beide verbindet, dennoch stiftet das schlichte Hörinstrument eine geradezu intime Nähe: zwei Ohrstöpsel, zwei Schläuche, und der Kopf mit Glocke und Membran, mehr nicht.
Es ist für jeden Medizinstudierenden eine wichtige Initiation auf dem langen Weg zum Arzt, wenn er das erste Mal einen Patienten mit dem Stethoskop untersucht. Keine komplizierte Technik ist das, dafür eine Verstärkung dessen, was im Körper der Patienten pocht, rauscht, klopft, rasselt und rumort. Ein einfaches Instrument gibt erstaunlich viel Aufschluss darüber, was sich im Inneren des Kranken abspielt. Für den Anfänger ist da nur ein lautes, undefinierbares Rauschen zu hören. Ist das die Lunge oder das Herz? Schwer zu unterscheiden. Und sitzen die Stöpsel überhaupt richtig im Ohr, oder sind das Störgeräusche, weil die Membran an der Wäsche des Patienten oder an seinem üppigen Brusthaar schabt?
Zudem stellt sich die Frage, wie sich das, was aus dem Körper des Patienten an das Ohr des Untersuchers dringt, typischerweise anhören sollte. Es ist ein beeindruckendes Erweckungserlebnis für einen angehenden Mediziner, wenn er aus dem eben noch diffusen Klangbrei plötzlich eindeutig die Herztöne heraushört und sich Lungengeräusche als «grobblasig», «fauchend» oder «Rasselgeräusche» unterscheiden lassen. Schon mit ein wenig Übung ist zu hören, wenn eine Herzklappe verengt ist, also «stenotisch» – oder «insuffizient», das bedeutet das Gegenteil, nämlich dass sie nicht mehr richtig schließt. Könner mit geschulten Ohren hören diese Veränderungen der Herzmorphologie genauer, als andere Ärzte sie im Ultraschall sehen.
Heute spielen die Sinne zumindest in der ärztlichen Erstbegegnung mit Patienten oft nicht mehr die entscheidende Rolle. In der Praxis wie im Krankenhaus sehen etliche Patienten zuerst den Röntgenapparat oder die Kernspinröhre, bevor sie dem Doktor die Hand geben – oder der Arzt schaut während des Gesprächs zum Kummer vieler Patienten vor allem auf seinen Bildschirm anstatt ins Gesicht oder auf den Körper der Kranken. Erfahrene Mediziner befürchteten während der Corona-Pandemie wiederum, dass Patienten ihnen nach dem Ende der Seuche nicht mehr die Hand geben würden. Über den Händedruck lassen sich wichtige erste Eindrücke gewinnen, etwa über die Temperatur, die Kraft, oder ob es sich um teigige, trockene oder verschwitzte Hände handelt. Zudem lässt ein energischer oder schlaffer Händedruck gewisse Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu.
Täte nicht jedem Arzt eine Rückbesinnung auf das Sehen, Riechen, Hören, Tasten und Schmecken gut? Braucht es womöglich eine Schulung der Sinne, etwa durch schöpferische, künstlerische und handwerkliche Zusatzerfahrungen? In älteren Lehrbüchern finden sich Beispiele für eine medizinische Zeichenlehre, eine Semiotik des Körpers. Darin gibt es Erklärungen zur Haltung, zur Gesichtsfarbe oder was ein Mundgeruch nach Aceton oder starke Falten neben den Mundwinkeln bedeuten.
Bei aller Konkurrenz ist das Stethoskop bis heute das charakteristische Accessoire der Ärzteschaft geblieben, auch wenn es, wie manche Spötter sagen, den Doktoren vor allem dazu dient, von ihren Patienten nicht für Friseure oder Apotheker gehalten zu werden. Ohne die Leistung moderner Schallgeräte und Tomografen schmälern zu wollen – an die praktische und symbolische Bedeutung des Stethoskops kommen sie nicht heran. Kaum ein Sachbuch über Medizin ohne Stethoskop auf dem Cover, keine Arztserie ohne das lässig um den Hals oder aus der Kitteltasche baumelnde Abhörinstrument.
Historische Pointe: Gut zweihundert Jahre nach seiner Erfindung ist das Stethoskop längst nicht mehr Sinnbild für eine technisierte Medizin, wie es das in den ersten Jahren nach seiner Erfindung war, sondern steht für das Gegenteil. Es symbolisiert den bodenständigen, aufmerksamen Arzt, die patientennahe, technisch zurückhaltende Heilkunde, in der die Zuwendung auch bildlich – der Doktor beugt sich zu dem im Bett liegenden oder sitzenden Kranken hinunter, um ihn abzuhören – die wichtigste Rolle spielt. Neben seiner weiterhin nicht wegzudenkenden diagnostischen Bedeutung ein Grund mehr, das Stethoskop stärker in den Fokus ärztlichen Handelns zu rücken.
Die Insignien des Arztes erfüllten also nicht nur eine praktische Funktion wie das Harnglas oder das Stethoskop, sondern ihnen kam immer auch psychologische und symbolische Bedeutung zu. Dies zeigt vor allem die Karriere des weißen Kittels. Der Arztkittel verbreitete sich besonders zu Zeiten der Pest im 14. Jahrhundert als Arbeits- und Schutzkleidung. Er bildete zusammen mit Gesichtsmasken eine gewisse Barriere gegen die Keime, wenngleich der Schutz unvollständig blieb. Die Ansteckungswege wurden erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Da Kittel und Hände nicht ausreichend und häufig genug gereinigt wurden und eine komplette Keimabwehr unmöglich war, infizierten sich auch etliche Mediziner mit der Pest und starben daran.
In der Neuzeit trugen Ärzte oftmals keinen Kittel, wenn sie Kranke zu Hause besuchten. Chirurgen hingegen schützten sich und ihre Kleidung, sobald sie auf dem Schlachtfeld oder im Krankenhaus ihrem blutigen Handwerk nachgingen. In den Hospitälern war die Arbeitskleidung früh schon stärker verbreitet, doch erst im 19. Jahrhundert setzte sich der Kittel als typisches Kennzeichen für alle Ärzte durch. Das hatte viel mit der Verwissenschaftlichung der Medizin in dieser Zeit zu tun. Obduktionen boomten, und mit der wissenschaftlichen Methode hielt das Experiment – und damit der Laborkittel – Einzug in die Medizin. Berühmte Ärzte in dieser Epoche waren beispielsweise Rudolf Virchow (1821–1902) und Robert Koch (1843–1910), die viel Zeit im Labor und in ihren Forschungsinstituten verbrachten und oft Kittel trugen. Sie prägten das Bild vom Arzt in der Öffentlichkeit entscheidend mit.
Ganz in Weiß – so sehen also nicht nur, wie einst von Roy Black besungen, Hochzeitsträume aus. Auch die Erscheinung des Arztes im weißen Kittel ist inzwischen kulturell tief verankert. Für die Wahrnehmung und Wiedererkennung von Ärzten durch ihre Patienten hat das einfarbige, hell strahlende Kleidungsstück eine enorme Bedeutung.[23] Trotz aller Bemühungen um eine offene Arzt-Patienten-Beziehung, um ein Verhältnis auf der viel zitierten «Augenhöhe», um die gemeinsame informierte Entscheidungsfindung («informed consent») und um weitere vertrauensbildende Maßnahmen in diesem fragilen Miteinander, gehört der weiße Kittel noch immer zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Arztes, wie Wissenschaftler des Universitätsspitals Zürich feststellten.[24]
Das Team aus der Schweiz hatte mehr als achthundert Patienten gefragt, die in der Dermatologie, Infektiologie und Neurologie behandelt wurden, wie sie das äußere Erscheinungsbild von Ärzten beurteilten. Dabei sollten die Kranken vom Auftreten der Doktoren darauf schließen, wie kenntnisreich, vertrauenswürdig, fürsorglich und nahbar ihnen die Mediziner vorkamen. Einfacher gesagt, wurden sie gefragt, ob es eine angenehme Vorstellung für sie sei, von den jeweiligen Ärzten behandelt zu werden. Dazu wurden den Versuchsteilnehmern Fotos vorgelegt, die Ärzte in unterschiedlichen Dresscodes zeigten.
Mehr als ein Drittel der Probanden gab an, dass die Kleidung des Arztes für sie wichtig sei. Ein Viertel der Teilnehmer fand sogar, dass diese Äußerlichkeiten Einfluss darauf hatten, wie zufrieden sie mit der Behandlung waren. Am besten schnitten in der medizinischen Modenschau jene Doktoren ab, die zusätzlich zum weißen Kittel weiße Arzthosen trugen – das galt für Männer wie Frauen im Arztberuf.
Auf den nächsten Rängen folgte in der Beliebtheitsskala die Kombination Arztkittel mit Hosen und Hemden im Businessstil, also etwa gebügelte Stoffhosen, Hemden, Blusen und gegebenenfalls Krawatte. Der lässige Look zum weißen Kittel wurde hingegen nicht geschätzt; dieses Outfit wurde schnell als nachlässig verstanden. Ordentlich sollten die Doktoren schon auftreten.
Natürlich ist die Einschätzung von Ärzten durch Patienten auch von den Landessitten, dem kulturellen Hintergrund, dem medizinischen Kontext und anderen Einflüssen abhängig. In England ist es beispielsweise üblich, dass Ärzte mit Anzug und Krawatte in die Klinik kommen und für die Arbeit mit Patienten das Jackett ausziehen, aber mit Anzughose, Businesshemd und Krawatte behandeln, wenn sie nicht invasiv tätig sind. Trotzdem zeigt sich international, dass eine professionelle Kleidung – also Arztkittel oder OP-Hemd – von den meisten Patienten vorgezogen wird und sie dann eher dazu bereit sind, persönliche und intime Details von sich preiszugeben.[25]
Aussehen und Kleidung von Ärzten sind jedoch nicht allein eine Frage modischer Präferenzen, auch wenn es landestypische Unterschiede gibt. Medizin beruht schließlich zu großen Teilen auch darauf, heilsame Erwartungen zu wecken. «Die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten ist der Schlüssel zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung», so das Team aus Zürich. «In etlichen Studien hat sich gezeigt, dass sich die Zufriedenheit der Patienten und wie sie ihren Arzt wahrnehmen, auf den Genesungsverlauf auswirkt, auf das Risiko einer Wiederaufnahme in die Klinik und sogar auf die Sterblichkeit.»[26] Ärzte haben einen Hang zur Magie, und ihr Kittel ist eines ihrer liebsten Instrumente.
Die Medizin ist, darin vergleichbar mit der katholischen Kirche, von symbolischen Handlungen und Traditionen durchdrungen. Nicht immer ist zu erkennen, ob die Gläubigen – in diesem Fall also die Kranken – einen Nutzen davon haben, und nicht immer wird das Illusionstheater allein für die Patienten aufgeführt, sondern gilt oft auch der Selbstvergewisserung des Berufsstandes. «Weiße Kittel dienen in erster Linie der Psychohygiene der Ärzte», so die Einschätzung von Franz Daschner, der viele Jahre die Abteilung für Hygiene am Universitätsklinikum Freiburg geleitet hat. «Dabei sind Kittel zu fünfundneunzig Prozent für den Arzt-Patienten-Kontakt unnötig und dienen nur dazu, das Namensschild zu befestigen.» Vor Jahren hat der Freiburger Mikrobiologe auch das tägliche Desinfizieren und Wienern der Klinikflure als Teil der «medizinischen Psychohygiene» beschrieben. Aus fachlicher Sicht sei dies überflüssig. Zwar würden sowohl Ärzte als auch Patienten glauben, dass dadurch Krankenhausinfektionen verhindert werden könnten. Man müsse aber, so Daschner, «die Patienten schon mit offenem Bauch über die Flure schleifen, damit sie sich etwas holen».[27]
Professionelle Distanz, schonungslose Aufklärung, Beziehungsmedizin
Patienten reden gerne, sie wollen verstanden werden und ihre Interpretation der Beschwerden zum Besten geben. Trotzdem gab und gibt es Ärzte, die in den Schilderungen der Patienten vor allem lästige Sozialgeräusche sehen. Im «Brockhaus» findet sich bereits vor gut 130 Jahren unter dem Stichwort «Diagnose» die entsprechende Haltung von einigen Vertretern des ärztlichen Standes. So heißt es in der Ausgabe von 1892 – der Passus wurde nahezu wörtlich in die Ausgabe von 1929 übernommen –, dass «Mitteilungen, die der Kranke selbst über seinen Zustand macht, gewöhnlich nur Gefühle und subjektive Empfindungen der verschiedensten Art betreffen, die den Arzt nur selten zu einem sichern und begründeten Urteil über die vorliegende Krankheit befähigen».[28] Dazu passt das zynische Motto, das manche Ärzte bis heute gerne zitieren: «Die Medizin wäre eine schöne Disziplin, wenn es nur die Patienten nicht gäbe.»
Dabei war und ist die Wahrnehmung des Krankseins ein entscheidender Faktor für den Verlauf der Erkrankung. Wie schnell Knochen heilen, wie rasch sich Patienten von Infektionen erholen und wie gut Wunden verschorfen, ist davon abhängig, ob sich Patienten in ihren Ängsten und Hoffnungen verstanden fühlen. Wird eine optimistische Erwartungshaltung auf realistischer Grundlage bestärkt, geht es den Kranken besser. Mittlerweile belegen zahlreiche Befunde auf molekularer, neurobiologischer und klinischer Ebene, dass die mit dem Erleben der Krankheit verbundenen Emotionen eben nicht «nur Gefühle und subjektive Empfindungen» sind, die vernachlässigt werden können. Gelingt die Arzt-Patienten-Beziehung, zeigt sich vielmehr, dass sich Heilungsprozesse beschleunigen, Reparaturvorgänge gelingen und das Immunsystem gestärkt wird. Die Welt der Kranken ist eine andere, wenn sie positiv stimuliert wird.
Das Schicksal der Krankheit führt Arzt und Patient zusammen, und doch lässt sich hier nicht von einer Einheit sprechen. Der Arzt übt lediglich seinen Beruf aus; er entfernt beispielsweise einen Tumor. Anschließend kann er – spätestens am Abend oder am Wochenende – wieder seinem Privatleben nachgehen. Der Kranke bleibt jedoch krank, ohne Pause und Urlaubstag, die Krankheit verfolgt ihn, sie lässt ihn buchstäblich nicht allein.
Diese scharfe Trennung zwischen dem professionellen Auftrag und Arbeitsalltag der Ärzte und dem privaten Leid der Kranken ist eine Konstante in der Medizingeschichte. Allerdings wurde in früheren Zeiten Krankheit meist als schicksalhaftes Unglück oder gerechte Strafe hingenommen, an deren Verlauf – auch bedingt durch die begrenzten therapeutischen Möglichkeiten – nicht viel zu ändern war. Heute kommt dem Arzt eine größere Deutungsmacht über Ursache, Verlauf und Prognose einer Erkrankung zu. Ein skeptischer Blick oder eine zögerliche Antwort des Arztes – und schon kann die Welt der Kranken auf einen Schlag zusammenbrechen.
Von der Erfahrung der zwei Welten, in der sich Ärzte und Kranke doch nur eine kleine Schnittmenge teilen, berichtet eindrucksvoll der Schriftsteller und Zeichner Robert Gernhardt (1937–2006). Im Alter von vierundsechzig Jahren erhält er die Nachricht, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Nachdem er um seine Tumordiagnose weiß, beginnt er, darüber zu schreiben. Im Jahr 2004 erscheinen seine «K-Gedichte», in denen er sich den Themen Krankheit, Krebs und Krieg zuwendet.[29] In dem Gedicht «Schneiden und Leiden» heißt es:
Einer sagt: Wir müssen schneiden.
Einer weiß: Ich muß jetzt leiden.
Einer sagt: Jetzt kommt der Schnitt.
Einer denkt: Da machst was mit.
Einer hat was rausgeschnitten.
Einer hat nicht ausgelitten.
Einer ist der Scheidende.
Einer ist der Leidende.
Einer war der Schneidende.
Einer bleibt der Leidende.[30]
Bei aller Empathie der Behandelnden ist es nur schwer möglich, das Leben und Erleben gerade chronisch Kranker wirklich nachzuvollziehen. Die große amerikanische Intellektuelle und Essayistin Susan Sontag (1933–2004), die früh an Brustkrebs erkrankte, dann ein Gebärmuttersarkom bekam und schließlich an den Folgen einer besonders bösartigen Leukämie starb, hat unter anderem in ihrem Essay «Krankheit als Metapher» (1978) schon früh beschrieben, welchen enormen Unterschied es macht, ob man zu den Gesunden oder zu den Kranken gehört – und dass sich die Übergänge oft fließend und unerwartet vollziehen.[31] Wer krank ist, erlebt, gerade bei schweren Leiden und chronischen Erkrankungen, die Krankheit fortwährend, als Kontinuum. Auch wenn zwischendurch unbeschwerte Momente möglich sind, gibt es immer wieder Rückschläge, die einen schmerzlich an den eigenen verletzlichen oder gar hinfälligen Zustand erinnern. Sontag kannte dies aus eigener Erfahrung und sprach von «zwei Staatsbürgerschaften», die wir alle besitzen, «eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken». Und mögen wir uns auch wünschen, nur erstere, die mit dem «guten Ruf» nämlich, zu nutzen, so ist «früher oder später (…) doch jeder von uns gezwungen, wenigstens für eine Weile, sich als Bürger jenes anderen Ortes auszuweisen».[32]
Die Autorin Susan Sontag (hier um 1971) erkrankte mit zweiundvierzig Jahren an Brustkrebs und setzte sich in ihren Schriften intensiv mit der Krankheit auseinander. 2004 starb sie an Leukämie.
Manche Menschen reden zwar ausdauernd über ihre Erkrankungen, trotzdem ist die Gesprächsoffenheit auch davon abhängig, um welche Art Leiden es sich handelt. Manche Krankheiten werden als Trophäen unbedingter Leistungsbereitschaft geadelt und ihre Entstehung wird ausgeschmückt, etwa ein am Alpenhauptkamm gebrochenes Sprunggelenk – andere hingegen verschämt verschwiegen und fälschlicherweise als Schwäche ausgelegt, wie der Nervenzusammenbruch im Moment des beruflichen Abstiegs.
Jede Krankheit ist anders, jeder Mensch erlebt und durchleidet sein Kranksein anders, und trotzdem besteht darin eine große Gemeinsamkeit, die Kranke verbindet und sie von den Gesunden trennt. In medizinischen Diagnosekatalogen und Zuschreibungen spielt das Erleben von Krankheit jedoch kaum eine Rolle. Das Vokabular dafür ist begrenzt und meist auf die technisch-naturwissenschaftliche Erfassung der veränderten Laborwerte oder Organschädigungen ausgerichtet.
Neu ist dieses Phänomen keineswegs. Ärztliche Diagnosen bezogen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer seltener das Erleben der Patienten ein, sondern orientierten sich stattdessen an den technisch erzeugbaren und kontrollierbaren Befunden. Der Mikrobiologe und Erkenntnistheoretiker Ludwik Fleck (1896–1961) beschrieb diese Veränderung der Medizin in seinem Standardwerk über die «Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache» schon im Jahr 1935. Er zeichnete nach, wie die Syphilis nicht mehr nach den Beschwerden und klinischen Symptomen diagnostiziert wurde, also den Pusteln, Schleimhautgeschwüren und Lymphknotenschwellungen der Patienten, sondern danach, ob die Krankheit mittels des 1906 entwickelten «Wassermann-Tests» in Blut oder Nervenwasser nachgewiesen werden konnte.[33]
Es gibt etliche weitere Beispiele für das Auseinanderdriften von Befinden und Befund aus neuerer Zeit: Auch die Angina Pectoris, eine als bedrohlich empfundene Enge in der Brust, die auf verengte Herzkranzgefäße zurückgeht, wurde lange Zeit ausschließlich durch ein beängstigendes Gefühl und Schmerzen im Brustkorb diagnostiziert. Inzwischen gilt die Diagnose nur als «gesichert», wenn sich eine Engstelle im Blutgefäß in der Koronarangiografie zeigt, die längst zu einem zu häufig praktizierten Routineeingriff geworden ist. Der Bremer Gesundheitswissenschaftler Norbert Schmacke hat auf den «okulostenotischen Reflex» der Kardiologen hingewiesen: Herzexperten sehen ein verengtes Kranzgefäß und sind von der augenscheinlichen Stenose so beeindruckt, dass sie daraus auf die Diagnose schließen – unabhängig davon, wie sich der Patient fühlt und ob er überhaupt Beschwerden hat.[34]
Dabei wird seit den 1970er-Jahren betont, wie wichtig die Patienten und ihre Einschätzung der Krankheit für die Genesung und den weiteren Verlauf sind. Mithilfe des «informed consent» sollen vorab Erwartungen der Patienten geklärt und realistische Ziele abgestimmt werden. Immer mehr Ärzte geben an, ihren Patienten «auf Augenhöhe» begegnen zu wollen – das klingt gut, aber das Verhältnis zwischen beiden Parteien ist nun mal asymmetrisch und in einem entscheidenden Punkt keine Interaktion unter Gleichen. Verständnis, Aufklärung und bei Bedarf umfassende Informationen können Kranke erwarten, aber distanziert und abwägend das beste Vorgehen zu erkennen, bleibt fast immer Privileg des Arztes. Wird dieser Umstand nicht ausreichend berücksichtigt, drohen überzogene Erwartungen das Arzt-Patienten-Verhältnis zu belasten.
Das gilt auch dann, wenn Ärzte selbst erkranken und zwar Fachwissen mitbringen, durch ihr eigenes Leid jedoch ihre kritische Distanz verlieren. Manche lassen sich dann auf unbewiesene Therapien ein, die sie als Arzt jedem Patienten ausgeredet hätten. Doch eine gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation ist möglich. Wenn sich die Kranken in der Interaktion mit dem Arzt aufgehoben fühlen, erleben sie die Krankheit positiver und diese Zuversicht ist es, die ihre Genesung fördert.
Ärztliche Aufklärung kann allerdings an Grenzen stoßen – und manchmal brutal sein. Dann trägt die Illusion vom mündigen Patienten oder fehlende Einfühlung dazu bei, dass ein Arzt-Patienten-Gespräch misslingt: Es ist belastend für Ärzte, schlechte Nachrichten zu überbringen. Der Patient bangt um seine Zukunft, seine Familie, sein Leben. Manche Ärzte wissen nicht, wie sie Patienten sagen sollen, dass sie schwer krank sind. Sie spüren nicht, wie viel Ehrlichkeit sie Patienten zutrauen können. Manche wirken aus Selbstschutz kühl oder indifferent – die Gleichgültigkeit der Gesunden. Die Distanz zwischen Gesunden und Kranken erklärt allerdings nicht immer, was sich manchmal zwischen Arzt und Patient abspielt.[35]
Erschütternd liest sich der Bericht von Peter Tautfest aus dem Jahr 2001, einem Journalisten der «taz». «Was Sie in der Brust haben, ist ein Tumor, der ist bösartig, und der hat auch leider schon gestreut», sagte der Stationsarzt einer Lungenklinik zu ihm, als er Tautfest mit der Diagnose konfrontierte. Tautfest schreibt, dass ihm schwarz vor Augen wurde, dann schildert er, wie er die Diagnose empfunden hat: «Dr. K. gehört zu der neuen Generation von Ärzten, die es gelernt hat, Patienten die Wahrheit nicht zu verschweigen. Er spricht leidenschaftslos, direkt, schonungslos und ohne Umschweife. Ja beinahe ein bisschen schnodderig. Rückblickend kommt es mir vor, als hätte er wie von einem großen Spaß gesprochen, wie von einem jener unvermeidlichen Unglücke, die Menschen nun mal widerfahren und über die man gemeinsam scherzen können soll oder können muss. Nicht zu diesem Ton jedoch passen Klagen oder Bedauern. Er hätte auch sagen können: Ich will heute Nachmittag noch Squash spielen gehen und mir die Laune von Ihnen nicht verderben lassen.»[36]
Patienten werden mit der Mitteilung, Krebs zu haben, aus dem Nichts in eine Extremsituation gestoßen. Manche reagieren aufbrausend, ungerecht, andere traurig. Ärzte, die mit Tumorpatienten zu tun haben, wissen das. Doch «viele Ärzte sehen sich nur noch als Informationsüberbringer», sagt der Medizinethiker Giovanni Maio von der Universität Freiburg. «Sie meinen, sie sind gut, wenn sie den Patienten teilnahmslos aufklären und ihm alle weiteren Entscheidungen überlassen.»[37] Zwar wolle kein Patient den einstigen Paternalismus der Ärzte zurück, die über Kranke hinweg entschieden haben – 1961 gaben neunzig Prozent der amerikanischen Onkologen in einer Umfrage für das «Journal of the American Association» an, sie würden ihre Patienten belügen und ihnen nicht sagen, dass sie an Krebs litten.[38] In der neuen, aufgeklärten Medizin droht die Fürsorge hingegen vernachlässigt zu werden.
Was die meisten Patienten brauchen, ist Hilfe und Begleitung. Unangenehme Diagnosen sind auch mit brillantem Intellekt und angehäuftem Wissen nicht leichter zu bewältigen. Niemand, nicht einmal ein Mensch, «der die Vernunft so liebte (und die Berufung auf das Subjektive so verabscheute) wie meine Mutter», sei in dieser Situation in der Lage, «bis zum Äußersten rational» zu bleiben, schreibt David Rieff in seinem berührenden Buch «Tod einer Untröstlichen» über seine Mutter Susan Sontag. Wenige Laien haben sich so ausführlich mit der Medizin beschäftigt wie sie. Und doch «verirrte auch sie sich, wie fast alle Patienten, im dichten Nebel der medizinischen und biologischen Terminologie» und geriet am Ende in einen «noch dichteren Nebel am Übergang vom autonomen Erwachsenen zum infantilisierten Patienten, der nur noch aus Bedürftigkeit, Angst und Schmerz besteht», schreibt Rieff über seine Mutter.[39] Doch nur wenige Mediziner wissen in einer solchen Lage mit den Emotionen der Betroffenen gut umzugehen. Als seine Mutter erneut erkrankte, so schildert Rieff, sprach der Arzt mit ihnen, «als hätte er Kinder vor sich, aber ohne die Behutsamkeit, mit der ein verständiger Erwachsener im Umgang mit Kindern seine Worte wählt.»[40]
Natürlich haben viele Patienten ein Bedürfnis nach Aufklärung und wollen mehr wissen. «Aber selbst der informierteste Patient braucht Hilfe bei der Deutung und Gewichtung, damit die Informationen handlungsleitend werden können», sagt Medizinethiker Maio. «Wenn man schwer krank ist, hilft alle Bildung nichts. Das ist eine existenzielle Erfahrung, die man nicht wie eine Mathe-Aufgabe lösen kann.» Es geht schließlich oft auch darum, sich zu fragen, wie sich das eigene Leben rundet, was die Vorstellungen vom guten Sterben sind. Im Medizinstudium kommen solche Themen kaum vor, «das Sprechen über letzte Dinge wird reduziert auf Sprachtechnik. Es geht aber nicht um Techniken, sondern um Haltung, Empathie», so Maio.[41]
Der emotionale Prozess, der nach der ersten Begegnung mit der eigenen Krebserkrankung abläuft, lässt sich durch keine noch so gelungene Gesprächsführung des Arztes abmildern. Nachdem die Diagnose «Krebs» gefallen ist, nehmen Kranke kaum noch etwas auf, oft behalten sie nur etwa zehn Prozent von dem Gespräch. Außerdem brauchen Patienten Zeit. Jeder hat seinen eigenen – richtigen – Weg. David Rieff berichtet, wie gerne er seine Mutter in der Endphase ihrer Krankheit getröstet hätte, doch sie redete bis kurz vor ihrem Tod «von ihrem Kampf gegen den Krebs und nie vom Sterben». Rieff wollte sie nicht zu dem Thema drängen, wenn sie es nicht selbst wählte. «Es war ihr Tod, nicht meiner.»[42]
Die Fortschritte der Medizin bringen neben den Tücken der Aufklärungsgespräche weitere Fallstricke mit sich. Aufgrund immer genauerer Diagnosemethoden sehen sich Ärzte wie Patienten zunehmend mit dem Phänomen konfrontiert, dass ein mit ausgefeilter Technik erhobener Befund nicht mit dem Befinden der Kranken zusammenpasst.[43] Der Patient fühlt sich pudelwohl und klagt über keinerlei Beschwerden, das Röntgenbild zeigt hingegen Auffälligkeiten, die «eigentlich» mit starken Schmerzen oder einem baldigen OP-Termin einhergehen müssten.[44] Sagt der Arzt, der Befund sollte regelmäßig kontrolliert werden, fällt der Patient aus allen Wolken. Ihm geht es doch gut.
Umgekehrt kommt es in Kliniken wie Arztpraxen immer wieder zu irritierenden Konstellationen: Dem Patienten geht es schlecht, aber der Arzt kann keine pathologische Veränderung in Blut, Urin oder anderen Körpersäften feststellen, jedenfalls nichts, was die Beschwerden erklären könnte.[45] Auch Röntgen, Kernspin, Computertomografie (CT) oder Endoskopie bringen keine Aufklärung. Der Kranke fühlt sich miserabel, der Arzt denkt: «Das kann doch gar nicht wehtun!»
Der Umgang mit Leiden, bei denen keine körperlichen Ursachen festgestellt werden, ist nicht nur für Patienten, sondern auch für Ärzte schwierig: «Sage ich Patienten, sie haben nichts, sind sie enttäuscht, sage ich ihnen, sie haben etwas, sind sie auch enttäuscht. Deshalb sage ich: Wir finden keine Ursache, aber Sie haben trotzdem Beschwerden», erklären erfahrene Ärzte ihren Umgang mit dem Dilemma. Wenig ist für Patienten schlimmer, als wenn ihnen die Legitimation für ihr Leiden abgesprochen wird. Wer leidet, will zu Recht krank sein – und sich nicht nur krank fühlen.
Die Sichtweisen auf Krankheit und Wohlbefinden sind unterschiedlich. Im Englischen gibt es die Ausdrücke «Disease», «Illness» und «Sickness». Die Begriffe benennen verschiedene Perspektiven auf das, was im Deutschen lediglich als «Krankheit» oder «Erkrankung» bezeichnet wird und daher begrifflich wenig Differenzierungen zulässt.
Mit «Disease» ist jenes Konzept von Krankheit gemeint, wie es in medizinischen Lehrbüchern zu finden ist. Die Beschreibung von Symptomen, Häufigkeit, Diagnostik, Therapie und typischem Verlauf inklusive möglicher Komplikationen. Eben das, was man Ärzte in ihrer Ausbildung zu sehen gelehrt hat, wie es der Psychiater und Anthropologe Arthur Kleinman von der Universität Harvard umschreibt.[46]