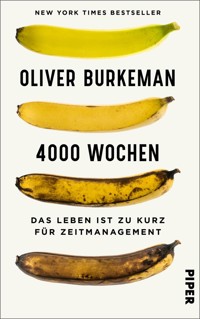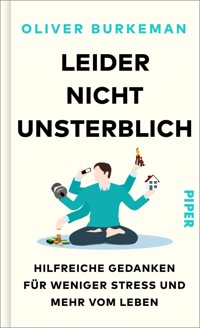
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Endlich Zeit nehmen für das, was zählt Wie können wir die Realität unserer Endlichkeit annehmen? Wie treffen wir Entscheidungen und handeln voller Entschlossenheit, wenn es immer zu viel zu tun gibt und Scheitern unvermeidlich ist? Wie finden wir zu einem tieferen Sinn, wenn wir erkennen, dass das Leben kein Problem ist, das es zu lösen gilt? Mithilfe von inspirierenden Erkenntnissen aus Philosophie, Religion, Literatur, Psychologie und Selbsthilfe hat Oliver Burkeman den perfekten Begleiter in einer Zeit der Turbulenzen und allgegenwärtigen Ängste geschaffen: ein überraschender und unterhaltsamer Crashkurs für ein erfülltes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Aus dem Englischen von Henning Dedekind und Heide Lutosch
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Meditations for Mortals bei Bodley Head, einem Verlag von Penguin Random House, London
© Oliver Burkeman, 2024
Für die deutsche Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagabbildung: Getty Images/Ralf Hiemisch
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Einleitung: Das unvollkommene Leben
Erste Woche
Die eigene Endlichkeit
Tag 1: Es ist schlimmer, als Sie denken
Tag 2: Kajaks und Superjachten
Tag 3: Man muss nur die Konsequenzen tragen
Tag 4: Gegen den Produktivitätszwang
Tag 5: Zu viele Informationen
Tag 6: Man kann sich nicht um alles sorgen
Tag 7: Die Zukunft Zukunft sein lassen
Zweite Woche
Handeln
Tag 8: Entscheidungsfindung
Tag 9: Fertigwerden
Tag 10: Suchen Sie Ihre Lebensaufgabe!
Tag 11: Gehen Sie zum Schuppen
Tag 12: Regeln fürs Leben
Tag 13: Drei bis vier Stunden
Tag 14: Geschmack an Problemen finden
Dritte Woche
Loslassen
Tag 15: Was, wenn es ganz einfach wäre?
Tag 16: Die umgekehrte Goldene Regel
Tag 17: Großzügigkeit zulassen
Tag 18: Lassen Sie den Leuten ihre Probleme
Tag 19: Eine gute Zeit oder eine gute Geschichte
Tag 20: Quantitative Ziele
Tag 21: Was heißt hier Unterbrechung?
Vierte Woche
Sich zeigen
Tag 22: Das Zukunfts-Ich hintanstellen
Tag 23: Geistige Gesundheit als Ausgangspunkt
Tag 24: Laxe Gastfreundschaft
Tag 25: Leben lässt sich nicht aufsparen
Tag 26: Undurchschaubar
Tag 27: C’est fait par du monde
Tag 28: Was wirklich zählt
Epilog: Vorwärts im Geist des Imperfektionismus
Dank
Zum Weiterlesen
Erste Woche: Die eigene Endlichkeit
Zweite Woche: Handeln
Dritte Woche: Loslassen
Vierte Woche: Sich zeigen
Zitatnachweise
Problemverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Motto
»Es ist leichter, zu versuchen, besser zu sein, als man ist, als zu sein, wer man ist.«
Marion Woodman
»Gibt es ein Leben vor dem Tod? Das ist die Frage!«
Anthony de Mello
Einleitung: Das unvollkommene Leben
In diesem Buch geht es darum, wie sich einem die Welt öffnet, sobald man erkennt, dass man sein Leben nie in den Griff bekommen wird. Es geht darum, wie herrlich produktiv man wird, wenn man das verbissene Streben aufgibt, immer produktiver zu werden; und wie viel leichter es wird, mutige und wichtige Dinge zu tun, wenn man erst einmal akzeptiert hat, dass man nie mehr als eine Handvoll davon schaffen wird (und dass man streng genommen überhaupt nichts davon zwingend tun muss). Es geht darum, wie faszinierend und wunderbar das Leben wird, wenn man sich damit abfindet, wie flüchtig und unberechenbar es ist; wie viel weniger isoliert man sich fühlt, wenn man seine Fehler und Misserfolge nicht mehr vor anderen verbirgt; und wie befreiend die Einsicht sein kann, dass man seine größten Schwierigkeiten im Leben vielleicht nie ganz überwinden wird.
Kurz: Es geht darum, was sich ändert, wenn man begreift, dass das Leben als begrenzter Mensch – in einer Zeit unendlicher Aufgaben und Möglichkeiten, im Angesicht einer ungewissen Zukunft, in Gesellschaft anderer Menschen, die hartnäckig darauf pochen, ihre eigenen Persönlichkeiten auszuleben – kein Problem ist, das es zu lösen gilt.
Die 28 Kapitel dieses Buches sind vielmehr ein Leitfaden für eine andere Art der Lebensgestaltung, die ich »Imperfektionismus« nenne – eine befreiende und motivierende Sichtweise, die auf der Überzeugung beruht, dass Ihre Begrenzungen kein Hindernis für ein sinnvolles Dasein sind und dass Sie Ihre Tage nicht damit verbringen müssen, sie auf dem Weg zu einer imaginären Erfüllung zu überwinden. Im Gegenteil: Die eigenen Begrenzungen zu akzeptieren und sich ganz auf sie einzulassen, ist der Schlüssel zu einem gesünderen, freieren, erfüllteren, spannenderen und sozial besser eingebundenen Leben – insbesondere in diesem unbeständigen und mit vielen Ängsten behafteten Moment in unserer Geschichte.
Wenn Sie sich dazu entschließen, dieses Buch in dem vorgeschlagenen Tempo von etwa einem Kapitel pro Tag zu lesen, hoffe ich, dass es als vierwöchiger »Rückzug des Geistes« inmitten des täglichen Lebens funktionieren wird, als ein Weg, diese Philosophie im Hier und Jetzt zu leben und dadurch mehr Dinge zu tun, die Ihnen wichtig sind, anstatt sie gedanklich als weiteres System abzulegen, das Sie vielleicht eines Tages umsetzen werden – sollten Sie jemals einen Augenblick Zeit dafür finden. Wie wir noch sehen werden, besteht ein Hauptgrundsatz des Imperfektionismus darin, dass der Tag niemals kommen wird, an dem alles andere »aus dem Weg geräumt« ist und man sich endlich ein erfülltes, sinnvolles und erfolgreiches Leben aufbauen kann. Für endliche Menschen ist die Zeit dafür das Jetzt.
Ich hoffe also aufrichtig, dass Sie dieses Buch hilfreich finden. Um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein: Ich habe es für mich selbst geschrieben.
Mit Ende zwanzig fing ich als Feuilletonist beim Guardian in London an. Wenn ich morgens in die Redaktion kam, wurde mir ein aktuelles Thema zugewiesen – zum Beispiel das Schicksal von Flüchtlingen, die vor einer sich anbahnenden geopolitischen Krise fliehen, oder die Frage, warum grüne Smoothies plötzlich so beliebt sind. Daraus sollte ich dann bis 17 Uhr desselben Tages einen umfangreichen, intelligent wirkenden Artikel mit 2000 Wörtern machen. Eine oder zwei Stunden vor Redaktionsschluss fing der zuständige Redakteur an, neben meinem Schreibtisch auf und ab zu gehen, mit den Fingern zu schnipsen, um seine Nervosität zu vertreiben, und sich laut zu fragen, warum ich denn noch nicht fertig sei. Die Antwort (die ich ihm zweifelsohne öfters gab) war, dass es ein völlig absurdes Unterfangen sei, in sieben Stunden einen intelligent wirkenden Artikel mit 2000 Wörtern über ein mir bis dahin völlig unbekanntes Thema zu schreiben. Dennoch musste es sein. Somit war meine Zeit beim Guardian geprägt von einem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, extremem Zeitdruck und dem Wissen, von Anfang an in Verzug zu sein – mit kaum einer Chance, den Rückstand noch aufzuholen.
Nicht dass ich dem zuständigen Redakteur einen Vorwurf machen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits mit dem Gefühl vertraut, ständig aufholen zu müssen. Nur wenige Dinge gehören so sehr zu meiner Erfahrung des Erwachsenseins wie das unbestimmte Gefühl, dass ich in Rückstand gerate und mich wieder auf ein Minimum an Leistung herankämpfen muss, wenn ich eine nicht näher definierte Katastrophe abwenden will, die sonst über mich hereinbrechen könnte. Manchmal glaubte ich, dass ich nur etwas mehr Disziplin bräuchte, ein andermal war ich mir sicher, dass die Lösung in einem neuen System für die Organisation meiner Aufgaben und Ziele läge, das ich finden würde, sobald ich diesen Artikel über Smoothies hinter mich gebracht hätte. Ich verschlang Selbsthilfebücher, versuchte es mit Meditation und beschäftigte mich mit dem Stoizismus, wobei meine Besorgnis jedes Mal ein wenig zunahm, wenn sich eine neue Technik nicht als Königsweg erwies. Derweil waberte über allem die Illusion, eines Tages »die Dinge in den Griff zu bekommen« – wobei »Dinge« alles Mögliche sein konnte, vom Leeren meines Posteingangs bis zur Erkenntnis, wie Liebesbeziehungen funktionierten –, damit der wirklich bedeutungsvolle Teil des Lebens, der wirklich wirkliche Teil, endlich beginnen konnte.
Heute weiß ich, was ich damals noch nicht wusste – dass ich mit diesem Gefühl nicht allein bin. Eigentlich könnte ich kaum weniger allein sein. Hunderte von Gesprächen und E-Mail-Diskussionen, die ich seit 2021 geführt habe (damals veröffentlichte ich ein Buch über die Herausforderung, die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen), haben mich davon überzeugt, dass dieses Gefühl, das Leben noch nicht ganz im Griff zu haben – und sich immer mehr anstrengen zu müssen, um nicht noch weiter zurückzufallen –, heutzutage fast universell ist. Die jüngeren Menschen, denen ich begegnete, schienen angesichts der Aufgabe, ihr Leben in den Griff bekommen zu müssen, regelrecht entmutigt zu sein, während viele ältere Menschen konsterniert darüber waren, dass es ihnen mit vierzig oder fünfzig offenbar immer noch nicht gelungen war, und sie fragten sich, ob es ihnen überhaupt jemals gelingen würde. Auf jeden Fall wurde deutlich, dass Reichtum oder Ansehen das Problem nicht aus der Welt schaffen – was auch durchaus plausibel ist, denn in der heutigen Welt ist sichtbarer Erfolg oft das Ergebnis davon, dass man noch mehr als alle anderen in das unerbittliche Aufholspiel verstrickt ist. »Die meisten erfolgreichen Menschen sind nur eine wandelnde Angststörung, die auf Produktivität getrimmt wurde«, stellte der Unternehmer und Investor Andrew Wilkinson fest.
Die häufigste Form des beklemmenden Gefühls, das ich hier zu beschreiben versuche, ist die schiere, übermächtige Geschäftigkeit, das Gefühl, in der zur Verfügung stehenden Zeit viel zu viel zu tun zu haben. Es kann aber auch andere Formen annehmen. Bei manchen Menschen äußert es sich als Impostor-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt, also die Überzeugung, dass es ein Grundniveau an Fachwissen gibt, das so ziemlich alle anderen erreicht haben, man selbst aber nicht, und dass man nicht aufhören kann, an sich selbst zu zweifeln, bis man es erreicht hat. Viele Menschen leiden auch unter dem Gedanken, die Geheimnisse intimer Beziehungen noch nicht entschlüsselt zu haben, sodass sie sich trotz aller sichtbaren Errungenschaften tagtäglich durch die verwirrende Komplexität von Partnersuche, Ehe oder Elternschaft ausgebremst fühlen. Für wieder andere besteht das Gefühl des Zurückbleibens hauptsächlich darin, dass sie meinen, mehr tun zu müssen, um die nationalen und globalen Krisen, die sich um sie herum abspielen, zu bewältigen, aber nicht wissen, was sie als Einzelne tun könnten, um möglicherweise etwas zu verändern. Der rote Faden, der sich durch all diese Themen zieht, ist jedoch die Vorstellung, dass es eine bestimmte Art und Weise gibt, auf der Welt zu sein, eine Art und Weise, wie man die Situation des Menschseins im 21. Jahrhundert meistert, die man erst noch herausfinden muss. Und dass man sein Leben erst dann entspannt angehen kann, wenn man das geschafft hat.
Das Schlimmste daran ist jedoch, dass unsere Bemühungen, das Problem anzupacken, es nur zu verschlimmern scheinen. In meinem Buch 4000 Wochen habe ich eine Version dieses Problems als »Effizienzfalle« bezeichnet, um zu beschreiben, wie man, wenn man mit den anfallenden Aufgaben immer besser und schneller fertig wird, am Ende oftmals mehr zu tun hat und gestresster ist. Die E-Mail ist das klassische Beispiel: Mit dem Vorsatz, die Flut von E-Mails zu bewältigen, beginnt man, rascher zu antworten, was wiederum zu mehr Antworten führt, von denen man viele beantworten muss; außerdem erwirbt man sich den Ruf, besonders schnell auf E-Mails zu reagieren, sodass mehr Leute es für lohnend halten, einem überhaupt E-Mails zu schreiben. Wenn man sich also abmüht, alles zu erledigen, füllen sich die Tage mit weniger wichtigen Aufgaben – denn die Überzeugung, dass es einen Weg geben muss, alles zu erledigen, lässt einen vor schwierigen Entscheidungen darüber zurückschrecken, was die begrenzte Zeit wirklich wert ist.
Meine Gespräche halfen mir aber auch, ein tiefer liegendes Problem zu erkennen: Unsere ständigen Bemühungen, auf den Fahrersitz des Lebens zu gelangen, berauben es offenbar jenen Gefühls des Lebendigseins, das es überhaupt erst lebenswert macht. Die Tage verlieren, was der deutsche Gesellschaftstheoretiker Hartmut Rosa treffend als »Resonanz« bezeichnet. Die Welt fühlt sich tot an, und trotz all unserer Bemühungen, mehr zu tun, sind wir irgendwie weniger in der Lage, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das geschieht selbst dann, wenn unsere Maßnahmen, die Dinge in den Griff zu bekommen, erfolgreich sind. Man nimmt sich vor, täglich zu meditieren, und plötzlich erscheint es einem sterbenslangweilig; oder man plant einen gemeinsamen Abend mit dem Ehepartner – weil alle sagen, dass man so die Liebe frisch hält –, aber das Ganze führt dazu, dass beide so verunsichert sind, dass es zu Streitereien kommt und man sich am Ende des Abends wie ein Versager fühlt. In meiner Zeit als »Produktivitätsfanatiker« probierte ich ständig neue Systeme zur Lebensgestaltung aus, und wenn ich die entsprechende App herunterlud oder das benötigte Büromaterial kaufte, war ich aufgeregt, ja sogar berauscht: Ich war kurz davor, Großes zu leisten! Dann, nach einem oder zwei Tagen, erschien mir mein neuer Zeitplan trostlos und leblos – noch eine Aufgabenliste, durch die ich mich quälen musste. Ich ertappte mich dabei, dass ich den Idioten, der die Frechheit besaß, mir zu diktieren, wie ich meine Zeit zu verbringen hatte, voller Zorn verachtete – auch wenn ich selbst dieser Idiot war.
Das sind zugegebenermaßen harmlose Beispiele. Der Verlust an Lebendigkeit hilft aber auch, die Burn-out-Epidemie zu erklären, die nicht nur mit Erschöpfung zu tun hat, sondern auch mit der Leere, die eintritt, wenn man sich jahrelang dazu zwingt, wie eine Maschine immer mehr zu leisten, ohne dass es sich jemals genug anfühlt. Der zunehmend rabiate und konspirative Umgang in der modernen Politik könnte sogar als verzweifelter Versuch von Menschen gedeutet werden, angesichts mangelnder Resonanz überhaupt noch etwas zu fühlen.
Das Hauptproblem besteht laut Rosa darin, dass die treibende Kraft des modernen Lebens der fatale Irrglaube ist, dass die Realität immer kontrollierbarer gemacht werden kann und sollte – und dass dies letztlich zu Seelenfrieden und Wohlstand führt. Somit erleben wir die Welt als endlose Reihe von Dingen, die wir beherrschen, lernen oder erobern müssen. Wir machen uns daran, jede einzelne E-Mail noch so penibel zu bearbeiten, unsere Lesestapel zu bezwingen oder Ordnung in unsere Zeitpläne zu bringen; wir versuchen, unser Fitnessniveau oder unsere Konzentration zu optimieren, und fühlen uns verpflichtet, unsere erzieherischen Fähigkeiten, unsere Kompetenz im Bereich persönlicher Finanzen oder unser Verständnis des Weltgeschehens ständig zu verbessern. (Selbst, wenn wir etwa voller Stolz behaupten, dass uns Freundschaften wichtiger seien als Geld, kann es sein, dass wir dies im Geiste der Optimierung tun und uns bemühen, mehr Freunde zu finden oder besser mit ihnen in Kontakt zu bleiben – sprich: dass wir versuchen, mehr Kontrolle über unser soziales Leben auszuüben.) Die Kultur stärkt diese Doktrin der Kontrolle in vielfacher Weise. Dank des technischen Fortschritts scheinen wir immer kurz davorzustehen, unser Arbeitspensum endlich in den Griff zu bekommen – während ich dies schreibe, spricht alle Welt von KI-gestützten virtuellen Assistenzsystemen –, derweil uns die hyperkompetitive Wirtschaft vermittelt, dass dies zunehmend notwendig ist, um sich einigermaßen über Wasser zu halten.
Doch die alltägliche Erfahrung und jahrhundertelange philosophische Reflexion zeigen, dass ein erfülltes und erfolgreiches Leben nicht darin besteht, immer mehr Kontrolle auszuüben. Es geht nicht darum, alles immer berechenbarer und sicherer zu machen, bis man sich endlich entspannen kann. Ein Fußballspiel ist aufregend, weil man nicht weiß, wer gewinnt; ein wissenschaftliches Forschungsgebiet ist fesselnd, weil man es noch nicht ganz durchschaut hat. Die größten Errungenschaften beruhen oft darauf, dass man für Zufälle offen bleibt, ungeplante Gelegenheiten ergreift oder unerwartete Motivationsschübe erlebt. Wer von einem anderen Menschen begeistert oder von einer Landschaft oder einem Kunstwerk berührt ist, braucht nicht die volle Kontrolle zu haben. Andererseits verlangt ein gutes Leben natürlich nicht, dass man jede Hoffnung aufgibt, die Realität zu beeinflussen. Es geht darum, beherzt zu handeln, etwas zu gestalten und zu bewirken – nur ohne den Anspruch, die volle Kontrolle zu erlangen. Resonanz beruht auf Gegenseitigkeit: Man tut etwas – gründet ein Unternehmen, organisiert eine Kampagne, macht sich auf den Weg in die Wildnis, verschickt die E-Mail über das soziale Ereignis – und sieht dann, wie die Welt darauf reagiert.
Es ist kaum verwunderlich, dass viele Menschen einen großen Teil ihres Lebens damit verbringen, sich in eine beherrschende Position gegenüber einer Realität zu bringen, die ansonsten völlig unkontrollierbar und übermächtig erscheinen kann. Wie sonst soll man all seine Aufgaben bewältigen, ein paar hochgesteckte Ziele verfolgen, versuchen, ein anständiger Elternteil oder Partner zu sein, und seinen Beitrag als Bürger einer krisengeschüttelten Welt leisten? Aber es funktioniert nicht. Das Leben wird zunehmend zu einer langweiligen, einsamen und oft nervtötenden Pflicht, zu etwas, das man ertragen muss, um in eine vermeintlich bessere Zeit zu gelangen, die aber irgendwie niemals wirklich kommt.
Leider nicht unsterblich versucht, dort anzusetzen, wo die »Bring dein Leben in Ordnung«-Denkweise scheitert, und stattdessen einen sinnvolleren und produktiveren Weg aufzuzeigen, der außerdem noch mehr Spaß macht. (Die Kapitel stützen sich stark auf meinen E-Mail-Newsletter The Imperfectionist und auf viele hilfreiche Antworten von dessen Lesern.) Anstatt die Fantasie zu beflügeln, eines Tages alles unter Kontrolle zu bekommen, geht dieses Buch davon aus, dass man nie alles im Griff haben wird. Es geht davon aus, dass man nie ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken oder ganz verstehen wird, wie andere Menschen ticken – und dass immer zu viel zu tun sein wird.
Das liegt aber nicht daran, dass Sie ein undisziplinierter Verlierer sind oder dass Sie noch nicht den richtigen Bestseller gelesen haben, in dem Produktivität, Führung, Elternschaft oder anderes »überraschend wissenschaftlich« erläutert werden. Es liegt vielmehr daran, dass Sie ein endlicher Mensch sind, was bedeutet, dass Sie niemals die Art von Kontrolle oder Sicherheit erlangen werden, von der viele von uns glauben, dass unsere geistige Gesundheit davon abhängt. Es bedeutet schlicht und einfach, dass die Liste lohnender Dinge, auf die man prinzipiell seine Zeit verwenden könnte, immer sehr viel länger ist als die Liste der Dinge, für die man Zeit hat. Es bedeutet, dass man immer anfällig für unvorhergesehene Katastrophen oder belastende Emotionen ist und nie mehr als einen begrenzten Einfluss darauf haben wird, wie sich die eigene Zeit entfaltet, ganz gleich, was YouTuber Anfang zwanzig ohne Kinder über die ideale Morgenroutine erzählen mögen.
Imperfektionismus ist eine Sichtweise, die dies als positiv begreift. Natürlich ist es schmerzhaft, sich der eigenen Endlichkeit zu stellen (deshalb ist das Streben nach Kontrolle ja so verlockend). Die Konfrontation mit den eigenen, nicht verhandelbaren Begrenzungen bedeutet, zu akzeptieren, dass das Leben harte Entscheidungen und Opfer mit sich bringt, dass Reue immer eine Möglichkeit ist, ebenso wie die Enttäuschung anderer, und dass nichts, was man in der Welt erschafft, jemals den perfekten Maßstäben im eigenen Kopf entsprechen wird. Aber genau diese Wahrheiten sind es auch, die einen zum Handeln und damit zur Erfahrung von Resonanz befähigen. Wenn man den nicht zu gewinnenden Kampf aufgibt, immer und alles tun zu müssen, dann kann man seine begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit auf eine Handvoll Dinge verwenden, die wirklich zählen. Wenn man von seinem kreativen Schaffen, seinen Beziehungen oder anderen Dingen keine Perfektion mehr erwartet, dann ist man frei, sich mit voller Kraft hineinzustürzen. Wenn man seine geistige Gesundheit oder sein Selbstwertgefühl nicht mehr davon abhängig macht, dass man eine für Menschen unerreichbare Kontrolle erlangt, kann man beginnen, sich geistig gesund zu fühlen und das Leben im Jetzt zu genießen, denn das ist die einzige Zeit, in der es tatsächlich stattfindet.
In diesem Buch möchte ich zudem ein Problem ansprechen, das mich schon seit Jahren beschäftigt, wenn es um Bücher geht, die den Menschen helfen sollen, sinnvoller oder produktiver zu leben. Die schlechtesten davon bieten nur eine Liste von Schritten, die man umsetzen soll – was fast nie funktioniert, da sie die innere Reise des Autors ausklammern, die dieser unternehmen musste, um dorthin zu gelangen. (Hatte der Autor beispielsweise mit den emotionalen Ursachen seines Unvermögens zu kämpfen, sich zu organisieren, warum sollte es uns dann helfen, eine Liste mit Organisationstipps zu befolgen?) Bessere Bücher bieten einen Perspektivwechsel, ein gewandeltes Verständnis, aus dem andere Maßnahmen resultieren können. Allerdings verblassen Perspektivwechsel deprimierend schnell: Ein paar Tage lang scheint alles anders zu sein, doch dann setzt sich die überwältigende Dynamik gewohnter Vorgehensweisen wieder durch.
Mein Ziel ist deshalb, dass das, was Sie auf den folgenden Seiten als hilfreich empfinden, Ihnen in Fleisch und Blut übergeht – und somit bestehen bleibt. Wie Sie dieses Buch lesen, gehört natürlich zu den zahllosen Aspekten einer Realität, die ich unmöglich kontrollieren kann, und man kann es durchaus wie jedes andere angehen. Trotzdem empfehle ich Ihnen, jeden Tag ein Kapitel zu lesen, und zwar der Reihe nach, in vier aufeinanderfolgenden Wochen: In der ersten Woche müssen Sie sich den Tatsachen der eigenen Endlichkeit stellen; in der zweiten Woche mutige, unvollkommene Maßnahmen ergreifen; in der dritten Woche über Ihren eigenen Schatten springen und das Geschehen auf sich zukommen lassen; in der vierten Woche schließlich sollten Sie sich ganz auf das Leben einlassen, und zwar in der Gegenwart und nicht erst später.
Wenn ich dieses Buch als »Rückzug des Geistes« bezeichne, dann will ich damit sagen, dass Sie es als Rückkehr zu einem metaphorischen Zufluchtsort in einer ruhigen Ecke Ihres Gehirns betrachten, wo Sie neue Gedanken zulassen können, ohne den Rest Ihres Lebens unterbrechen zu müssen. Dennoch bleiben diese Gedanken im Hintergrund, während Sie durch den Tag gehen. Die Kapitel enthalten sowohl Perspektivwechsel als auch praktische Techniken, und ich hoffe, dass gelegentlich etwas davon Ihr Leben in den vierundzwanzig Stunden nach der Lektüre auf eine kleine, aber konkrete Weise verändern wird. Nach meiner Erfahrung sind Veränderungen nur dann von Dauer, wenn sie durch echtes Feedback aus dem wirklichen Leben bestätigt werden.
Wenn Leider nicht unsterblich in diesem Rahmen funktioniert, kann ich freilich nur erwarten, dass es unvollkommen funktioniert. Deshalb empfehle ich, keine allzu großen Anstrengungen zu unternehmen, das Gelesene zu verinnerlichen oder in die Praxis umzusetzen; vertrauen Sie stattdessen darauf, dass etwas, das Sie anspricht, von selbst den Tag überdauern wird. Dies ist nicht eines jener Bücher, die versprechen, dass Sie das ideale System für Ihr Leben gefunden haben, wenn Sie alle Vorgaben fehlerfrei umsetzen. Die menschliche Endlichkeit bewirkt, dass das nie eintreten wird. Und genau das ist der Grund, warum man sich voll und ganz in dieses Leben stürzen sollte – und zwar jetzt!
Erste Woche
Die eigene Endlichkeit
»Wenn du dich im Wald verirrt hast, scheiß drauf, bau dir ein Haus. ›Ich hatte mich verirrt, aber jetzt wohne ich hier! Ich habe meine schwierige Lage erheblich verbessert!‹«
Mitch Hedberg
Tag 1: Es ist schlimmer, als Sie denken
Warum Niederlagen befreiend sein können
»Was wahr ist, ist bereits wahr. Es wird nicht schlimmer, wenn man es zugibt. Es verschwindet auch nicht dadurch, dass man nicht offen darüber spricht. Und weil es wahr ist, kann man damit interagieren. Alles, was nicht wahr ist, kann nicht gelebt werden. Die Menschen können das Wahre verkraften, denn sie ertragen es bereits.«
Eugene Gendlin
Wenn Sie mehr Zeit auf diesem Planeten damit verbringen wollen, das zu tun, was Ihnen wichtig ist, besteht der befreiendste, stärkste und produktivste Schritt darin, zu begreifen, dass das Leben als endliches menschliches Wesen – mit begrenzter Zeit und begrenzter Kontrolle über diese Zeit – in Wirklichkeit viel schlimmer ist, als Sie denken. Völlig hoffnungslos, um genau zu sein. Kennen Sie diese Wolke der Melancholie, die sich manchmal über Sie legt – wenn Sie nachts um drei Uhr aufwachen oder am Ende eines anstrengenden Donnerstags auf der Arbeit –, wenn es so aussieht, als würde sich das Leben, das Sie sich vorgestellt haben, vielleicht doch nie verwirklichen lassen? Die Magie beginnt, wenn Sie erkennen, dass es sich definitiv nicht verwirklichen lässt.
Es stimmt, dass man mir vorgeworfen hat, ich sei ein Spielverderber. Deshalb sollte ich wohl zu erklären versuchen, warum dies überhaupt nicht deprimierend ist. Nehmen wir – nur für den Anfang – das bekannte Phänomen, dass man sich von einer extrem langen To-do-Liste überfordert fühlt. Man glaubt, das Problem bestünde darin, dass man viel zu viele Dinge zu tun hat und nicht genügend Zeit, um sie zu erledigen, sodass die einzige Hoffnung darin besteht, seine Zeit so effizient wie möglich einzuteilen, außergewöhnliche Energiereserven zu mobilisieren, sämtliche Ablenkungen auszublenden und irgendwie bis zum Ende durchzuhalten. In Wahrheit ist die Situation schlimmer, als Sie denken, denn der Zustrom an Dingen, die vermeintlich unbedingt zu erledigen sind, ist nicht nur groß, sondern im Grunde genommen unendlich. Alles zu erledigen ist also nicht nur äußerst schwierig, sondern unmöglich.