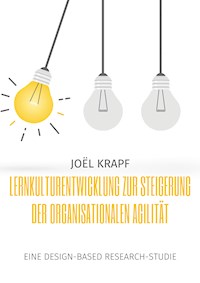
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Rahmen einer Dissertation an der Universität St.Gallen entstand diese praxisnahe Forschungsarbeit zum Thema Lernkulturentwicklung zur Steigerung der Agilität. Im Buch wird zuerst theoretisch aufgearbeitet, wie Lernkulturentwicklung zur Agilität einer Organisation beiträgt. Anschliessend werden in einem Design-Based Ansatz konkrete Projekte vorgestellt und reflektiert. Am Ende werden aus den Forschungsberichten kontextsensitive Gestaltungsprinzipien erarbeitet, die es anderen Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung der Lernkultur zur Steigerung der Agilität anzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lernkulturentwicklung zur Steigerung der organisationalen Agilität Eine Design-Based Research-Studie
DISSERTATION
der Universität St.Gallen,
Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften
sowie Internationale Beziehungen (HSG)
zur Erlangung der Würde eines
Doktors der Sozialwissenschaften
vorgelegt von
Joël Daniel Krapf
von
Gaiserwald (St.Gallen)
Genehmigt auf Antrag von
Frau Prof. Dr. Sabine Seufert
und
Frau Prof. Dr. Heike Bruch
Dissertation Nr. 4840
Vorwort
Das Vorwort ist eine sehr spezielle Seite. Während es für die Lesenden ein leichter bzw. leicht zu überspringender Beginn in die Lektüre ist, ist es für mich als Autor der Schlusspunkt einer intensiven Auseinandersetzung. Viele Tage und Nächte habe ich mich nicht nur mit dem vorliegenden Dokument auseinandergesetzt, sondern auch mit den Inhalten, die ich schlussendlich darin festgehalten habe. Und auch wenn sich das vorliegende Schlussprodukt über viele Seiten erstreckt, so ist es doch nur ein Bruchteil der Arbeit, die nötig war, um diese Buchstaben aneinanderzureihen.
Ich möchte allen Menschen danken, die mich bewusst oder unbewusst in dieser intensiven Zeit unterstützt haben.
Speziell danken möchte ich meinen Eltern Denise Krapf-Aeberli und Walter Krapf, die mich auf meinem Lebenspfad stets und uneingeschränkt so zur Seite stehen, dass ich mit ihnen meinen eigenen Weg gehen kann. Ohne sie wäre diese Dissertation nicht möglich gewesen.
Einen grossen Dank gebührt meiner Doktormutter Prof. Dr. Sabine Seufert, die es mir überhaupt ermöglicht hat, eine praxisorientierte Dissertation zu verfolgen. Ich hätte mir keine bessere Unterstützung vorstellen können, als jene von Sabine Seufert, die mich in jeder Phase mit gezielten Inputs in der Spur hielt, ohne mir dabei vorzugeben, wohin ich laufen muss. Hierbei gilt der Dank ebenfalls meiner Ko-Referentin Prof. Dr. Heike Bruch, die auf meinen fahrenden Schnellzug aufgesprungen ist und dabei mit zielsicheren Fragen entscheidende Korrekturen ermöglichte.
Ohne die Schweizerische Post wäre diese Arbeit nie entstanden. Ich danke deshalb Thomas Meier, Dr. Hannah Zaunmüller, Claudia Pletscher, Yves-André Jeandupeux und allen Praxispartner, die mir erlaubt haben, das Thema Agilität in die Post zu bringen und dabei nicht nur für meine Doktorarbeit viel zu lernen.
Auch wenn ich meine Forschung gefühlsmässig mit relativ wenig Umwegen durchführen konnte, so war die Dissertation ein hoch intensiver Reflexions- und Lernprozess. Ich danke deshalb Oliver Aebischer, Dr. Yordan Athanassov, Dominik Balmer, Marc-André Böhlen, Nadia Eggmann, Florian Fertl, Hanneke Gerritsen, Max Gissler, Dr. Claudia Kaiser, Roland Keller, Roger Lötscher, Thomas Meier, Florus Mulder, Dr. Sebastian Otte, Marcel Reinhard, Dr. Carole Rentsch, Lorenz Ryser, Hervé Salzmann, Christian Schneider, Jürg Stettler, Lorenz Wyss, Carmen Zanella und vielen mehr für die inspirierenden Gespräche und Unterstützung.
Inhaltsübersicht
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
Summary
Teil A: Einleitung und Forschungsgrundlagen
Problemstellung
1.1 Digitale Transformation als Treiber der Veränderungsdynamik
1.2 Agilität als Antwort auf die gesteigerte Veränderungsdynamik
Forschungsrelevanz, Forschungsziel und Forschungsfragen
Aufbau der Arbeit
Forschungsparadigmatische Ausrichtung
4.1 Grundlagen des Konstruktivismus
4.2 Leitende epistemologische Grundlage des Forschungsvorhabens
Design-Based Research als leitende Forschungsstrategie
5.1 Konstitutive Merkmale der Gestaltungsforschung
5.2 Wissenschaftliche Grundsätze der Gestaltungsforschung
5.3 Begründung der Wahl für ein gestaltungsbasiertes Forschungsdesign
5.4 Ablauf des Forschungsvorhabens
Zwischenfazit
Teil B: Theoretischer Bezugsrahmen und Gestaltungshypothesen
Theoretische Fundierungen und forschungsleitende Verständnisse
1.1 Organisationsverständnis
1.2 Organisationales Lernen
1.3 Lernende Organisation
1.4 Lernkultur
1.5 Zusammenfassung der forschungsleitenden Verständnisse
Theoriegeleitete Designannahmen als Grundlage für die empirische Forschungs- und Gestaltungsarbeit
2.1 Bezugsrahmen der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung
2.2 Gestaltungsannahmen zur Lernkulturentwicklung
Zwischenfazit
Teil C: Empirische Umsetzung des Forschungs- & Gestaltungsprozesses
Präzisierung des Forschungs- und Gestaltungsprozesses
1.1 Klärung des Untersuchungsrahmens
1.2 Klärung der empirischen Vorgehensweise
Durchführung und Ergebnisse des ersten Meso-Zyklus
2.1 Teamspezifische Kontextbedingungen
2.2 Überblick zum Gestaltungsprozess
2.3 Beschreibung der Ergebnisse
2.4 Fallspezifische Reflexion der Ergebnisse
2.5 Fallspezifische Gestaltungsprinzipien
Durchführung und Ergebnisse des zweiten Meso-Zyklus
3.1 Teamspezifische Kontextbedingungen
3.2 Überblick zum Gestaltungsprozess
3.3 Beschreibung der Ergebnisse
3.4 Fallspezifische Reflexion der Ergebnisse
3.5 Fallspezifische Gestaltungsprinzipien
Durchführung und Ergebnisse des dritten Meso-Zyklus
4.1 Teamspezifische Kontextbedingungen
4.2 Überblick zum Gestaltungsprozess
4.3 Beschreibung der Ergebnisse
4.4 Fallspezifische Reflexion der Ergebnisse
4.5 Fallspezifische Gestaltungsprinzipien
Zwischenfazit
Teil D: Fallübergreifende Analyse zur Entwicklung kontextsensitiver Gestaltungsprinzipien
Vergleichende Analysen
1.1 Vergleich der teamspezifischen Ergebnisse
1.2 Vergleich der teamspezifischen Kontextbedingungen
Kontextsensitive Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung
Exkurs: Anwendungsbeispiele für die Praxis
3.1 Teamworkshop zur Lernkulturentwicklung
3.2 Entwicklung eines Zielbildes für Agilität
3.3 Methodologie zur agilen Kulturentwicklung
Zwischenfazit
Teil E: Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Rückblick
1.1 Konsolidierung der Forschungsergebnisse anhand des Forschungsziels und der Forschungsfragen
1.2 Reflexion des Forschungsvorhabens anhand der forschungsleitenden Gütemerkmale
Ausblick und Forschungsdesiderate
Teil F: Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang 1: Gesprächsverzeichnis
Anhang 2: Personenverzeichnis
Anhang 3: Dokumentenverzeichnis
Anhang 4: Fragebogen zum normativen Zielbild (DLOQ)
Anhang 5: Gesprächsleitfaden zur Erfassung der Lernkultur
Anhang 6: Drehbuch Workshop Handlungsfelder determinieren
Anhang 7: Gesprächsleitfaden Alpha-Test
Anhang 8: Beobachtungs- und Gesprächsbogen Beta-Test
Anhang 9: Gesprächsleitfaden Beta-Test
Anhang 10: Quantitative Lernkulturerfassung P14
Anhang 11: Quantitative Lernkulturerfassung PMG6
Anhang 12: Quantitative Lernkulturerfassung PF14 (Dietikon)
Anhang 13: Quantitative Lernkulturerfassung PF14 (Luzern)
Anhang 14: Quantitative Lernkulturerfassung PF14 (Thun)
Anhang 15: Quantitative Lernkulturerfassung PF14 (Winterthur)
Anhang 16: Quantitative Lernkulturerfassung PF14 (konsolidiert)
Anhang 17: Finaler Massnahmenkatalog
Anhang 18: Praxisworkshop zur Skalierung
Anhang 19: Agile Culture Check
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Technologische Entwicklungen der digitalen Transformation
Abbildung 2: Netzwerkökonomie in der digitalen Transformation
Abbildung 3: Agilität als Antwort auf die gesteigerte Veränderungsdynamik
Abbildung 4: Gestaltungsfelder zur Agilität
Abbildung 5: Forschungsleitende Gütemerkmale
Abbildung 6: Zyklus eines gestaltungsorientierten Forschungsvorhabens
Abbildung 7: Evaluationsstrategien
Abbildung 8: Evaluationsmethoden
Abbildung 9: Organisation als (personales) System
Abbildung 10: Entscheidungszyklus als Form organisationalen Lernens
Abbildung 11: Der organisatorische Lernzirkel
Abbildung 12: Organisationales Lernen systemisch-konstruktivistischer Sicht
Abbildung 13: Die sieben Handlungsdimensionen zur lernenden Organisation
Abbildung 14: Checkliste für ein lernendes Unternehmen
Abbildung 15: Die fünf Disziplinen einer lernenden Organisation
Abbildung 16: Gegenüberstellung von organisationalem Lernen und lernender Organisation
Abbildung 17: Überblick der forschungsleitenden Verständnisse
Abbildung 18: Zweigestalt der Lernkulturentwicklung im dynamischen Ansatz
Abbildung 19: Drei-Ebenen-Modell der Kultur
Abbildung 20: Die vier Wissensarten als dynamisches Kulturkonstrukt
Abbildung 21: Rahmen zur Beschreibung der Kultur
Abbildung 22: Rahmen zur verstehenden Beschreibung der Lernkultur
Abbildung 23: Suchhäufigkeit von Agilität und lernender Organisation
Abbildung 24: Die sieben Gestaltungsvariablen des DLOQ als Entwicklungsorientierung
Abbildung 25: Zweigestalt der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung
Abbildung 26: Vorgehen zur Lernkulturentwicklung bei den Pilotteams
Abbildung 27: Methodologischer Prototyp zur Lernkulturentwicklung
Abbildung 28: Konzernstruktur der Schweizerischen Post per 1. Januar 2017
Abbildung 29: Spannungsfeld in der Geschäftstätigkeit der Post
Abbildung 30: Forschungs- und Gestaltungsprozess im Überblick
Abbildung 31: Grundstruktur des Workshops zur Bestimmung der Handlungsfelder
Abbildung 32: Gewählte Evaluationsstrategien in Abhängigkeit zum Evaluationsfokus
Abbildung 33: Eingesetzte Evaluationsmethoden
Abbildung 34: Effektiver Evaluationsplan
Abbildung 35: Organigramm Team ‹Kulturentwicklung›
Abbildung 36: Überblick zum Gestaltungsprozess mit P14
Abbildung 37: Überspitzes Ist-Bild der Lernkultur von P14
Abbildung 38: Mittelwerte der sieben DLOQ-Dimensionen bei P14
Abbildung 39: Handlungsfelder P14 zur Lernkulturentwicklung – Version 1
Abbildung 40: Handlungsfelder P14 zur Lernkulturentwicklung – Version 2
Abbildung 41: Erster Lösungsprototyp P14
Abbildung 42: Reflexionsinstrument P14
Abbildung 43: Angepasster Massnahmenkatalog P14
Abbildung 44: Finaler Massnahmenplan P14
Abbildung 45: Organigramm Team ‹Letzte Meile› und ‹Kundenlösungen›
Abbildung 46: Überblick zum Gestaltungsprozess mit PMG6
Abbildung 47: Überspitzes Ist-Bild der Lernkultur von PMG6
Abbildung 48: Mittelwerte der sieben DLOQ-Dimensionen bei PMG6
Abbildung 49: Handlungsfelder PMG6 zur Lernkulturentwicklung
Abbildung 50: Erster Lösungsprototyp PMG6
Abbildung 51: Erste Version des Reflexioncanvas PMG6
Abbildung 52:Prototyp zum Teilen von Erkenntnissen bei PMG6
Abbildung 53: Zweite Version des Reflexion-Canvas PMG6
Abbildung 54: Dritte Version des Reflexions-Canvas bei PMG6
Abbildung 55: Finaler Massnahmenplan PMG6
Abbildung 56: Auszug aus dem Organigramm ‹Vertrieb Privatkunden›
Abbildung 57: Überblick zum Gestaltungsprozess mit PF14
Abbildung 58: Überspitzes Ist-Bild der Lernkultur von PF14 (Dietikon)
Abbildung 59: Überspitzes Ist-Bild der Lernkultur von PF14 (Luzern)
Abbildung 60: Überspitzes Ist-Bild der Lernkultur von PF14 (Thun)
Abbildung 61: Überspitzes Ist-Bild der Lernkultur von PF14 (Winterthur)
Abbildung 62: Mittelwerte der sieben DLOQ-Dimensionen bei PF14 (Dietikon)
Abbildung 63: Mittelwerte der sieben DLOQ-Dimensionen bei PF14 (Luzern)
Abbildung 64: Mittelwerte der sieben DLOQ-Dimensionen bei PF14 (Thun)
Abbildung 65: Mittelwerte der sieben DLOQ-Dimensionen bei PF14 (Winterthur)
Abbildung 66: Handlungsfelder PF14 (Dietikon) zur Lernkulturentwicklung
Abbildung 67: Handlungsfelder PF14 (Luzern) zur Lernkulturentwicklung
Abbildung 68: Handlungsfelder PF14 (Thun) zur Lernkulturentwicklung
Abbildung 69: Handlungsfelder PF14 (Winterthur) zur Lernkulturentwicklung
Abbildung 70: Erster Lösungsprototyp PF14 (Dietikon)
Abbildung 71: Regeln für Feedbackgebende
Abbildung 72: Lösungsansatz zur Förderung der (Eigen-)Reflexion
Abbildung 73: Finaler Massnahmenplan PF14 (Dietikon)
Abbildung 74: Erster Lösungsprototyp PF14 (Luzern)
Abbildung 75: Lösungsdesign zur Förderung der Teamziele PF14 (Luzern)
Abbildung 76: Finaler Massnahmenplan PF14 (Luzern)
Abbildung 77: Erster Lösungsprototyp PF14 (Thun)
Abbildung 78: Lösungsdesign zur Förderung der Teamziele PF14 (Thun)
Abbildung 79: Finaler Massnahmenplan PF14 (Thun)
Abbildung 80: Erster Lösungsprototyp PF14 (Winterthur)
Abbildung 81: Lösungsdesign zur Förderung der Teamziele PF14 (Winterthur)
Abbildung 82: Finaler Massnahmenplan PF14 (Winterthur)
Abbildung 83: Übersicht zur strukturellen Verortung der teilnehmenden Praxisteams
Abbildung 84: Referenzmodell zur agilen Kultur als Basis für ein generelles Zielbild
Abbildung 85: Vorgehensmodell zur agilen Kulturentwicklung
Abbildung 86: Aufbau und Grobablauf der empirischen Umsetzung
Abbildung 87: Die vier thematischen Säulen der Forschungsdesiderate
Abbildung 88: Vorlage zur Entwicklung von Massnahmenideen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Inhaltliche Grobstruktur der Forschungsarbeit
Tabelle 2: Fragestellungen und angestrebte Ergebnisse der Forschungs
Tabelle 3: Aktivitäten und Ergebnisse Phase 1 – Problempräzisierung
Tabelle 4: Aktivitäten und Ergebnisse Phase 2 – Theoretischer Bezugsrahmen
Tabelle 5: Aktivitäten und Ergebnisse Phase 3 – Gestaltungsannahmen
Tabelle 6: Aktivitäten und Ergebnisse Phase 4 – Evaluationskonzept
Tabelle 7: Aktivitäten und Ergebnisse Phase 5 – Gestaltungsprinzipien
Tabelle 8: Aktivitäten und Ergebnisse Phase 6 – Konsolidierte Gestaltungsprinzipien
Tabelle 9: Gegenüberstellung der verschiedenen Kulturansätze
Tabelle 10: Suchbegriffe der systematischen Literaturrecherche
Tabelle 11: Vorläufige Gestaltungsannahmen als Grundlage für die empirische Forschung
Tabelle 12: Übersicht der provisorischen Beantwortung der leitenden Forschungsfragen
Tabelle 13: Gegenüberstellung der Problemstellung aus Praxis- und Wissenschaftssicht
Tabelle 14: Vergleich der Rollenbilder aus Praxis- und Wissenschaftssicht
Tabelle 15: Überblick über die eingesetzten Evaluationsinstrumente
Tabelle 16: Beteiligte der Evaluation für die entsprechenden Methoden
Tabelle 17: Systematische Literaturrecherche zu den Handlungsfeldern P14
Tabelle 18: Qualitative Lernkulturerfassung P14: Lexikalisches Wissen
Tabelle 19: Qualitative Lernkulturerfassung P14: Handlungswissen
Tabelle 20: Qualitative Lernkulturerfassung P14: Rezeptwissen
Tabelle 21: Qualitative Lernkulturerfassung P14: Axiomatisches Wissen
Tabelle 22: Zusammenfassung quantitative Lernkulturerfassung von P14
Tabelle 23: Gestaltungsprinzip 1 nach dem ersten Meso-Zyklus
Tabelle 24: Gestaltungsprinzip 2 nach dem ersten Meso-Zyklus
Tabelle 25: Gestaltungsprinzip 3 nach dem ersten Meso-Zyklus
Tabelle 26: Gestaltungsprinzip 4 nach dem ersten Meso-Zyklus
Tabelle 27: Gestaltungsprinzip 5 nach dem ersten Meso-Zyklus
Tabelle 28: Gestaltungsprinzip 6 nach dem ersten Meso-Zyklus
Tabelle 29: Systematische Literaturrecherche zu den Handlungsfelder PMG6
Tabelle 30: Qualitative Lernkulturerfassung PMG6: Lexikalisches Wissen
Tabelle 31: Qualitative Lernkulturerfassung PMG6: Handlungswissen
Tabelle 32: Qualitative Lernkulturerfassung PMG6: Rezeptwissen
Tabelle 33: Qualitative Lernkulturerfassung PMG6: Axiomatisches Wissen
Tabelle 34: Zusammenfassung quantitative Lernkulturerfassung von PMG6
Tabelle 35: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 1 nach dem zweiten Meso-Zyklus
Tabelle 36: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 2 nach dem zweiten Meso-Zyklus
Tabelle 37: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 3 nach dem zweiten Meso-Zyklus
Tabelle 38: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 4 nach dem zweiten Meso-Zyklus
Tabelle 39: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 5 nach dem zweiten Meso-Zyklus
Tabelle 40: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 6 nach dem zweiten Meso-Zyklus
Tabelle 41: Systematische Literaturrecherche zu den Handlungsfeldern PF14 (Dietikon)
Tabelle 42: Systematische Literaturrecherche zu den Handlungsfeldern PF14 (Luzern)
Tabelle 43: Systematische Literaturrecherche zu den Handlungsfeldern PF14 (Thun)
Tabelle 44: Systematische Literaturrecherche zu den Handlungsfeldern PF14 (Winterthur)
Tabelle 45: Qualitative Lernkulturerfassung PF14: Lexikalisches Wissen
Tabelle 46: Qualitative Lernkulturerfassung PF14: Handlungswissen
Tabelle 47: Qualitative Lernkulturerfassung PF14: Rezeptwissen
Tabelle 48: Qualitative Lernkulturerfassung PF14: Axiomatisches Wissen
Tabelle 49: Zusammenfassung quantitative Lernkulturerfassung von PF14 (Dietikon)
Tabelle 50: Zusammenfassung quantitative Lernkulturerfassung von PF14 (Luzern)
Tabelle 51: Zusammenfassung quantitative Lernkulturerfassung von PF14 (Thun)
Tabelle 52: Zusammenfassung quantitative Lernkulturerfassung von PF14 (Winterthur)
Tabelle 53: Reflexionsfragen zur Entwicklung von Handlungsfeldern bei PF14 (Dietikon)
Tabelle 54: Reflexionsfragen zur Entwicklung von Handlungsfeldern bei PF14 (Luzern)
Tabelle 55: Reflexionsfragen zur Entwicklung von Handlungsfeldern bei PF14 (Thun)
Tabelle 56: Reflexionsfragen zur Entwicklung von Handlungsfeldern bei PF14 (Winterthur)
Tabelle 57: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 1 nach dem dritten Meso-Zyklus
Tabelle 58: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 2 nach dem dritten Meso-Zyklus
Tabelle 59: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 3 nach dem dritten Meso-Zyklus
Tabelle 60: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 4 nach dem dritten Meso-Zyklus
Tabelle 61: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 5 nach dem dritten Meso-Zyklus
Tabelle 62: Weiterentwicklung Gestaltungsprinzip 6 nach dem dritten Meso-Zyklus
Tabelle 63: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 1
Tabelle 64: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 2
Tabelle 65: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 3
Tabelle 66: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 4
Tabelle 67: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 5
Tabelle 68: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 6
Tabelle 69: Kontextsensitives Gestaltungsprinzip Nr. 7
Zusammenfassung
In der vorliegenden Forschungs- und Gestaltungsarbeit wurden mit einem Design-Based Research-Ansatz Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Steigerung der organisationalen Agilität entwickelt.
Ausgangspunkt des dargestellten Forschungsvorhabens bildet eine Erläuterung der Problemstellung, bei der darauf eingegangen wird, weshalb und wie die digitale Transformation die Veränderungsdynamik für Unternehmen erhöht. Daraus wird die Notwendigkeit für Agilität als systemische Veränderungsfähigkeit abgeleitet und es wird begründet, weshalb Lernkultur hierzu einen elementaren Stellhebel darstellt.
Nach dieser Einleitung wird der theoretische Bezugsrahmen gespannt. Hierfür werden die notwendigen theoretischen Fundierungen gelegt, die sich aus der forschungsparadigmatischen und forschungspragmatischen Ausrichtungen ergeben. Es folgt – wie in der Gestaltungsforschung üblich – die Entwicklung der provisorischen Gestaltungsannahmen.
Anschliessend folgt die empirische Umsetzung, bei der zuerst der Praxispartner sowie die eingesetzten Methoden vorgestellt werden. Daraufhin wird die iterative Forschungs- und Gestaltungsarbeit mit drei unterschiedlichen Teams ausführlich präsentiert und reflektiert. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, wie in den verschiedenen Einzelfällen die Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung verfolgt wurde.
Die drei fallspezifischen Ergebnisse werden dann konsolidiert, um daraus im Sinne des Forschungsziels kontextsensitive Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung zu erarbeiten. Dabei wird in einem Exkurs auch aufgezeigt, wie diese Prinzipien von der Praxis ohne wissenschaftliche Begleitung umgesetzt und skaliert werden können.
Die vorliegende Forschungsarbeit schliesst einerseits mit einem Rückblick, bei dem Forschungsergebnisse sowie -prozess reflektiert werden. Andererseits werden weitere Forschungsdesiderate aufgezeigt.
Summary
In this study, a design-based research approach is used to formulate design principles of developing a learning culture that enhances the organizational agilitya.
The study begins by providing an explanation of the problem at hand, and it addresses the questions of why and how digital transformation increases the dynamics of change in organizations. Hence, the importaince of agility as a systemic ability for change is highlighted. Further light is shed on the definition of a learning culture as an elementary lever for fostering agility.
Following the introduction, the theoretical framework is established. For this purpose, the necessary theoretical foundations are laid, which build on the research paradigmatic and research pragmatic orientations. Subsequently, following the well-established steps in conducting design-based research, tentative design assumptions are developed.
Subsequently, in the empirical implementation, the project partner and the methods used are introduced. This is then followed by the presentation and reflection on the iterative research with three distinctive teams. Thereby, the focus lies on the presentation of how the different teams approached the learning culture development in order to increase agility.
The three case-specific results are then consolidated for the purpose of formulating context-sensitive design principles of developing a learning culture for fostering agility. A digression is introduced to illustrate how the respective principles can be practically implemented and scaled without scientific support.
The study concludes with a review and a reflection on the research process and results. Finally, in moving the debate forward, further research desiderata are discussed.
Teil A: Einleitung und Forschungsgrundlagen
«Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald
man aufhört, treibt man zurück»
Benjamin Britten (1913–1976)
1 Problemstellung
Die digitale Transformation im Sinne der vierten Industriellen Revolution ist nicht vergleichbar mit der Digitalisierung, die die dritte industrielle Revolution charakterisierte (Bauer et al. 2014, S. 10). Wenngleich im Alltagsgebrauch die beiden Begriffe teilweise synonym verwendet werden, so bedeutet die digitale Transformation im Gegensatz zur Digitalisierung eine höhere Veränderungsgeschwindigkeit, ein breiteres Veränderungsausmass sowie eine grössere Veränderungswirkung (Vey et al. 2017, S. 2). Die vorliegende Forschungsarbeit möchte näher untersuchen, wie Organisationen mit dieser Veränderungsdynamik effektiv(er) und effizient(er) umgehen können. Hierfür wird zunächst etwas ausführlicher darauf eingegangen, woher diese gesteigerte Veränderungsdynamik rührt. Anschliessend wird mit der Agilität ein Begriff eingeführt, der derzeit (vor allem in der Praxis) in diesem Zusammenhang eine Hochkonjunktur erlebt (Denning 2015, S. 10; Mollbach und Bergstein 2015, S. 7). Diese etwas allgemein gehaltene Umweltskizzierung dient dann im darauffolgenden Kapitel (Teil A: 2) dazu, die Relevanz der Lernkulturentwicklung als Forschungsfokus zu begründen.
1.1 Digitale Transformation als Treiber der Veränderungsdynamik
Ursache für die nochmals zunehmende Veränderungsdynamik ist wie erwähnt zu einem grossen Teil die digitale Transformation. Während Erfindungen wie der Computer oder das Internet die dritte industriellen Revolution prägten, zeichnet sich die vierte industrielle Revolution nicht zuletzt durch die technologische Möglichkeit aus, immer kompliziertere Prozesse automatisieren zu können. So ermöglichen es sogenannte Cyber-Physical Systems (CPS), dass quasi alle physischen Maschinen mit dem Internet verbunden werden können (Brühl 2015, S. 70). Das Potenzial zur Automatisierung durch CPS wird durch das Cloud Computing verstärkt bzw. ergänzt (Brühl 2015, S. 22). Damit ist die Möglichkeit gemeint, «Rechner- und Speicherkapazität zunehmend zu dezentralisieren, indem man diese nicht selbst besitzt und betreibt, sondern ja nach Bedarf die benötigten Kapazitäten von externen Anbietern zukauft» (Brühl 2015, S. 54). Während CPS und Cloud Computing vor allem die Automatisierung vereinfachen, machen andere technologische Entwicklungen die Automatisierung für zunehmend elaborierte und bis anhin den Menschen vorbehaltene Prozesse möglich. In dieser Hinsicht gibt es zum einen die künstliche Intelligenz (KI), die Maschinen dazu befähigen soll, logische Zusammenhänge selbstständig zu erkennen (Brühl 2015, S. 76), zum anderen Machine Learning (ML), das die Fähigkeit von Maschinen beschreibt, (autonom) zu lernen (Tanz 2016). Wenn Cloud Computing der Motor der digitalen Transformation darstellt, ist das Nutzbarmachen einer riesigen Datenmenge (‹Big Data Analytics›) der Katalysator, der im Zusammenspiel mit KI und ML noch grösseres Wirkungspotenzial entfaltet (Abolhassan 2016, S. 15). Weil diese Datenverwendung zunehmend automatisch erfolgt, wird aus Big Data nun Smart Data, wobei ausgewertete Daten in Echtzeit vorliegen (Kagermann und Riemensperger 2014, S. 27). Während die Automatisierung durch technologische Entwicklungen wie CPS, Cloud Computing, KI bzw. ML oder Smart Data befeuert wird, erweitern sich durch zwei weitere prägende technologische Entwicklungen die möglichen Einsatzfelder: Augmented Reality (AR) bzw. Virtual Reality (VR) oder beispielsweise Blockchain.
Es kann also festgehalten werden, dass die digitale Transformation, die auch als vierte industrielle Revolution bezeichnet wird, eine Vielzahl an technologischen Entwicklungen mit disruptivem Potenzial umfasst.1 Dieses Potenzial zur Disruption liegt vor allem darin begründet, dass hiermit eine so umfassende und breit umsetzbare Automatisierung wie noch nie zuvor möglich wird (Wolter et al. 2015, S. 11).
Abbildung 1: Beispielhafte technologische Entwicklungen der digitalen Transformation (in Anlehnung an Krapf 2017a, S. 32)
Diese neuen technologischen Möglichkeiten deuten bereits an, weshalb Vey et al. (2017, S. 2) in der digitalen Transformation den Treiber dafür sehen, dass die Veränderungsdynamik seit der dritten Industriellen Revolution nochmals zugenommen hat (Bauer et al. 2014, S. 9). So erhöht sich durch die Veränderungsdynamik beispielsweise der Druck, sich dem wandelnden Markt anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben (Brühl 2015, S. 10; Plass 2016, S. 650). Treiber dieses gesteigerten Innovations- und Veränderungsdrucks sind u. a. verkürzte Produktionszyklen, Preiszerfall, sinkende Eintrittsbarrieren durch digitale Produkte sowie damit zusammenhängend ein kürzerer Strategiehorizont (Brühl 2015, S. 11–12; Cachelin 2015b; Noé 2013, S. 10; Plass 2016, S. 650; Scheer 2016, S. 55). Da nicht nur die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt, sondern auch das Veränderungsausmass und die Veränderungswirkung (Vey et al. 2017, S. 2), müssen sich Organisationen in einer hoch dynamischen und komplexen Umwelt (proaktiv) kontinuierlich wandeln können (Berghaus und Back 2016b, S. 30; Reinhardt 2014, S. 8; Schwarzmüller und Brosi 2015, S. 160; Seufert et al. 2016, S. 283).
Ein zentraler Aspekt dieser Wandelfähigkeit betrifft die Kreation neuer Geschäftsmodelle (Brühl 2015, S. 15). Vergangene Beispiele wie Uber, Netflix oder Airbnb haben eindrücklich aufgezeigt, wie vermeintlich etablierte Unternehmen und Geschäftsmodelle durch digitale Lösungen in kurzer Zeit erschüttert wurden (Brühl 2015, 168; Cachelin 2015a, S. 7). Dabei sind es nicht nur die neuen technologischen Möglichkeiten, die eine Disruption von Geschäftsmodellen bewirken. Auch damit einhergehende soziale und (global-)ökonomische Entwicklungen verändern die Grundlogik des Wirtschaftssystems (Brühl 2015, S. 16; Cachelin 2015c). Als Beispiele sind hier u. a. das Aufkommen der sogenannten Shared Economy, des ‹Plattform-Kapitalismus› und des Grundsatzes ‹Everything as a service› zu nennen (Cachelin 2015c; Châlons und Dufft 2016, S. 29; Scheer 2016, S. 56). Unternehmen müssen zur Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ihr Produkt mit kundenadäquaten Dienstleistungen ergänzen, um auf diese Weise spezifische Kundenbedürfnisse zu befriedigen (Lichtblau et al. 2015, S. 11; Schuchmann und Seufert 2015, S. 31; Seufert und Meier 2016, S. 27).
Hohes Potenzial zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle wird zunehmend auch jenseits der (Fähigkeits-)Grenzen einer Organisation verortet (Kagermann und Riemensperger 2014, S. 21). So entsteht ein fliessender Übergang in Wertschöpfungsketten zwischen Produzenten, Lieferanten oder Kunden (Brühl 2015, S. 22; Geithner et al. 2010, S. 412; Wimmer 2014, S. 1). Aber auch bei den Mitarbeitenden findet durch die Entgrenzung von Expertenarbeit (Stichwort: ‹Freelancer-Economy›) eine (Teil-)Auflösung von Organisationsgrenzen statt (Reinhardt 2014, S. 161; Scheer 2016, S. 55; Schwarzmüller und Brosi 2015, S. 158). Diese Entwicklung begründet sich neben der Nutzung von transorganisationalen Kompetenzen (Kagermann und Riemensperger 2014, S. 24; Wolter et al. 2015, S. 12) auch durch die sinkenden Transaktionskosten im Zuge der digitalen Transformation (Brühl 2015, S. 15).
Durch die digitale Transformation werden nicht nur die äusseren Grenzen von Organisationen durchlässiger – auch intraorganisational werden rund um das Schlagwort Arbeitswelt 4.0 Barrieren abgebaut, um dem gesteigerten Innovations- und Veränderungsdruck gerecht zu werden (Acatech 2016, S. 5; Mülder 2016, S. 383–385; Weh und Meifert 2010, S. 318). Einerseits sind dies strukturelle bzw. hierarchische Barrieren, die durch Projektorganisationen, Netzwerkstrukturen oder soziokratische Organisationsgrundsätze reduziert werden sollen (Laloux 2014, S. 140; Oestereich und Schröder 2017, S. 17; Robertson 2016, S. 21; Seufert et al. 2016, S. 299). Andererseits ist hier die Förderung von orts- und zeitunabhängigem Arbeiten durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln zu nennen (Berghaus und Back 2016a, S. 11; Brühl 2015, S. 21; De Smet et al. 2016; Schwarzmüller und Brosi 2015, S. 155).
Ein breites Anwendungsfeld von technischen Hilfsmitteln ist die Strukturierung von Daten zu aussagekräftigen Informationen. Das bereits heute ubiquitär vorhandene Wissen wird durch die aufgezeigten technologischen Entwicklungen (Internet der Dinge, künstliche Intelligenz oder auch ‹Machine Learning›) zunehmend reibungsloser in die tägliche Arbeit integriert. Dies führt dazu, dass der Wissensarbeiter vom Kompetenzarbeiter abgelöst wird (Reinhardt 2014, S. 138; Wolter et al. 2015, S. 6): Wissen wird nicht nur zugänglicher, auch seine Halbwertszeit nimmt durch die skizzierte Veränderungsdynamik stetig ab (Böhlich 2015, S. 56; Manuti et al. 2015, S. 2; Wimmer 2014, S. 284). Wie Frey und Osborne (2013, S. 16) in einer bekannten und zugleich kontrovers diskutierten Studie aufgezeigt haben, werden alle automatisierbaren Arbeitshandlungen mittel- bis langfristig durch Maschinen ausgeführt, wodurch sowohl wissensferne als auch wissensintensive Routinearbeiten eliminiert werden (vgl. auch Brühl 2015, S. 81; Mülder 2016, S. 383). Der Mensch wird sich dadurch künftig wohl auf Tätigkeitsfelder fokussieren müssen, die elaborierte und/oder soziale Kompetenzen erfordern, um so ergänzend zu den Maschinen einen Wertbeitrag leisten zu können (Cachelin 2016; Sauter und Scholz 2015, S. 4).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht nur die technologischen Entwicklungen der digitalen Transformation, sondern auch die Veränderungen in der ökonomischen Sphäre einen grossen Einfluss auf Organisationen haben. Die grundlegendste Wirkung ist dabei wiederum die gesteigerte Veränderungsdynamik, die den Innovations- und Veränderungsdruck zusätzlich erhöht. Die disruptive Kraft schwebt dabei mithin als Damoklesschwert über etablierten Geschäftsmodellen, die innert kürzester Zeit obsolet werden können, wodurch organisationale Existenzen bedroht sind. Auch für den Menschen sind grosse Veränderungen zu erwarten, wenn tatsächlich alle routinisierbaren Arbeiten automatisiert von Maschinen ausgeführt werden. Diese Veränderungen sind ein starker Treiber der sogenannten Netzwerkökonomie, die auf die produktzentrierte und hierarchiegeprägte Industriewirtschaft folgt. Der Begriff weist dabei darauf hin, dass Netzwerke zwischen Märkten, Organisationen und Menschen zur elementaren Wirtschaftslogik werden, um der gesteigerten Komplexität gerecht zu werden (Böhlich 2015, S. 54; Brühl 2015, S. 14).
Abbildung 2: Netzwerkökonomie in der digitalen Transformation (in Anlehnung an Krapf 2017a, S. 32)
1.2 Agilität als Antwort auf die gesteigerte Veränderungsdynamik
Die Netzwerkökonomie als Resultat und Parallelerscheinung der digitalen Transformation konstituiert sich – in anderen Worten – durch eine gesteigerte Komplexität sowie einen diskontinuierlichen Wandel (Brühl 2015, S. 11–30; Oestereich und Schröder 2017, S. 6). Dadurch werden Methoden und Lösungen des Industriezeitalters zunehmend obsolet, die in der damaligen, von Kompliziertheit geprägten Wertschöpfung auf Effizienzsteigerungen ausgerichtet waren (Pfläging und Hermann 2016, S. 18). In einer Netzwerkökonomie braucht es deshalb vor allem die Fähigkeit zum effizienten und effektiven Wandel, um mit der gesteigerten Komplexität umgehen zu können (Seufert und Meier 2016, S. 27). Einem Schlagwort wird vor diesem Hintergrund (vor allem in der Praxis) zunehmend Lösungspotenzial zugeschrieben: der Agilität (Denning 2015, S. 10; Mollbach und Bergstein 2015, S. 7).
Der Agilitätsbegriff hat sich aus dem Bedürfnis von Organisationen entwickelt, sich den raschen Veränderungen ihrer Umwelt anzupassen (Denning 2018, S. 25; Putnik und Putnik 2012, S. 251). Der Terminus der Agilität wurde dahingehend in den frühen 2000er Jahren als Schlagwort etabliert, da in der Softwareentwicklung anstelle des klassisch-kaskadierenden Projektvorgehens zunehmend häufiger agile Projektmethoden eingesetzt wurden (Wendler und Stahlke 2014, S. 1). Als Ausdruck dieses Paradigmenwechsels entstand in der Softwareentwicklung das sogenannte Agile Manifest, das die zentralen Grundsätze agiler Projektarbeit umschreibt: Menschen kommen vor Prozessen bzw. Instrumenten, Funktionalität vor Dokumentation, Kundenzusammenarbeit vor Vertragsverhandlungen und Reaktion auf Veränderungen vor Planeinhaltung (Moran 2015, S. 233).
Da sich die Veränderungsdynamik nicht nur in der Softwareentwicklung erhöhte, wurden die agilen Grundsätze zunehmend breiter ausgelegt, um so das Konzept der Agilität auf Organisationen zu übertragen. Zobel (2005, S. 160) hielt wenige Jahre nach der Formulierung des agilen Manifests der Softwareentwicklung fest, dass «in der Literatur weitestgehend Einigkeit über den Agilitätsbegriff» herrscht. Dabei wird Agilität mehrheitlich als Fähigkeit einer Organisation verstanden, sich sowohl an erwartete als auch unerwartete Veränderungsbedarfe anzupassen, um sowohl proaktiv als auch reaktiv die eigene organisationale Existenz zu sichern (Häusling et al. 2016, S. 7; Welborn und Kasten 2005, S. 168; Wendler und Stahlke 2014, S. 2; Zobel 2005, S. 160). Daraus abgeleitet wird der Begriff vorliegend wie folgt verstanden:
Agilität meint eine organisationale Veränderungsfähigkeit, die es erlaubt, mit der gesteigerten Komplexität, die einer digitalisierten und global eng vernetzten Netzwerkökonomie immanent ist, adäquat bzw. nachhaltig umgehen zu können und so die organisationale Existenz zu sichern.
Abbildung 3: Agilität als Antwort auf die gesteigerte Veränderungsdynamik (in Anlehnung an Krapf 2017a, S. 32)
Mit dieser weit gefassten Definition von Agilität wird ersichtlich, warum Agilität als Antwort auf die Veränderungsdynamik der digitalen Transformation gesehen wird. Die Kernidee eines solchen Agilitätsbegriffs ist jedoch keineswegs neu: Bereits in den 1950er Jahren untersuchten in den Sozialwissenschaften Systemtheoretiker die organisationale Veränderungsfähigkeit (Häusling et al. 2016, S. 7; Wendler und Stahlke 2014, S. 2). Nichtsdestotrotz stellen die vor allem in der jüngeren Praxis entstandenen Lösungsansätze eine Weiterentwicklung dar. Während frühere Verständnisse vor allem ein organisationales Anpassungslernen im Sinne von ‹Single-Loop Learning› (Argyris 2009, S. 68–69) ins Zentrum stellten (Pal und Lim 2005, S. 19; Putnik und Putnik 2012, S. 251; Schilling und Kluge 2004, S. 367; Wendler und Stahlke 2014, S. 2; Zobel 2005, S. 158), lässt sich die ‹moderne› Perspektive zur Agilität als ein ‹Gegenentwurf› zum effizienzgetriebenen Taylorismus verstehen (Zobel 2005, S. 173).
In der Konsequenz entstehen unter dem Begriffsdach ‹Agilität› Gestaltungselemente, die zunehmend auf sogenanntes Double-Loop Learning ausgerichtet sind und so das Hinterfragen der geltenden Deutungs- und Handlungsmuster ermöglichen (Argyris 2009, S. 68–69; Zobel 2005, S. 173). Die vor allem in der Praxisliteratur auffindbaren Lösungsansätze zur Agilitätssteigerung lassen sich dabei in drei Gestaltungsfelder gliedern (Häusling et al. 2016, S. 7; Krapf 2017a, S. 33; Moran 2015, S. 3).
Unter Struktur & Governance können Gestaltungselemente zusammengefasst werden, die die Organisation und deren Führung so zu verändern versuchen, dass das System agiler wird. Prominente Ansätze sind kollaborative und transfunktionale Netzwerkorganisationen (Moran 2015, S. 9; Mülder 2016, S. 384), laterales Führen (Häusling et al. 2014, S. 18) bzw. ‹dienende› Führung (Moran 2015, S. 3), Selbstorganisation und ‹Empowerment› (Rutz 2016, S. 27), flache Hierarchie (Moran 2015, S. 188) bzw. Auflösung von Hierarchie durch Dezentralisierung der Entscheidungsmacht (Laloux 2014, S. 140; Robertson 2016, S. 17) oder auch die als ‹Holokratie› bekannt gewordenen Kreisstrukturen der Soziokratie (Oestereich und Schröder 2017, S. 150; Robertson 2016, S. 29).
Als Prakitken & Prozesse sind Gestaltungselemente zu verstehen, die Agilität in der Bearbeitungsform von (inhaltlichen) Themen fördern wollen. In diesem Zusammenhang werden vor allem die aus der Softwareentwicklung bekannten agilen Methodologien wie Scrum, Kanban oder Design Thinking genannt (Moran 2015, S. 14; Preussig 2015). Aber auch grundlegende Prinzipien daraus wie iteratives Arbeiten (Häusling und Fischer 2016, S. 31; Moran 2015, S. 9; Wendler und Stahlke 2014, S. 3), Experimentieren (Scherber und Lang 2015; Seufert et al. 2016, S. 286) oder Prototyping (Häusling et al. 2014, S. 18; Laloux 2014, S. 140) werden spezifisch erwähnt.
Als Grundlage zur Umsetzung von agilen Grundsätzen wird die Befähigung der Mitarbeitenden gesehen. Als hierfür zentrale Werte & Kompetenzen gelten nicht zuletzt die Lern- und Veränderungskompetenz (Mollbach und Bergstein 2015, S. 9; Wendler und Stahlke 2014, S. 3), die Kollaborationskompetenz (Pal und Lim 2005, S. 26) sowie die Innovationskompetenz (Schmitt 2014, S. 48; Schültz 2014, S. 19). Aber auch Einstellungen und Werte wie Transparenz (Buchholz und Knorre 2012, S. 18; Wendler und Stahlke 2014, S. 29), Vertrauen (Mollbach und Bergstein 2015, S. 9), Kundenorientierung (Häusling und Fischer 2016, S. 31–33; Wendler und Stahlke 2014, S. 3; Zobel 2005, S. 178–232), positives Menschenbild (Oestereich und Schröder 2017, S. 274; Pfläging und Hermann 2016, S. 25) oder Offenheit für Neues (Mollbach und Bergstein 2015, S. 9) werden als zentral bezeichnet.
Neben der individuellen Befähigung weist die (Praxis-)Literatur auch oft darauf hin, dass die Etablierung einer agilen Organisation nur gelingt, wenn die Kultur entsprechend ausgestaltet ist (Denning 2015, S. 11; Moran 2015, S. 190; Welborn und Kasten 2005, S. 172). Inwiefern Kultur ein eigenes Gestaltungsfeld sein kann, hängt allerdings davon ab, welches Begriffsverständnis vertreten wird. Vorliegend wird Kultur als kollektivierte Verhaltens- und Wahrnehmungsmuster verstanden (Teil B: 1.4.2), wodurch die drei vorher genannten Gestaltungsfelder eher Aspekte einer entsprechenden Kultur sind. Die drei erstgenannten Gestaltungsfelder (Struktur & Governance, Praktiken & Prozesse sowie Werte & Kompetenzen) prägen insofern die kollektiven Handlungs- und Deutungsmuster und können damit bei entsprechender Ausgestaltung als Teil einer ‹agilitätsförderlichen› Kultur verstanden werden (Abbildung 4).
Abbildung 4: Gestaltungsfelder zur Agilität (eigene Darstellung in Anlehnung an Krapf 2017a, S. 33)
Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass Agilität als Antwort auf die gesteigerte Veränderungsdynamik gesehen wird. Je nach Perspektive stehen zur Förderung dieser Wandelfähigkeit andere Gestaltungselemente im Vordergrund (Abbildung 4). Für ein konkretes Forschungsvorhaben muss deshalb ein spezifischer Fokus gewählt und begründet werden. Dies soll im nächsten Kapitel erfolgen.
2 Forschungsrelevanz, Forschungsziel und Forschungsfragen
Wie die einleitend dargelegte Problemstellung aufzeigt, erhöht sich durch die digitale Transformation und die Netzwerkökonomie die Veränderungsdynamik (Vey et al. 2017, S. 2). In der Praxis hat sich hierzu das Schlagwort der Agilität als Lösungsansatz etabliert (Denning 2015, S. 10; Mollbach und Bergstein 2015, S. 7), wodurch vielfältige Gestaltungsansätze entwickelt wurden (Teil A: 1.3, Abbildung 4). Aus Wissenschaftssicht ist allerdings das mit der Agilität verfolgte Ziel der organisationalen Veränderungsfähigkeit keineswegs neu (Häusling et al. 2016, S. 7; Wendler und Stahlke 2014, S. 2). So wurde bereits vor dem Aufkommen des Agilitätsbegriffs intensiv zur organisationalen Veränderungsfähigkeit geforscht. Insbesondere das Konzept der lernenden Organisation erlangte in verschiedenen Disziplinen signifikante Beachtung und wird seit spätestens den 1990er Jahren wissenschaftlich intensiv diskutiert (Eichler 2008, S. 82; Kluge und Schilling 2003, S. 43). Dabei wird der lernenden Organisation analog zur agilen Organisation die Fähigkeit zugeschrieben, sowohl auf Veränderungen adäquat reagieren zu können als auch Wandel proaktiv zu initiieren, um so die organisationale Existenz zu sichern (vgl. u. a. Argyris und Schön 1999, S. 190; Marsick und Watkins 2003, S. 142; Senge 1994, S. 14).
Aus Sicht der Wissenschaft stellt sich deshalb die Frage, welchen Neuigkeitsgehalt bzw. welche Forschungsrelevanz eine Untersuchung zur Agilität besitzt, wenn deren zentrales Ziel im Sinne der organisationalen Veränderungsfähigkeit mindestens unter dem Konzept der lernenden Organisation bereits ausgiebig erforscht wurde. Bei näherer Betrachtung der Forschungsliteratur zeigt sich, dass zwar die Erkenntnisse zur konzeptionellen Beschreibung der lernenden Organisation ausführlich sind, aber eine erhebliche Forschungslücke in der empirischen Untersuchung zur Frage besteht, wie dieses Zielbild erreicht werden kann (Argyris 2009, S. 46–47; Bordeianu et al. 2014, S. 608; Friebe 2005, S. 277; Palos und Stancovici 2016, S. 6).
Die Forschungsrelevanz im Zusammenhang mit der agilen bzw. lernenden Organisation besteht also darin, empirisch zu untersuchen, wie diese organisationale Veränderungsfähigkeit entwickelt werden kann. Hierzu bieten sich mindestens zwei Zugänge an: einerseits von der Praxis in die Wissenschaft, indem die derzeit unter dem Schlagwort Agilität aufkommenden Gestaltungselemente wie Scrum, Holokratie, Design Thinking, Management 3.0 etc. untersucht werden, um herauszufinden, inwiefern diese Lösungsansätze die Veränderungsfähigkeit der Organisation steigern können (Teil A: 1.3, Abbildung 4); andererseits von der Wissenschaft in die Praxis, indem vorhandene Erkenntnisse zur lernenden Organisation empirisch umgesetzt werden, um so bestehende Theorien erweitern und/oder bestätigen bzw. widerlegen zu können. Letzteres kann zusätzlich dabei helfen, zu verstehen, inwiefern die lernende und die agile Organisation äquivalent betrachtet werden können.
Beide Zugänge können die empirischen Erkenntnisse zur Entwicklung einer agilen bzw. lernenden Organisation erweitern und zeigen sich vor dem Hintergrund der aufgezeigten Forschungslücke als potenzialreich. Die Wahl des Zugangs und die Begründung des konkreten Forschungsziels müssen deshalb letztendlich über das Forschungsinteresse erfolgen. Letzteres liegt in vorliegendem Forschungsvorhaben weniger in der Wirkungsüberprüfung von einzelnen Gestaltungselementen, die heute oft im Zusammenhang mit der Agilität genannt werden. Vielmehr soll ein Beitrag zur allgemeinen Erhöhung der organisationalen Veränderungsfähigkeit geleistet werden, da diese das grundlegende Ziel der agilen bzw. lernenden Organisation ist.
Damit wird die empirische Forschung vor allem auf die organisationale Veränderungsfähigkeit ausgelegt, weniger aber auf die (zeitlich befristeten) Konzepte der Agilität per se. Der Vorteil dieses Zugangs wird darin gesehen, dass so Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse untersucht werden können, die nicht von derzeit ‹modernen› Gestaltungsinterventionen abhängig sind. Denn während das Konzept der lernenden Organisation (und damit auch jenes der agilen Organisation) als Vision auf absehbare Zeit beständig bleibt, so werden sich die Lösungsansätze stets dem Kontext anpassen müssen und somit eher temporär sein. Dies macht Untersuchungen zu aktuellen Gestaltungselementen wie beispielsweise Holokratie, Scrum, Design Thinking oder auch Management 3.0 nicht obsolet, da es sich hierbei um konkrete Umsetzungsmöglichkeiten handelt, deren Wirkungskraft es wissenschaftlich zu überprüfen gilt. Jedoch lässt sich dadurch kaum erarbeiten, wie die organisationale Veränderungsfähigkeit über die spezifisch untersuchte Intervention hinaus gefördert werden kann.
Die Gefahr beim gewählten Zugang liegt darin, dass der Fokus zu breit gewählt wird und so empirisch kaum aussagekräftige Erkenntnisse gewonnen werden, die die Gestaltung einer lernenden bzw. agilen Organisation unterstützen. Aus diesem Grund braucht es auch bei der Untersuchung der Agilität im Sinne einer organisationalen Veränderungsfähigkeit eine entsprechende thematische Einschränkung. Dieser Fokus wird vorliegend insofern gewählt, als dass die Lernkultur ins Zentrum gestellt wird, da der Lernkultur bei der Betrachtung der lernenden Organisation bzw. der organisationalen Veränderungsfähigkeit eine hohe Bedeutung zukommt (vgl. u. a. Friebe 2005, S. 11; Grundhoefer 2013, S. 26–27; Palos und Stancovici 2016, S. 3; Schilling und Kluge 2004, S. 367; Schüerhoff 2006, S. 195) und hierzu kaum empirische Studien zu konkreten Gestaltungs- und Entwicklungsmassnahmen vorliegen (Argyris 2009, S. 46–47; Friebe 2005, S. 277).
Durch den Fokus auf die Lernkultur zur Entwicklung einer lernenden bzw. agilen Organisation kann ein spezifisches Element der organisationalen Veränderungsfähigkeit empirisch untersucht werden, ohne dass sich hierbei die Forschung auf eine spezifische Intervention beschränkt, die derzeit im selben Atemzug wie der Agilitätsbegriff genannt wird (Moran 2015, S. 188). So sollen die Forschungsergebnisse aus der empirischen Exploration der Lernkulturentwicklung auch dann noch Erklärungskraft besitzen, wenn die derzeit prominenten Lösungsvorschläge von neuen Konzepten abgelöst werden. Dies soll gelingen, indem bei der Lernkulturentwicklung nicht nur spezifische Interventionen zur Agilitätssteigerung empirisch untersucht werden, sondern insbesondere auch der Entwicklungsprozess zu deren Umsetzung.
Vor diesem Hintergrund lässt sich für die vorliegende Arbeit das folgende übergeordnete Forschungsziel formulieren.
Forschungsziel:
Empirische Erarbeitung von Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Steigerung der Agilität
Die Wahl der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung als Forschungsfokus darf allerdings nicht dahingehend verstanden werden, dass (allein) hiermit die Veränderungsfähigkeit eines Systems perfektioniert werden kann. Vielmehr soll untersucht werden, inwiefern die Entwicklung der Lernkultur positiv auf die Agilität einwirken kann. Dabei liegt der Fokus – wie später noch konkreter ausgeführt wird – nicht auf der Wirkungsmessung von Lernkultur und Agilität, sondern auf der Erarbeitung von Gestaltungsprinzipien zur Lernkulturentwicklung, die das Potenzial haben, die Agilität entsprechend zu steigern (Teil C: 1.2.4).
Damit dieses Forschungsziel erreicht werden kann, ist zuerst herauszufinden, welche Rolle die Lernkultur in diesem Kontext übernimmt. Diese Frage ist grundlegend, um zu ermitteln, inwiefern Lernkulturentwicklung überhaupt zur Agilitätssteigerung beitragen kann. Ausgehend von der Rolle der Lernkultur gilt es des Weiteren zu eruieren, nach welchem normativen Zielbild die Lernkulturentwicklung ausgerichtet werden soll und kann, um die organisationale Veränderungsfähigkeit zu verbessern. Erst wenn dieser Zielzustand bekannt ist, können anschliessend kontextsensitive Gestaltungsprinzipien erarbeitet werden, die die Erreichung dieses Zustandes unterstützen.
Aus diesen Überlegungen lassen sich die folgenden leitenden Forschungsfragen zur Erreichung des Forschungsziels ableiten.
Leitende Forschungsfragen (FF) zur Erreichung des Forschungsziels:
FF1
Welche Rolle kommt der Lernkultur bei der Agilitätssteigerung im Sinne der Verbesserung der organisationalen Veränderungsfähigkeit zu?
FF2
Welches Zielbild einer Lernkultur unterstützt die organisationale Veränderungsfähigkeit?
FF3
Welche kontextsensitiven Gestaltungsprinzipien fördern die Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung?
3 Aufbau der Arbeit
Die schriftliche Zusammenfassung des Forschungsvorhabens wird in folgende fünf inhaltliche Teile strukturiert:
Teil A
leitet in die Forschungsarbeit ein und liefert die Forschungsgrundlagen, damit der normative und methodologische Rahmen transparent ist.
Teil B
spannt den theoretischen Bezugsrahmen, damit für die empirische Umsetzung vorläufige Gestaltungshypothesen entwickelt werden können.
Teil C
erörtert die empirische Umsetzung und die daraus resultierenden Ergebnisse, damit daraus fallspezifische Gestaltungsprinzipien abgeleitet werden können.
Teil D
analysiert und vergleicht die Ergebnisse aus den einzelnen Meso-Zyklen, damit kontextsensitive Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung erarbeitet werden können.
Teil E
reflektiert sowohl den Forschungsprozess als auch das Forschungsergebnis, damit darauf basierend weitere Forschungsdesiderate formuliert werden können.
Tabelle 1: Inhaltliche Grobstruktur der Forschungsarbeit
Diese Grobstruktur soll dazu beitragen, das formulierte Forschungsziel (Teil A: 2) zu erreichen. Welche Fragestellungen die Zielerreichung unterstützen sollen, zeigt die untenstehende Tabelle.
Forschungsziel
Empirische Erarbeitung von Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung
Leitende Forschungsfragen
FF1
Welche Rolle kommt der Lernkultur bei der Agilitätssteigerung im Sinne der Verbesserung der organisationalen Veränderungsfähigkeit zu?
FF2
Welches Zielbild einer Lernkultur unterstützt die organisationale Veränderungsfähigkeit?
FF3
Welche kontextsensitiven Gestaltungsprinzipien fördern die Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung?
Kapitel
2
Fragestellungen
Angestrebtes Ergebnis
Teil A: 4
Welcher epistemologische Zugang prägt das Forschungsvorhaben?
Eine transparente und konsistente forschungsparadigmatische Ausrichtung als Grundlage für das Forschungsvorhaben
Teil A: 5
Welche Forschungsstrategie eignet sich weshalb und wie für die Erreichung des formulierten Forschungsziels?
Eine transparente und begründete Forschungsmethodologie, die auf das Forschungsziel abgestimmt ist
Teil B: 1
Welche normativ-theoretischen Verständnisse leiten die Forschungsarbeit und wie lassen sich diese theoretisch fundieren?
Ein theoretisches Fundament, das eine normativ konsistente Erarbeitung der Gestaltungshypothesen ermöglicht
Teil B: 2.1
Welcher Bezugsrahmen kann die Lernkulturentwicklung unterstützen?
Theoretisch erarbeiteter Bezugsrahmen der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung
Teil B: 2.2
Welche provisorischen Gestaltungsannahmen zur Lernkulturentwicklung können für die empirische Umsetzung als Grundlage dienen?
Theoretisch fundierte Gestaltungshypothesen der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung als Grundlage für die empirische Arbeit
Teil C: 1
Wie kann der empirische Forschungs- und Gestaltungsprozess präzisiert werden?
Verständnis über Kontext und konkreten Ablauf der empirischen Forschung
Teil C: 2
-
4
Welche Erkenntnisse lassen sich aus den einzelnen Meso-Zyklen der Forschungs- und Gestaltungsarbeit gewinnen?
Empirisch fundierte und evaluierte Weiterentwicklung der provisorischen Gestaltungsannahmen zu fallspezifischen Gestaltungsprinzipien
Teil D: 1
Inwiefern lassen sich die Ergebnisse der verschiedenen Meso-Zyklen vergleichen?
Differenziertes Verständnis über die Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten der verschiedenen fallspezifischen Gestaltungsprinzipien als Grundlage zur Entwicklung von kontextsensitiven Gestaltungsprinzipien
Teil D: 2
Welche kontextsensitiven Gestaltungsprinzipien können aus der Forschungs- und Gestaltungsarbeit abgeleitet werden?
Empirisch fundierte, kontextsensitive Gestaltungsprinzipien der Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung
Teil D: 3
Wie können die entwickelten Gestaltungsprinzipien in der Praxis umgesetzt und skaliert werden?
Ein kurzer Exkurs über drei Anwendungsbeispiele aus der Praxis für die Praxis
Teil E: 1
Welche Erkenntnisse lassen sich rückblickend aus den Forschungsergebnissen und dem Forschungsprozess gewinnen?
Eine kritische Reflexion der Forschungsergebnisse und des Forschungsprozesses
Teil E: 2
Welche Forschungsdesiderate ergeben sich aus dem Forschungsvorhaben?
Hinweise für potenzialreiche Anschlussforschungen
Tabelle 2: Fragestellungen und angestrebte Ergebnisse der Forschungs- und Gestaltungsarbeit
4 Forschungsparadigmatische Ausrichtung
Anders als bei Naturgesetzen ist es beim menschlichen Verhalten geradezu offensichtlich, dass es zu Erwartungsabweichungen kommt. Wird ein einzelner Stein leicht angestossen, lässt sich dessen Reaktion auf diesen Wirkungseinfluss relativ zuverlässig vorhersagen. Schwieriger wird eine vergleichbare Vorhersage, wenn bei einem Menschen oder gar bei einer Gruppe von Menschen Einfluss genommen wird. Eine zentrale Frage in der sozialwissenschaftlichen Forschung ist deshalb, wie mit diesen Erwartungsdiskrepanzen umgegangen wird (Universität Augsburg 2016). Der Umgang mit und die Erklärung von solchen Abweichungen sind dabei vom leitenden Forschungsparadigma abhängig (Euler 2014c, S. 23). Dieses setzt sich aus der Einstellung zur Epistemologie sowie Ontologie zusammen. Erstere meint dabei das Verständnis über die Wirklichkeitswahrnehmung (Erkenntniszugang), während sich die Ontologie auf die Ansicht über die Wirklichkeit selbst (Erkenntnisobjekt) bezieht (Barbour 2008, S. 20; Breuer 1996, S. 95).
Diese beiden Säulen eines Forschungsparadigmas führen dazu, dass jedes Forschungsvorhaben nicht nur vom Forschungsgegenstand (Ontologie) abhängt, sondern auch davon, welcher erkenntnistheoretische Zugang zu diesem (weltlichen) Gegenstand gewählt wird (Epistemologie). Dem epistemischen Zugang kommt in der Forschung somit eine voraussetzungsreiche Rolle zu, denn ohne eine explizite Vorstellung davon, wie die Welt wahrgenommen werden kann, kann die Welt nicht konsistent beschrieben, geschweige denn erforscht werden (Devilder 2004).
Die Frage nach der Rolle der Lernkultur sowie deren Zielbild hinsichtlich der Agilitätssteigerung ist besonders normativ geprägt, da die Lernkulturentwicklung je nach epistemologischer Grundlage anders beurteilt, erforscht und beschrieben wird (Teil B: 1.4). Aus diesem Grund soll vorliegend die forschungsparadigmatische Ausrichtung näher erläutert werden, indem auf den gemässigten Konstruktivismus als epistemologische Ausrichtung näher eingegangen wird. Hierfür werden zuerst die Grundlagen des Konstruktivismus vorgestellt, um so anschliessend die eigene epistemologische Position begründet aufzeigen zu können.
4.1 Grundlagen des Konstruktivismus
Als Begründung der konstruktivistischen Denkschule wird oft das Werk von Maturana (1970) zitiert (Pörksen 2011, S. 13). Darin formuliert Maturana (1998, S. 25) den zentralen Grundsatz: «[A]lles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt.» Dies umschreibt probat die bereits oben genannte Prämisse des Konstruktivismus, dass Menschen die Welt durch ihre Beobachtung konstruieren. Hieraus folgt nicht, dass die Existenz einer menschenunabhängigen Realität als solche negiert wird. Vielmehr stellen sich konstruktivistische Vertreter auf den Standpunkt, dass die Wirklichkeit nicht in ontologischer Form erfasst werden kann, eben weil sie ein Konstrukt der menschlichen Beobachtung ist (Schüerhoff 2006, S. 28). Dies grenzt den Konstruktivismus etwa vom Solipsismus ab, bei dem davon ausgegangen wird, dass über dem eigenen Ich keine Realität existiert (Pörksen 2011, S. 13–14).
Wenngleich der Konstruktivismus mit diesen wenigen Worten grob umschrieben scheint und nicht zuletzt die Abgrenzung zum Realismus sowie zum Solipsismus bzw. Idealismus geklärt ist, ist doch festzuhalten, dass es nicht ‹den› Konstruktivismus gibt (Pörksen 2011, S. 15). Zwar gehen quasi alle konstruktivistischen Denkstränge von einer «prozessual[en] […] Entstehung von Wirklichkeit» (Weber 2002, S. 24) aus; trotzdem gibt es nennenswerte Unterschiede in den verschiedenen Schulen. Vorliegend fehlt bei weitem der Platz, um im Detail auf alle Strömungen einzugehen. Für den Zweck der Transparentmachung der forschungsleitenden Epistemologie scheint es aber ohnehin ausreichend, mit dem radikalen und sozialen Konstruktivismus sowie den sozialen Konstruktionismus drei zentrale Positionen kurz zu skizzieren. Andere Denkschulen zum Konstruktivismus wie beispielsweise der kognitive Konstruktivismus, der von Piaget (1976) geprägt wurde (Vollmers 1997, S. 74), die Kybernetik 2. Ordnung, die u. a. von Foester (1979) entwickelt wurde (Müller und Müller 2011, S. 566), oder auch der etwas weniger verbreitete und dem Realismus nahestehende Erlanger Konstruktivismus (Choe 2005, S. 13) werden für diese kurze Annäherung ausgeklammert, weil sie für die Ausarbeitung der forschungsleitenden Epistemologie weniger relevant sind.
Der Durchbruch des radikalen Konstruktivismus wird in den 1980er Jahren verortet (Müller 2011, S. 255), in denen – ausgelöst von Watzlawick (1976) – zahlreiche Schlüsselwerke wie jene von Glasersfeld (1981), Maturana (1982), Luhmann (1984), Foester (1985) oder auch von Maturana und Varela (1987) publiziert wurden. Den Beinamen ‹radikal› erhielt der Konstruktivismus von Glasersfeld (1981), der damit die Abgrenzung zum Realismus deutlich(er) machen wollte (Choe 2005, S. 19). Damit sollte die Idee einer einzig wahren Realität aufgegeben werden, weil die Vertretenden des radikalen Konstruktivismus es als unmöglich ansehen, die «Erkenntnis» vom «erkennenden Subjekt» zu trennen (Schüerhoff 2006, S. 33). Während der Realist also nur etwas als Wissen anerkennt, wenn es mit einer vermeintlich unabhängigen Wirklichkeit übereinstimmt, haben die radikalen Konstruktivisten eine funktionalistische Auffassung von Wissen und Wirklichkeit. Glasersfeld (1981, S. 19) nutzt die Analogie von Schlüssel und Schloss, um diese Position zu illustrieren. So kann das Wissen wie ein Schlüssel in ein Schloss passen, also funktional sein. So wenig aber, wie die Funktionalität des Schlüssels etwas über das Schloss aussagt, so wenig gibt funktionales Wissen Aufschluss über die Wirklichkeit. Von anderen konstruktivistischen Zugängen unterscheidet sich der radikale Konstruktivismus vor allem darin, dass er dieses (funktionale) Wissen «als Ergebnis individueller Konstruktionsleistungen» betrachtet (Schüerhoff 2006, S. 55). Dies verdeutlichen auch die zwei Prinzipien des radikalen Konstruktivismus nach Glasersfeld (1995, S. 51):
Wissen wird nicht passiv aufgenommen, sondern ist ein aktiver Gestaltungsprozess eines denkenden Subjekts;
Die Funktion des Denkens ist eine Lern- und Anpassungsfähigkeit im biologischen Sinne; die Kognition dient dabei dem Subjekt, eine Welt zu konstruieren, und nicht, um eine objektive Realität zu entdecken. Der elementare Grundgedanke hinter diesen Prinzipien bzw. beim radikalen Konstruktivismus generell ist demnach, dass der Mensch bei der Konstruktion der Wirklichkeit stets in seinem eigenen Gedankensystem gefangen ist und so die Aussenwelt mit einem selbstreferenziellen Filter wahrnimmt (Devilder 2004).
Im Gegensatz zum radikalen Konstruktivismus, der sich für die «intraindividuellen Kognitionsleistungen» interessiert, versteht sich der soziale Konstruktivismus als Wissenssoziologie (Schüerhoff 2006, S. 54). Die Schrift von Berger und Luckmann (1966) über die ‹gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit› wird dabei als begründendes Standardwerk für diese Denkschule genannt (Pörksen 2011, S. 20). In der Tradition der Wissenssoziologie steht beim sozialen Konstruktivismus nicht das individuelle Wissen im Zentrum des Interesses, sondern das Kollektivwissen (Kaiser-Probst 2008, S. 24). Die Konstruktion der Wirklichkeit erklärt sich in diesem Verständnis als ein Produkt von sozialen Interaktions- und Kommunikationspraktiken und nicht als intraindividuelle Gedankenleistung (Loenhoff 2011, S. 156–157). Diese diskursiven Praktiken als Produktionsprozesse von ‹objektivierter› Wirklichkeit sind somit das zentrale Erkenntnisinteresse im sozialen Konstruktivismus (Schüerhoff 2006, S. 54). Dies macht den Menschen zu einem formbaren, wenn auch autopoietischen System, das die Welt «mit den Augen seiner Gruppe» beobachtet (Pörksen 2011, S. 20). Wie der radikale Konstruktivismus ist also auch hier die Auffassung etabliert, dass die Wirklichkeitswahrnehmung nicht frei von ‹Ideologien› ist (Mannheim 2015, S. 86–87). Die für die Wahrnehmung prägenden Denkmuster werden im sozialen Konstruktivismus allerdings nicht auf die intraindividuelle Kognitionsleistung, sondern auf die relevante soziale Umwelt zurückgeführt (Pörksen 2011, S. 20). Individuen blicken somit stets mit einer Schablone auf die Welt, in die sie quasi hineingeboren oder zumindest sozialisiert wurden (Devilder 2004).
Aufgrund der Namensgebung ist es wenig überraschend, dass der soziale Konstruktionismus dem sozialen Konstruktivismus nahesteht. Als Begründer dieses Erkenntniszugangs wird Gergen (1985) genannt, der in den 1980er Jahren vier Annahmen des sozialen Konstruktionismus aufgestellt hat (Westmeyer 2011, S. 413–414). Diese entwickelte er im Laufe der Jahre zu vier Arbeitshypothesen weiter (Gergen 2002, 66ff zit. in Westmeyer 2011, S. 415):
«Die Begriffe, mit denen wir die Welt und uns selbst verstehen, ergeben sich nicht zwangsläufig aus dem, was ist»;
«wie wir beschreiben, erklären und darstellen, leitet sich aus Beziehungen ab»;
«so, wie wir beschreiben, erklären oder anderweitig darstellen, so gestalten wir unsere Zukunft»;
«das Nachdenken über unsere Formen des Verstehens ist für unser zukünftiges Wohlergehen von entscheidender Bedeutung».
Diese vier Arbeitshypothesen und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen machen die Abgrenzung zum radikalen Konstruktivismus evident. So finden auch im sozialen Konstruktionismus die Konstruktionsvorgänge nicht in «informell geschlossenen […] kognitiven Systemen» statt (Westmeyer 2011, S. 417). Die Differenzierung zum sozialen Konstruktivismus hingegen ist oberflächlich nur schwer in den Hypothesen zu erkennen. Nach Gergen (1994) findet die Wirklichkeitskonstruktion nicht durch einzelne Personen statt, sondern ist stets an einen «Austauschprozess zwischen Personen» gebunden (Westmeyer 2011, S. 417). Während also im sozialen Konstruktivismus Individuen durch den sozialen Diskurs in ihren Denkmustern geprägt werden und es so immer noch einzelne Personen sind, die Wirklichkeit konstruieren, lokalisiert der soziale Konstruktionismus die Wirklichkeitskonstruktion direkt im Interaktionsprozess. Ähnlich wie in der Systemtheorie von Luhmann (1984) rückt so das Individuum zugunsten der Kommunikation in den Hintergrund der Betrachtung (Teil B: 1.1.1.1).
4.2 Leitende epistemologische Grundlage des Forschungsvorhabens
Für das vorliegende Forschungsvorhaben soll bewusst eine epistemologische Position eingenommen werden, um die nicht zu vermeidende Normativität transparent zu machen (Hug 2011, S. 467). Eine solche soll vorliegend auf Basis der oben skizzierten Zugänge zum Konstruktivismus ausgearbeitet werden, ohne dabei den Anspruch zu verfolgen, eine neue epistemologische Position oder gar Theorie zu begründen. Die forschungsleitende Grundhaltung orientiert sich deshalb – in etwas unterschiedlicher Gewichtung – an den vorgestellten Denkschulen des Konstruktivismus, wenngleich diese grundsätzlich geschlossene Erkenntniszugänge darstellen. Wie Schüerhoff (2006, S. 59) dahingehend in ihrer Dissertation detailliert ausarbeitet, gibt es zwischen den verschiedenen Positionen trotzdem Anknüpfungspunkte. So weist beispielsweise der Ansatz der Synreferenz im radikalen Konstruktivismus darauf hin, dass die Individuen in ihrer Wirklichkeitskonstruktion auf die eigenen Denkmuster referenzieren. Die Entwicklung derartiger individueller Wahrnehmungsschablonen lässt sich mit dem sozialen Konstruktivismus erklären, der die Interaktion im sozialen System als Produktionsstätte solcher ‹Ideologien› bezeichnet. Der radikale und der soziale Konstruktivismus stellen somit keine gegensätzlichen Verständnisse dar, sondern scheinen eher dasselbe Phänomen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten (Cole und Wertsch 1996, S. 251–252). Etwas grundlegender ist der Unterschied zum sozialen Konstruktionismus, der die Rolle des Individuums marginalisiert. Für die vorliegende Forschungsarbeit sollen deshalb die Grundgedanken des radikalen und des sozialen Konstruktivismus im Vordergrund stehen, während die Idee des sozialen Konstruktionismus daran erinnern soll, dass in sozialen Systemen auch überindividuelle Dynamiken und Wirkungszusammenhänge zu beachten sind.
Die beabsichtigte Kombination von radikalem und sozialem Konstruktivismus sowie der tolerante Umgang mit dem sozialen Konstruktionismus zeigen, dass kein puristischer Erkenntniszugang gewählt wird. Dieser Eklektizismus wird einerseits zugunsten der Pragmatik und Praxisrelevanz des Forschungsvorhabens bewusst in Kauf genommen. Andererseits soll damit auch explizit ausgewiesen werden, dass die konstruktivistische Denkschule zwar handlungsleitend ist, jedoch nicht ins Extreme gesponnen wird. Damit soll transparent gemacht werden, dass die apodiktische Kritik aus dem Lager des Realismus (Köck 2011, S. 395) ebenso abgelehnt wird wie die Überhöhung der konstruktivistischen Ideologie, die darin gipfelt(e), «den Scherz3 mit der Erfindung des Nordpols tausendfach zu allen möglichen Themen» zu wiederholen (Hampe 2016). Es soll also eine etwas gemässigte Position des Konstruktivismus vertreten werden, die beispielsweise anerkennt, das auch er selbst eine Konstruktion ist (Devilder 2004). Damit wird die Grundfrage zwischen Erfindung (Konstruktivismus) oder Entdeckung (Realismus) nicht mehr strikt dichotomisch aufgefasst. Vielmehr soll es zu einem Nebeneinander kommen, also zu einem Erfinden neben dem Entdecken (Choe 2005, S. 58).
Ein solches Nebeneinander von Erfinden und Entdecken ist dabei selbst in der konstruktivistischen Tradition zu finden. So weist auch Hacking (1999, S. 25) darauf hin, dass sich die (soziale) Konstruktion auf eine «Idee» bezieht, nicht auf das reale, existierende Objekt. Am Beispiel von «Flüchtlingsfrauen» macht er dabei deutlich, dass die Frau ‹real› existiert und sie auch ‹real› auf der Flucht ist. Die Idee des Begriffs der Flüchtlingsfrau allerdings – und welche Bedeutungen dieser Idee zugeschrieben werden – sind sozial konstruiert (Hacking 1999, S. 25–27). Auch Latour (2007) als ursprünglicher Verfechter eines puristischen Konstruktivismus plädiert in seiner Relativierungs- und Rehabilitierungsschrift für einen etwas moderateren Konstruktivismus, der wieder Platz für Fakten hat. Hierfür kreiert Latour (2007, S. 28) die Begriffe «Matters of Fact» und «Matters of Concern», um ebenfalls dieses Nebeneinanderstellen von Fakten und Bedeutungszuschreibung zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund wird vorliegend also ein ‹gemässigter› Konstruktivismus vertreten, der vor allem bei der Bedeutungszuschreibung relevant wird. Insofern werden ‹reale› Dinge wie Tische, Häuser oder Dokumente als ‹Fakten› verstanden, während die Bedeutung dieser Dinge als (sozial) konstruiert erachtet werden (Latour 2007, S. 55–60). Diese Wirklichkeitskonstruktion wird in Anlehnung an den radikalen Konstruktivismus durch selbstreferenzielle Denkmuster des beobachtenden Individuums erklärt (Glasersfeld 1995, S. 51), wobei ein zentraler Produzent dieser individuellen Wahrnehmungsschablonen in der Tradition des sozialen Konstruktivismus in den Interaktions- und Kommunikationsprozessen der sozialen Umwelt verortet wird (Loenhoff 2011, S. 156–157). Wenn dann in der Folge der Forschungsarbeit soziale Systeme in Form von Organisationen zum Untersuchungsobjekt werden, wird auch der soziale Konstruktionismus relevant, der darauf hinweist, dass die Bedeutungswirklichkeit nicht (nur) von Individuen, sondern auch überindividuell konstruiert wird (Westmeyer 2011, S. 417). Damit wird also vor allem der erste Grundsatz des (sozialen) Konstruktivismus vertreten: «X hätte nicht existieren müssen oder müsste keineswegs so sein, wie es ist. X […] ist nicht vom Wesen der Dinge bestimmt; es ist nicht unvermeidlich» (Hacking 1999, S. 19).
5 Design-Based Research als leitende Forschungsstrategie
Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit sollen Gestaltungsprinzipien für die Lernkulturentwicklung zur Agilitätssteigerung entwickelt werden. Im Vordergrund steht damit nicht die Erforschung von bestehenden Interventionsmöglichkeiten, die auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. Vielmehr soll eine Forschungslücke geschlossen werden, indem besser verstanden wird, was wie dazu beiträgt, die Lernkultur agilitätsfördernd zu gestalten (Argyris 2009, S. 46; Bordeianu et al. 2014, S. 608; Palos und Stancovici 2016, S. 6). Da es sich hierbei um ein Praxisproblem handelt, für das es «(noch) keine (hinreichende) theoretisch begründete […] Intervention» (Brahm und Jenert 2014, S. 46) gibt, bietet sich dahingehenden Design-Based Research (DBR) bzw. die Gestaltungsforschung als leitende Strategie an (Euler 2014b, S. 15–16; McKenney und Reeves 2014, S. 141; van Aken et al. 2016, S. 1).
Bei DBR handelt es sich um eine relativ junge Forschungsstrategie mit unterschiedlichen, forschungsmethodologisch intensiv diskutierten Ausprägungen (Raatz 2015, S. 17), weshalb vorliegend zuerst deren konstitutiven Merkmale vorgestellt werden sollen. Daraus werden in Abstimmung mit den vorhergehend erläuterten forschungsparadigmatischen Grundlagen (Teil A: 3) die für die gegenständliche Forschungsarbeit leitenden wissenschaftlichen Grundsätze formuliert und darauf basierend die Wahl eines gestaltungsorientierten Forschungsansatzes differenziert begründet, bevor der Ablauf des Forschungsvorgehens skizziert wird.
5.1 Konstitutive Merkmale der Gestaltungsforschung
Gestaltungsforschung bzw. Design-Based Research ist eine Forschungsstrategie, die seit rund 25 Jahren konkreter diskutiert wird (Euler 2014b, S. 15), während damit verwandte Konzepte wie beispielsweise jenes des reflektierten Praktikers von Schön (1983) bereits ein Jahrzehnt früher eingeführt wurden (van Aken 2007, S. 69). Gestaltungsorientierte Forschung, wie sie vorliegend verstanden wird, fasst dabei verschiedene Ansätze bzw. Begrifflichkeiten wie Design-Based Research, Design Experiments, Design Studies, Development Research, Design Science Research sowie Entwicklungs- oder Gestaltungsforschung zusammen, die im Laufe der Jahre in der Diskussion verwendet wurden (Bronkhorst und Kleijn 2016, S. 76; Euler 2014b, S. 15; Reinmann 2005b, S. 60; Reinmann und Sesink 2011, S. 11). Als Ursprung von Gestaltungsforschung in der Lehr-Lernforschung wird oft Brown (1992) genannt, die mit ihrem Ansatz von Design Experiments Lernphänomene nicht im Labor, sondern in realen Gegebenheiten zu erforschen begann, weil die traditionelle, empirisch-analytische Wirkungsforschung für die Bildungspraxis kaum relevante Ergebnisse lieferte (Reinmann 2005b, S. 60).
Gestaltungsforschung beschränkt sich allerdings nicht nur auf Bildungsforschung, sondern findet u. a. auch Einsatz in der Managementforschung (van Aken et al. 2016, S. 2), der Organisationsforschung (van Aken 2007, S. 68) oder der Wirtschaftsinformatik (Euler 2014b, S. 15; Winter 2014a, S. 233). In Disziplinen wie der Medizin oder dem Ingenieurwesen ist Gestaltungsforschung gar seit den Anfängen als Standard anerkannt (van Aken et al. 2016, S. 2). Es lässt sich feststellen, dass gestaltungsorientierte Ansätze insbesondere bei Forschenden an Beliebtheit gewinnen, die der Wissenschaft eine Innovationsfunktion mit Praxisbezug zuschreiben (Euler 2014b, S. 15–16; Raatz 2015, S. 16–17; Sandoval 2004, S. 213).
Euler (2014b, S. 21) weist zwar darauf hin, dass die Klassifizierung der Gestaltungsforschung als Paradigma noch zu früh sein könnte, da sich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft noch kein allgemein anerkanntes Regelwerk etablieren konnte. Allerdings ist seit dieser Feststellung bereits wieder rund ein halbes Jahrzehnt vergangen und die Anzahl gestaltungsorientierter Forschungsvorhaben steigt kontinuierlich (Tramm et al. 2017, S. 2). Zudem handelt es sich bei der Gestaltungsforschung – abgesehen von forschungsmethodologisch (noch) etwas unterschiedlichen Ausprägungen – um einen Forschungsansatz mit relativ etablierten Grundsätzen (Raatz 2015, S. 17). So ist für Gestaltungsforschung insbesondere charakteristisch, dass (1) Innovationen für Praxisprobleme (2) iterativ und in der kontinuierlichen (3) Zusammenarbeit mit der Praxis gelöst werden, um daraus nicht zuletzt auch (4) wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen (Euler 2014b, S. 15; McKenney und Reeves 2012, S. 7–8; Raatz 2015, S. 17–18; Reinmann 2005b, S. 61; The Design-Based Research Collective 2003, S. 5).
Diese vier konstitutiven Merkmale (Innovation als Erkenntnis- und Gestaltungsinteresse, iterative Gestaltungszyklen als Kristallisationspunkt der Erkenntnisgewinnung, Wissenschaft-Praxis-Kooperation als Nukleus der Theorieentwicklung sowie Theorie als Ausgangspunkt, Stellhebel und Ergebnis des Gestaltungsprozesses) sollen in der Folge näher erläutert werden. Dies soll das vorliegende Verständnis von Gestaltungsforschung schärfen und so eine differenzierte Begründung zum gewählten Forschungsansatz ermöglichen (Teil A: 5.3).
5.1.1 Innovationsentwicklung als Erkenntnis- und Gestaltungsinteresse
Die Gestaltungsforschung ist nicht zuletzt eine Antwort auf traditionelle empirischanalytische Forschungsansätze, die zunehmend in der Kritik stehen, weil sich die daraus resultierenden wissenschaftlichen Befunde für die Praxis kaum anschlussfähig zeigten (Euler 2014b, S. 15–16). Dieser Einwand an die Adresse der empirischen Wirkungsforschung lässt sich vor allem damit begründen, dass Wirkungszusammenhänge in sozialen Systemen zu komplex sind, als dass sie auf einige Variablen reduziert werden können (Raatz 2015, S. 15–16). Andere Forschungsansätze wie Meta-Analysen und Ethnographie zeigen sich zwar geeigneter, um die komplexen Wirkungskräfte zu verstehen, doch auch damit konnten bisher kaum relevante Erkenntnisse generiert werden, um die Praxis zu verbessern (Reinmann 2005b, S. 57).
Gestaltungsforschung positioniert sich vor diesem Hintergrund als ein Forschungsansatz, mit dem Innovationen zur Lösung von Praxisproblemen entwickelt werden können, ohne dass die Generierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen vernachlässigt wird (McKenney und Reeves 2014, S. 141; van Aken et al. 2016, S. 1). Im Fokus der Gestaltungsforschung steht somit nicht, etwas Vorhandenes zu beweisen, sondern vielmehr, etwas Neues zu explorieren und zu testen (Euler 2014c, S. 17). Wie Euler (2014b, S. 16) aufzeigt, verschiebt sich dadurch der Forschungsfokus weg von der Frage, «ob eine bestehende Intervention (syn.: Design, Massnahme, Problemlösung) wirksam ist, sondern es wird gefragt, wie ein erstrebenswertes Ziel in einem gegebenen Kontext am besten durch eine noch zu entwickelnde Intervention erreicht werden könnte» [Hervorhebungen im Original]. Der Ausgangspunkt der Gestaltungsforschung ist somit stets das (Innovations-)Ziel, woraus sich dann die geeigneten Methoden ableiten lassen. Deshalb hält Reinmann (2005b, S. 60) auch fest, dass sich Gestaltungsforschung nicht durch eine spezifische Methodologie, sondern stets über die Zielsetzung definiert, eine nachhaltige Innovation zu entwickeln. Dabei reicht eine neuartige Idee analog zum betriebswirtschaftlich geprägten Begriffsverständnis nicht aus, um sie als Innovation zu qualifizieren. Vielmehr muss diese auch implementiert werden und eine (positive) Wirkung entfalten (Reinmann 2005b, S. 53).
Im Gegensatz zu reinen Innovationsprojekten in der Praxis beschränkt sich Gestaltungsforschung allerdings nicht auf die Entwicklung von Innovationen, sondern versucht auch zu verstehen, wie, wann und warum eine Intervention in der Praxis funktioniert (The Design-Based Research Collective 2003, S. 5). Praxisprobleme sollen bei der Gestaltungsforschung also nicht nur gelöst werden – sie sind auch der essentielle Treiber dafür, dass wissenschaftliche Theorien weiterentwickelt werden (van Aken 2007, S. 68). Dadurch rücken Problemstellungen in den Fokus, für die bis dahin kaum valide Heuristiken bekannt sind (Plomp 2010, S. 13). Die Voraussetzung für potenzialreiche Gestaltungsforschung ist deshalb, dass es für das zu lösende Problem «(noch) keine (hinreichende) theoretisch begründete […] Intervention» gibt (Brahm und Jenert 2014, S. 46). Daher eignen sich für gestaltungsorientierte Forschungsansätze vor allem Forschungsvorhaben, bei denen sowohl eine wissenschaftliche Relevanz als auch ein effektives Praxisproblem vorzufinden sind (Euler 2014b, S. 16). Im vorliegenden Forschungsvorhaben wurde bereits bei der Ausarbeitung der Problemstellung und des Forschungsziels grob auf den Innovationscharakter des Erkenntnisinteresses eingegangen. Eine nähere Überprüfung dieses zentralen Grundsatzes der Gestaltungsforschung erfolgt zudem in der noch folgenden Problempräzisierung (Teil A: 5.4.1).
5.1.2 Iterative Gestaltungszyklen als Kristallisationspunkt der Erkenntnisgewinnung
Die iterativen Gestaltungszyklen stellen ein zweites konstitutives Merkmal der Gestaltungsforschung dar, da sich gestaltungsorientierte Forschungsstrategien vor allem für Vorhaben eignen, bei denen zuerst noch Lösungsansätze entwickelt werden müssen. Es können somit keine bestehenden Ansätze untersucht, sondern es müssen neue Möglichkeiten gefunden werden (Euler 2014b, S. 16). Die Entwicklung von Gestaltungsprototypen hilft dabei, in einem iterativen Prozess die zugrunde gelegten Annahmen und Aussagen rasch und kontinuierlich zu verfeinern (Seufert 2014, S. 85). Diese Verfeinerung sowohl der Praxislösung als auch der theoretischen Gestaltungsprinzipien gelingt gemäss Reinmann (2005b, S. 66–67) in Gestaltungsprozessen besser als in einem analytischen Prozess, weil die praxisgeprägte Zielorientierung die Entwicklung von umsetzbaren Theorien unterstützt. Zudem werden typische Implementierungsprobleme vermieden, indem die vorherrschenden Kontextfaktoren im Prozess immanent Berücksichtigung finden. Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass das Design als (kognitiv) fassbares Artefakt dient und so die Optimierungspotenziale besser sichtbar machen kann. Reinmann (2005b, S. 61–62) bezeichnet das Design deshalb auch «Kristallisationspunkt für systematische Lernprozesse».
Zur Entwicklung solcher Designs wird zuerst ein theoretisch fundierter und auf die Praxis abgestimmter Prototyp entworfen (Euler 2014b, S. 17). Anschliessend werden diese provisorischen Gestaltungsannahmen in kleinen Gestaltungsschlaufen stetig verbessert, indem geprüft wird, wie diese in der Praxis funktionieren (Collins et al. 2004, S. 18). Dies macht die Gestaltungsforschung vorausschauend und reflektierend zugleich (Reinmann 2005b, S. 61). Vorausschauend, weil mögliche Wirkungszusammenhänge auf Basis von bestehender Theorie im Design berücksichtigt werden. Reflektierend, da getroffene Annahmen kontinuierlich überprüft, analysiert und angepasst werden.





























