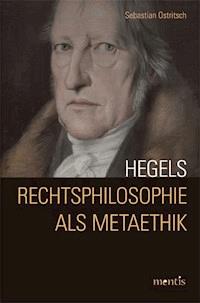14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spielen – Töten – Leben – Gut und Böse in virtuellen Welten Der Computer ändert alles, auch das Spiel der Menschen. Sebastian Ostritsch wirft einen ethischen Blick auf die neuartige Kulturform "Computerspiel" und fragt nach ihrem Verhältnis zu Moral und Glück sowie nach Chancen und Gefahren des Gaming. Er macht das Neue und Einzigartige des Computerspielens sichtbar. Mit Hilfe der Philosophiegeschichte erklärt Ostritsch, worin genau die ethischen Herausforderungen bestehen und wie sich Spiele auf die Realität jenseits des Bildschirms auswirken können. Dieses Buch wird nicht nur der Erfahrungswelt der Gamer gerecht, sondern berücksichtigt auch die empirische Forschung zum Thema, erteilt dabei aber Verharmlosung wie Alarmismus gleichermaßen eine Absage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sebastian Ostritsch
Let’s Play oder Game Over?
Eine Ethik des Computerspiels
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Vorspiel: Kopfschuss! … und sokratische Bedenken
Als Terrorist gefällt mir die Kalaschnikow am besten. Sie ist präzise und effektiv. Dennoch zücke ich zunächst das Messer und renne los. Auf diese Weise bin ich etwas schneller. Nach einem kurzen Sprint durch den Wüstensand bleibe ich vor dem Eingang des Gebäudes stehen. Ich wechsle wieder auf mein Gewehr und gehe in die Hocke. Langsam schleiche ich mich hinein … Plötzlich der grelle Blitz einer Blendgranate. Ich kann nichts mehr sehen und feuere nur noch wild um mich, doch ich habe keine Chance: Mein Gegner macht kurzen Prozess mit mir. Kopfschuss. Ich bin tot.
Natürlich bin ich nicht wirklich tot. Ich habe auch nicht wirklich in eine Blendgranate geschaut oder mit einem Maschinengewehr um mich geschossen. Auch bin ich selbstverständlich kein Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Ich sitze vielmehr zu Hause im bequemen Bürosessel vor dem Bildschirm, die eine Hand auf der Tastatur, die andere auf der Maus, und spiele mit meinen Freunden Counter-Strike: Source (2004). Über das Headset höre ich sie abwechselnd fluchen und lachen. Für sie geht das Spiel weiter, während ich bis zum Start der nächsten Runde zum Zuschauen verdammt bin. Ziel jeder Runde ist es, entweder alle Gegner auszuschalten oder aber eines von zwei möglichen Missionszielen zu erreichen: Auf einer Sorte map, wie die Schauplätze oder Level in solchen Spielen genannt werden, müssen die Terroristen an bestimmten Orten eine Bombe legen und diese zum Explodieren bringen; die Spieler der Antiterroreinheit müssen dies verhindern und den gelegten Sprengsatz entschärfen. In der anderen Art von Level muss die Antiterroreinheit Geiseln befreien und zu einem bestimmten Punkt auf der Karte führen, um sie zu retten.
Counter-Strike ist nicht irgendein obskures Computerspiel, sondern eines der beliebtesten Games der letzten zwanzig Jahre. Es kam im Jahr 2000 als sogenannte Mod (kurz für »modification«) des enorm erfolgreichen Ego-Shooters Half-Life (1998) auf den Markt. Die inzwischen meistgespielte Version von Counter-Strike trägt den Zusatz »Global Offensive« (2012) und wird derzeit weltweit monatlich von rund 20 Millionen Spielern gespielt. Für die meisten von ihnen ist Counter-Strike nur Unterhaltung und Zeitvertreib. Es gibt aber auch Profis, für die das Spiel zum Beruf geworden ist. Bei manchen internationalen Großturnieren winken Preisgelder in Millionenhöhe.
In das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit in Deutschland trat Counter-Strike im Zuge der Aufarbeitung des Attentats von Winnenden im Jahr 2009. Der siebzehnjährige Täter, der fünfzehn Menschen ermordete, hatte regelmäßig Counter-Strike gespielt. Dessen wirksame Etikettierung als »Killerspiel« und die Ahnungslosigkeit von Politik und Medien beim Thema »Computerspiele« ließen Ego-Shooter im Allgemeinen und Counter-Strike im Besonderen schnell zum Sündenbock werden. Der damalige bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte ein Verbot von »Killerspielen«, ein Aktionsbündnis rief zur öffentlichen Entsorgung von Spielen auf, »die das Töten von Menschen simulieren«, und die Stadt Stuttgart untersagte der Electronic Sports Leaguedie öffentliche Austragung eines Spieltages der Counter-Strike-Liga.[1]
Die Debatte um Computerspiele als mögliche Mitursache für reale Verbrechen brandet bis heute national wie international immer wieder auf, insbesondere dann, wenn sich reale Gewaltexzesse nach dem vermeintlichen Vorbild computersimulierter Gewalt zu ereignen scheinen. Nachdem 2020 in Chicago die Zahl der sogenannten Carjackings – also der Vorfälle, bei denen Fahrer gewaltsam ihres Autos beraubt wurden – auf über 1400 Fälle angestiegen war und sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hatte, geriet dort das berühmt-berüchtigte Spiel Grand Theft Auto V (GTA V, 2013)ins Visier der Politik. In der Tat ist die Möglichkeit, anderen Verkehrsteilnehmern mit Gewalt den fahrbaren Untersatz zu entwenden, ein fester Bestandteil der seit 1997 bestehenden GTA-Spielereihe. Ein Abgeordneter der Demokraten im Repräsentantenhaus von Illinois wollte daraufhin ein Gesetz einbringen, das den Verkauf von Games, die dazu ermutigten, gewalttätige, das heißt physisch oder psychisch verletzende Handlungen auszuführen, in dem US-Bundesstaat zukünftig verbieten sollte. Er scheiterte jedoch mit seinem Vorstoß.[2]
Die Debatte um die Schädlichkeit von Computerspielen und die Notwendigkeit, sie zu verbieten, ist im Grunde nur die Neuauflage einer uralten ethischen Debatte, die sich bereits in der griechischen Antike findet. Schon Platon, einer der Väter der abendländischen Philosophie, diskutiert die Sorge, die Darstellung lasterhafter Menschen und schlechter Handlungen könnte die Sitten verderben.[3] Besonders gefährdet scheint ihm, wer sich nicht nur passiv derartigen Darstellungen aussetzt, sondern schlechte Handlungen selbst nachahmt. In Platons Der Staat fragt Sokrates – in Wahrheit Platons Lehrer und zugleich das literarische Sprachrohr seiner Dialoge – seinen Gesprächspartner Adeimantos, ob dieser denn nicht bemerkt habe, »dass die Nachahmungen, wenn man es von Jugend an stark damit treibt, in Gewöhnungen und in Natur übergehen«.[4] Für Sokrates (und damit Platon) schien die Sache klar zu sein: Wer bestimmte Verhaltensweisen lange genug nachahmt, der verinnerlicht die dazugehörigen Einstellungen und macht sie zu Bestandteilen seines Charakters. Die Beschaffenheit des Charakters wiederum entscheidet darüber, ob ein Leben im Ganzen gelingt oder nicht, ob es also ein gutes oder ein schlechtes Leben wird.
Nun ist es eine Besonderheit von Computerspielen – etwas, was sie beispielsweise von Romanen oder Filmen unterscheidet –, dass wir in ihnen selbst tätig werden, indem wir bestimmte Handlungen spielerisch nachahmen. Ist deshalb die sokratische Warnung, man solle nicht durch Nachahmung des Schlechten selbst schlecht werden und damit das eigene Leben in falsche, unheilvolle Bahnen lenken, womöglich gerade mit Blick auf Computerspiele von besonderer Aktualität und Virulenz? Dass wir nicht geneigt sind, die Killerspielhysterie ahnungsloser Politiker allzu ernst zu nehmen, ist das eine. Aber Sokrates nicht ernst nehmen? Wenn er, die Personifikation abendländischer Weisheit, hier Bedenken äußert, wäre es zumindest unklug, nicht innezuhalten und einmal grundsätzlich über Computerspiele und ihr Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Moral und zum guten Leben nachzudenken.
In der Tat machen es sich manche Gamer zu einfach, wenn sie ihr Lieblingsmedium dadurch gegen Angriffe zu schützen versuchen, dass sie mantraartig behaupten: »Das ist doch nur ein Spiel!« und so jegliche Verbindung zwischen Spiel und dem Ernst der Wirklichkeit leugnen. Der Preis für diese Strategie ist allerdings hoch. Denn wenn Computerspiele wirklich nur triviale Spiele sind und weder eine ästhetische, kulturelle oder gesellschaftliche Relevanz noch irgendeinen Wirklichkeitsbezug besitzen, dann muss, ja dann kann man sie gar nicht ernst nehmen. Gerade das – ernst genommen zu werden – ist aber das berechtigte Anliegen vieler Computerspieler, ein Anliegen, dem gesellschaftlich auch immer mehr entsprochen wird. Inzwischen ist es durchaus üblich, dass neue Computerspiele in Feuilletons besprochen werden. Es gibt eigene Magazine, die sich den verschiedensten Aspekten der Gamingkultur widmen. Mit den sogenannten Game Studies hat sich sogar eine eigenständige, interdisziplinär geprägte wissenschaftliche Disziplin zur Erforschung von Computerspielen herausgebildet.[5] Und auch die Philosophie, insbesondere die Kunstphilosophie und die Ästhetik, hat Computerspiele als Thema für sich entdeckt.[6]
Das alles weist darauf hin, dass Computerspiele eben doch nicht pauschal einfach nur Spiele sind und dass man sie folglich weder als völlig harm- noch als gänzlich bedeutungslosen Zeitvertreib abtun darf. Sie sind vielmehr zu einer eigenständigen Kulturform gediehen, indem viele von ihnen jenseits ihres Unterhaltungswerts auch bestimmte Auffassungen vom Schönen, Wahren und Guten vermitteln. Games als Kulturform ernst zu nehmen, bedeutet folglich, sie sowohl in ästhetischer als auch in ethischer Hinsicht zu reflektieren. Gerade dieser ethische Blick auf Computerspiele ist im öffentlichen Diskurs interessanterweise jedoch bisher deutlich zu kurz gekommen. Sicher, moralisch empörte Meinungsäußerungen und ebenso leidenschaftliche Verteidigungen gibt es zuhauf, aber reflektiert, durchdacht und begriffen ist das Thema deswegen noch lange nicht. Das zu leisten ist die Aufgabe einer philosophischen Ethik der Computerspiele, wie sie dieses Buch liefern möchte. So wie das philosophische Denken für den Alltagsverstand durchaus herausfordernd sein kann, dürfte umgekehrt für viele philosophisch Vorgebildete das Thema »Computerspiele« exotisch und unzugänglich erscheinen. Aber keine Sorge: In den folgenden Kapiteln wird weder philosophisches Vorwissen noch Vertrautheit mit der Welt der Computerspiele vorausgesetzt. Sollte der Leser über ihm unvertrautes Vokabular aus der Gamingwelt stolpern, dann kann er die wichtigsten Begriffe im Glossar am Ende dieses Buches nachschlagen.
\
Der Ausdruck »Ethik« ist notorisch mehrdeutig und wird selbst von Fachphilosophen auf unterschiedliche Weise verwendet. Was genau soll also in diesem Buch unter »Ethik« verstanden werden? Die Wurzel bildet das griechische Wort ethos, was so viel bedeutet wie »Sitte« oder »Brauch«. Im Lateinischen heißen die Sitten und Bräuche einer Gemeinschaft mores, was wiederum die Grundlage des deutschen Wortes »Moral« ist. »Ethik« und »Moral« verweisen von ihrer ursprünglichen Wortbedeutung her also auf dasselbe. Der Ausdruck »Ethik« meint aber nicht nur den Bereich des Sittlichen selbst, sondern dient zugleich als Oberbegriff für die philosophische Disziplin, die sich systematisch mit den entsprechenden Phänomenen beschäftigt.
Auch wenn »Ethik« und »Moral« dieselbe Bedeutungswurzel haben, hat sich der Begriff der Moral zumindest innerhalb der Philosophie im Laufe der Jahrhunderte auf einen besonderen Bereich verengt, nämlich auf das, was wir heute als moralische Gebote oder moralische Pflichten bezeichnen. Man denke nur an die Zehn Gebote, bei denen es sich ja nicht um Empfehlungen oder Ratschläge, sondern um unbedingte Forderungen handelt. Wenn also von der Moral im engeren Sinne die Rede ist, dann bewegt man sich in der Sphäre von Gut und Böse, von Pflicht und Verbot. Woher die Forderungen der Moral kommen – ob von Gott, aus der Natur oder der menschlichen Vernunft –, ist dabei erst einmal gleichgültig.
Mit der Moral im engeren Sinne sind jedoch noch lange nicht alle ethischen Phänomene abgedeckt. In der Antike war diese Auffassung von Moral im Grunde sogar unbekannt.[7] Stattdessen ging es zu Beginn der philosophischen Ethik primär um die Frage nach dem guten Leben, also danach, wie der Einzelne durch eine kluge Lebensführung Glückseligkeit erlangen kann. Statt um das harte »Du sollst!« und »Du sollst nicht!« drehte sich hier alles um das weichere »Du solltest« und »Du solltest nicht«. Während die Moralphilosophie sich also mit dem unter allen Umständen gebotenen Handeln beschäftigt, stellt die Glücks- oder Klugheitsethik den menschlichen Charakter mit seinen Tugenden und Lastern in den Mittelpunkt, weshalb sie auch den Namen »Tugendethik« trägt. Die Tugendethik ist aber beileibe keine bloß historische Veranstaltung, sondern hat insbesondere im 20. Jahrhundert eine Renaissance erlebt und ist zu Recht wieder fester Bestandteil der philosophischen Diskussion.
Die Ethik der Computerspiele, die in diesem Buch entwickelt wird, versteht sich als eine philosophische Ethik im weiten Sinne: Sie denkt über das Phänomen »Computerspiele« sowohl aus moralischer als auch aus klugheitsethischer Sicht nach. Ganz im Sinne der Philosophie geht es um Grundsätzliches: Wie können Computerspiele, die ja doch immer Spielesind, überhaupt einer moralischen Bewertung unterzogen werden? Gib es Games, die per se moralisch schlecht oder vielleicht auch moralisch gut sind? Gibt es Dinge, die wir in Computerspielen nicht tun dürfen, selbst wenn niemand wirklich zu Schaden kommt? Können uns Computerspiele dabei helfen, ethisches Wissen zu erlangen, das heißt, etwas über uns selbst als moralische Wesen, inklusive unserer Abgründigkeit, erfahren? Ist es einem guten, gelingenden Leben zu- oder abträglich, Computerspiele zu spielen? Welche Rolle spielen Computerspiele im Kulturkampf um die richtigen Werte der Gesellschaft? Und was ist mit Blick auf das gute Leben davon zu halten, dass immer mehr Bereiche der Lebenswelt, einschließlich der Arbeit, durch »Gamification« mit Elementen versehen werden, die den Charakter von Computerspielen haben?
Wenngleich der Leser keinen pädagogischen Elternratgeber und auch keinen politisch-juristischen Traktat erwarten darf, so ist doch eine philosophische Ethik der Computerspiele für diese beiden Bereiche unerlässlich. Über das Verhältnis von Erziehung und Gesetzgebung zu Computerspielen lässt sich nämlich erst dann sinnvoll sprechen, wenn die grundlegende normative Dimension von Computerspielen mithilfe der Ethik durchmessen ist.
Mit Blick auf die Pädagogik ist noch anzumerken, dass Computerspiele in diesem Buch primär nicht als Spiele für Kinder betrachtet werden. Die Kernthese ist vielmehr, dass Computerspiele ein »erwachsenes« Medium sind, das wie Literatur und Film ein enormes ethisches Potenzial in sich birgt und daher verdientermaßen einen Platz im Rahmen eines guten Lebens einnehmen darf. Was die durchaus verständliche Sorge vieler Eltern betrifft, dass ihre (jungen) Kinder an brutalen Computerspielen seelischen Schaden nehmen könnten, so ist vor allem auf den englischen Psychologen D. W. Winnicott zu verweisen, der stets die Bedeutung der »gesunden Instinkte normaler Eltern« betont hat.[8] Es braucht also weder Philosophen noch Psychologen, sondern nur den herkömmlichen – zugegebenermaßen rarer werdenden – gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass man kleinen Kindern keine Horrorfilme und kein pornographisches Material zeigen, dass man ihnen keine Erwachsenenthriller vorlesen und sie auch keine Ego-Shooter spielen lassen sollte, und zwar ganz einfach deshalb, weil das Material sie erschrecken, verstören und auch sonst in vielfacher Hinsicht überfordern würde. Was diese Einsicht angeht, ist empirische Laborforschung jedenfalls nicht nur überflüssig, sondern es darf sie aus offensichtlichen ethischen Gründen gar nicht geben.
Kniffliger wird die Sache natürlich, sobald es nicht um Kinder, sondern um Jugendliche und junge Erwachsene geht. Bei ihnen stellen sich die oben genannten ethischen Fragen ebenso wie bei Erwachsenen, und das sogar in verschärfter Form, weil junge Menschen offenkundig noch im Prozess der charakterlichen Formung und Selbstfindung stecken, den die meisten Erwachsenen – zum Guten wie zum Schlechten – bereits hinter sich haben. Dennoch wäre es ein Fehler, Computerspiele als Freizeitbeschäftigung nur für Halbwüchsige abzutun. Die Kinder und Jugendlichen, die in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Computerspielen aufgewachsen sind, sind nämlich inzwischen erwachsen geworden und machen heute die Kerngruppe der Gamer aus.
Der englische Philosoph David Hartley (1705–1757) soll einmal gesagt haben, dass nichts so viel über den Menschen verrate wie die Spiele, die er spielt.[9] Auch wenn diese Aussage in ihrer Absolutheit wohl über das Ziel hinausschießt, wird man nur schwer leugnen können, dass Spiele ein Fenster zu den jeweils gerade akzeptierten Werten und Normen einer Kultur sind. Computerspiele sind nun fraglos die Spiele unserer Zeit und können Rückschlüsse auf unsere heutigen Wert- und Normvorstellungen geben. Wie wir im Laufe dieses Buches sehen werden, sind Games nicht nur Unterhaltung und Zeitvertreib, sondern darüber hinaus ein Medium, in dem Wünsche, Ängste und Werte, ja ganze Weltanschauungen auf neuartige Weise zum Ausdruck kommen können. Computerspiele machen fragwürdige symbolische Grenzüberschreitungen möglich, sie können aber auch tiefgründigen ethischen Erfahrungen und echten Freundschaften Raum geben. In all diesen Fällen sind sie ein Spiegel der Gesellschaft, die sie produziert und massenhaft konsumiert. Eine philosophische Reflexion von Computerspielen kann also dazu beitragen, unsere Gesellschaft und letztlich uns selbst besser zu verstehen.
Die Wesensfrage
Bevor man eine Sache ethisch reflektieren und bewerten kann, muss man wissen, worüber man redet. Für unser Thema heißt das, dass wir uns zuerst klarmachen müssen, was Computerspiele eigentlich sind. Um aber wiederum das tun zu können, müssen wir zunächst einmal ganz allgemein die Frage beantworten, was das eigentlich ist, ein »Spiel«.
Die klassische, bis auf Aristoteles zurückreichende Weise, etwas zu definieren, besteht darin, die nächsthöhere Gattung der zu definierenden Sache sowie ihren artbildenden Unterschied (ihre sogenannte spezifische Differenz) zu nennen. So ist zum Beispiel »vernünftiges Lebewesen« eine gängige Definition des Menschen, wobei »Lebewesen« die nächsthöhere Gattung und »Vernünftigkeit« die spezifische Differenz, also der entscheidende Unterschied zwischen Menschen und anderen Lebewesen, ist. Wie könnte nun eine Definition des Spiels nach diesem aristotelischen Muster aussehen?
Die nächsthöhere Gattung scheint recht schnell gefunden zu sein, ist das Spiel doch offenbar eine menschliche Tätigkeit. Doch schon hier lassen sich Zweifel formulieren: Ist es denn so klar, dass es beim Spiel um eine menschliche Tätigkeit gehen muss? Spielen nicht auch Tiere? Nun, grundsätzlich ist bei der vorschnellen Identifikation von menschlichem Handeln und tierischem Verhalten Vorsicht geboten. Zum Beispiel ist es höchst zweifelhaft, ob Vögel an sich wirklich singen. Zweifellos singen sie manchmal für uns; in der richtigen Stimmung hören wir das nächtliche Gezwitscher einer Nachtigall als bezaubernde Serenade. Nüchtern betrachtet, ist der Gesang der Vögel jedoch nur gewöhnliche animalische Kommunikation, Warn- oder Lockruf, aber nicht musikalisch-künstlerischer Ausdruck des Innenlebens, wie es der Gesang des Menschen ist.
Mit dem Spielen verhält es sich dann aber doch anders. Wie, wenn nicht als Spiel, sollte man etwa das Verhalten zweier Hunde bezeichnen, die einander auf der Wiese hin und her jagen, die wild miteinander tollen und raufen, während sie zugleich penibel darauf achten, den Kameraden nicht zu verletzen, und die sogar aus freien Stücken die Rollen wechseln, sodass mal der eine und mal der andere sich unterwürfig beziehungsweise dominant gibt? Hartnäckige Skeptiker könnten diesem Treiben natürlich eine verborgene evolutionäre Funktion unterstellen und behaupten, dass die Tiere nur bestimmte überlebenswichtige Fähigkeiten wie Jagen, Flüchten oder Kämpfen einübten und daher in Wahrheit gar nicht spielten. Das Problem an einem solchen Erklärungsversuch ist freilich, dass er das Verständnis der Phänomene genau genommen verunmöglicht, indem er sie schlicht wegerklärt. Dass Tiere beim Spielen auch noch Fähigkeiten trainieren, die außerhalb des Spiels von Nutzen sind, mag durchaus der Fall sein, bedeutet aber nicht, dass sie deshalb nicht spielen. Schließlich gilt auch für den Menschen, dass er beispielsweise durch das Computerspielen die allgemeine Hand-Augen-Koordination und durch das Schachspiel seine kognitiven Fähigkeiten trainiert, woraus aber nicht folgt, dass Computerspiele oder Schach keine Spiele wären. Wir können das Spiel also nicht als etwas rein Menschliches bestimmen, sondern müssen es als eine Tätigkeit betrachten, zu der sowohl menschliche als auch tierische Lebewesen fähig sind.
Fragen wir also weiter nach der spezifischen Differenz des Spiels. Welche besondere Eigenschaft ist allen Spielen gemein und wesentlich, das heißt, welche Eigenschaft macht Tätigkeiten zu spielerischen Tätigkeiten?
Wenn es nach dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein geht, dann ist bereits bezüglich dieser Art der Fragestellung höchste Vorsicht geboten. In seinen posthum erschienenen PhilosophischenUntersuchungen (1953) warnt er nachdrücklich davor, einfach vorauszusetzen, dass es etwas allen Spielen Gemeinsames geben müsse:
Betrachte z. B. einmal die Vorgänge, die wir »Spiele« nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Kampfspiele, u. s. w. Was ist allen diesen gemeinsam? – Sag nicht: »Es muß ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht ›Spiele‹« – sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist.[1]
Wittgenstein fordert uns also auf, genau hinzusehen und die Vielfalt der Phänomene, die wir als »Spiele« bezeichnen, ernst zu nehmen. Er selbst war letztlich der Überzeugung, dass sich Spiele gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, sondern nur eine gewisse »Familienähnlichkeit« aufweisen. So, wie die Mitglieder einer Familie über die Generationengrenzen hinweg einander ähneln, ohne dass es ein Merkmal gäbe, das allen gemeinsam ist und diese Familie von anderen unterscheidet, so ähnelten auch alle Spiele einander, ohne dass es das Wesen des Spiels gäbe. Wittgensteins skeptische Warnung ist sicher berechtigt. Allerdings heißt das nicht, dass wir nicht zumindest versuchen sollten, ein allgemeines Wesen des Spiels ausfindig zu machen. Wenn es nicht gelingt, können wir immer noch an Wittgensteins Begriff der Familienähnlichkeit anschließen.
Der niederländische Historiker und Kulturphilosoph Johan Huizinga, der mit seinem Jahrhundertwerk Homo Ludens (1938)das Nachdenken über Spiele maßgeblich geprägt hat, hat das Spiel treffend als »ein Superabundans, etwas Überflüssiges« bezeichnet.[2] Das Spiel ist gerade dadurch Spiel, dass es sich nicht über einen Nutzen definieren lässt. Das Spielen eines Spiels ist eine gänzlich unnötige Kraftanstrengung, oder wie es der Philosoph Bernard Suits ausgedrückt hat: »[E]in Spiel zu spielen ist der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden.«[3] Das Spiel dient keinen externen Zwecken und ist somit zweckfrei beziehungsweise hat seinen Zweck in sich selbst. Selbstverständlich kann es auch fremden Zwecken dienen, aber eben nur zusätzlich oder nebenbei, wie wir oben am Beispiel des Spiels der Hunde bereits bemerkt haben. Seinem Wesen nach bleibt es Selbstzweck. Auf die Frage, warum man spielt, kann es keine andere Antwort geben als die, dass es eben Freude bereitet zu spielen (was, nebenbei bemerkt, natürlich nicht ausschließt, dass man sich beim Spielen manchmal auch furchtbar ärgern kann).
Rein gar nichts ist übrigens damit gewonnen, wenn jemand die Frage, warum Tier und Mensch spielen, mit dem Verweis auf einen zugrunde liegenden Spieltrieb zu beantworten versucht. Dabei handelt sich um eine Pseudoerklärung, vergleichbar mit der, über die sich Molière in seiner Komödie Der eingebildete Kranke (1673) lustig macht. Darin wird ein Medizinstudent während des Examens gefragt, was denn die Ursache dafür sei, dass Opium eine einschläfernde Wirkung habe. Seine Antwort, die gesuchte Ursache liege in der einschläfernden Kraft (»virtus dormativa«) des Opiums, entzückt zwar die anwesenden Doctores, was uns aber nur umso mehr zum Lachen bringen sollte.[4]
Das Spiel istüberschäumendes Leben, das sich nicht in die Zwangsjacke mechanischer Wirkzusammenhänge oder zweckrationaler Nutzenkalkulationen pressen lässt. Das gilt auch schon für das Spiel der Tiere, in dem – so Friedrich Schiller – »das überflüssige Leben sich selbst zur Tätigkeit stachelt«.[5] Huizinga hat diesen Gedanken dahin gehend ausgeführt, dass sich schon im animalischen Spiel der Geist Bahn bricht und die Tiere damit als Wesen erweist, deren Lebensform die Grenzen des bloß Materiellen und Mechanischen übersteigt.[6] Zugleich lässt sich mit Blick auf das Aufscheinen des Geistes im Spiel der Tiere auch der Unterschied zum Spiel der Menschen bestimmen: Der Mensch spielt nicht nur, sondern er weiß im Gegensatz zum Tier auch, dass er spielt.[7]
Die Fähigkeit zum selbstbewussten Spiel kommt allein dem Menschen zu. Aus dieser besonderen Fähigkeit ergibt sich auch, dass der Mensch alles, was ihm im Alltag als Zwang und Notwendigkeit begegnet, zum Spiel machen kann. Dieser Macht des Spiels zur Transformation des öden Alltags bedient sich jedes Kind, das seinen Nachhausweg in das Spielfeld eines Geh- oder Hüpfspiels verwandelt: Nur nicht auf die Fugen zwischen den Pflastersteinen treten, sonst hat man verloren!
Haben wir mit dem bisher Gesagten das Wesen des Spiels erfasst? Ist das Spiel als überflüssige,selbstzweckhafte Tätigkeit hinreichend bestimmt? Zweifel drängen sich auf. Schließlich scheint es eine ganze Menge menschlicher Aktivitäten zu geben, die überflüssig sind, ihren Zweck in sich selbst haben und bei denen wir dennoch zögern würden, sie als »Spiele« zu bezeichnen.
Denken wir etwa an das Flanieren. Wer flaniert, der läuft nicht von A nach B in der Absicht, dort etwas Bestimmtes zu erledigen. Vielmehr liegt der Zweck und damit auch der Sinn seiner Tätigkeit im Spazieren selbst. Der Flaneur spaziert nicht, um irgendwo hinzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Sein Tun ist überflüssig, aber sinnvoll, oder genauer: Sein Tun ist sinnvoll, weil es überflüssig ist. Ist das Flanieren nun aber Spiel? Offenbar nicht in einem alltäglichen Sinne. Niemand sagt, wenn er nach seinen Lieblingsspielen gefragt wird: »Fußball, Monopoly, Würfelspiele aller Art – und Flanieren.« Und doch fällt unweigerlich das Spielerische am Flanieren ins Auge, wenn wir es mit dem zielgerichteten Gehen von A nach B vergleichen.
Ähnliches lässt sich auch von einer ganzen Reihe anderer überflüssiger und selbstzweckhafter Tätigkeiten sagen, in erster Linie natürlich von der Kunst. »Überflüssige und selbstzweckhafte Tätigkeit« – diese Ausdrucksweise erinnert an die Formel L’art pour l’art, das Ideal einer Kunst rein um der Kunst willen. Aber auch Immanuel Kants berühmte Definition des Schönen mag einem hier in den Sinn kommen: Das Wohlgefallen, das wir am Schönen empfinden, ist nach Kant ein Wohlgefallen »ohne alles Interesse«, das heißt ein Wohlgefallen, das sich nicht aus der Nützlichkeit einer Sache für bestimmte Zwecke ergibt.[8] Ein solches interesseloses oder »uninteressiertes« Wohlgefallen hat nach Kants eigenen Überlegungen eine enge Verbindung zum Spiel.[9] Denn das für das Schöne typische Wohlgefallen ist ihm zufolge das Resultat eines »freien Spiels der Erkenntnisvermögen«: Schöne Gegenstände regen unsere Erkenntniskräfte, namentlich die Einbildungskraft und den Verstand, zu einem letztlich unerschöpflichen Spiel aus Fantasie und Begreifen an.[10]
Wenn Kant davon spricht, dass das Schöne und insbesondere die schönen Künste zu einer Art freiem Spiel unseres Geistes Anlass geben, dann gilt wie schon für das Beispiel des Flanierens: Es handelt sich nicht um ein Spiel im alltäglichen Sinne des Wortes. Und doch liegt der Erfahrung des Schönen in der Analyse Kants zweifellos etwas Spielerisches zugrunde. Um der Verlegenheit zu entkommen, den Begriff des Spiels stets entweder zu weit oder zu eng zu fassen, schlage ich vor, zwischen Spielen im herkömmlichen Sinne und dem Spielerischen in einem weiten Sinne zu unterscheiden. Diese Unterscheidung wird auch im Folgenden wichtig sein.
Dass das Spielerische das gesamte höhere, kulturelle Leben des Menschen prägt, ist die zentrale These von Huizingas Homo Ludens. Auch wenn Huizinga eine solche Unterscheidung zwischen Spielen im herkömmlichen Sinne und dem Spielerischen im weiten Sinne vernachlässigt hat, so geht es, wie Roger Caillois – ein anderer großer Spielforscher – angemerkt hat, in seinem Werk nicht um Spiele im alltäglichen Sinne, sondern um »den Geist des Spiels und dessen Fruchtbarkeit auf dem Gebiet der Kultur«.[11] Der Mensch ist für Huizinga ein von Grund auf spielendes Lebewesen, und als solches hat er die Kultur geschaffen: Recht, Politik, Wissenschaft, Dichtung, bildende Kunst, Philosophie, Religion, ja sogar manche wohlgeregelten Formen des Krieges – sie alle zeigen Facetten des Überflüssigen und in sich selbst Sinnvollen.[12] Sie atmen daher den Geist des Spielerischen, ohne jedoch Spiele im alltäglichen Sinne zu sein.
Huizinga hätte für seine These, dass der Mensch ein seinem Wesen nach spielendes Geschöpf ist und dass die Kultur gewissermaßen Folge oder Ausfluss spielerischer Schöpfungskraft ist, einen bereits genannten Geistesgiganten als Gewährsmann heranziehen können, den er in seinem Werk seltsamerweise aber nur an einer Stelle und auch nur beiläufig erwähnt: Friedrich Schiller.
Schiller setzt in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) Spiel und Schönheit als ästhetisches Spiel in eins. »Der Mensch«, schreibt er, »soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen.«[13] Zugleich erklärt er dieses Spiel aus und mit Schönheit in einer berühmten Sentenz zum Wesen des Menschen: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«[14] Das wahre Menschsein ereignet sich nach Schiller im schönen Spiel, das zugleich Spiel mit dem Schönen ist. Aus der ästhetischen Spieltätigkeit heraus vollzieht sich die allmähliche Herausbildung des Menschen als eines Kulturwesens. Im Spiel schafft der Mensch einen »Überfluss« der Form, »eine ästhetische Zugabe« zur nackten biologischen Existenz, und vollzieht so eine »Verschönerung seines Daseins«.[15] Wo die Dinge bis dahin nur zweckmäßig waren, schenkt der spielende Menschen den Gegenständen seiner Umwelt eine Dimension des Überflüssigen, die zugleich die Dimension der Schönheit ist. Gipfeln lässt Schiller diesen Prozess nicht etwa in der reinen, von aller Nützlichkeit losgelösten Kunst, sondern in einer politischen Vision vom ästhetischen Staat: Schönheit und Spiel allein könnten demnach dem Gemeinwesen »einen geselligen Charakter erteilen« und über die Schulung des guten Geschmacks eines jeden Einzelnen zugleich die »Harmonie in die Gesellschaft bringen«.[16] Erst wenn wir auf rechte Weise miteinander spielten, das heißt, wenn wir unsere Gemeinschaft zu einem großen schönen Spiel geformt hätten, sei ein wahrhaft menschlicher Staat entstanden.
Wie bei Huizinga, so ist es auch bei Schiller sinnvoll, seine Ausführungen vor dem Hintergrund der Unterscheidung von Spielen im alltäglichen Sinne und der ausgedehnteren Kategorie des Spielerischen zu deuten, auch wenn er selbst diese Unterscheidung nicht getroffen hat. Dann nämlich können wir sowohl Schiller als auch Huizinga darin zustimmen, dass das Spielerische die gesamte sozio-kulturelle Lebenswelt des Menschen durchzieht, ohne jedoch den Unterschied zwischen den Spielen im landläufigen Sinne (etwa kindlichen Rollenspielen, Brettspielen, Kartenspielen, Würfelspielen, Glücksspielen, Denkspielen, Ballspielen, Computerspielen und so weiter) und allen anderen menschlichen Tätigkeiten zu verwischen.
Auch wenn unser Verstand nach klaren Unterscheidungen lechzt, müssen wir letztlich doch zugestehen, dass der Übergang zwischen Spielen im landläufigen Sinne und spielerischen Aktivitäten in einem weiteren oder übertragenen Sinne fließend ist, also gerade über keine scharfe Grenze verfügt. Warum nicht etwa die Philosophie – also das, was wir hier gerade betreiben – als Spiel betrachten, wie dies etwa Platon oder auch Nietzsche getan haben?[17] Oder mit Schiller die Kunst als solche? Warum nicht mit Helmut Plessner die sozialen Rollen, die der Einzelne in der Gesellschaft einnimmt oder eben spielt, konsequenterweise auch als »Spiel«bezeichnen?[18] Warum nicht die katholische Liturgie nach dem Vorbild Romano Guardinis zum »heiligen Spiel« erklären?[19]
Die Antwort lautet, dass es keinen absoluten Grund gibt, das nicht zu tun. Der Begriff des Spiels ist nämlich ein Kontrastbegriff. Das heißt, wir verstehen alles Spielerische immer nur in relativer Abgrenzung zu einer nicht-spielerischen Normalität oder Wirklichkeit. So kann die Philosophie als Spiel erscheinen, insofern sie sich von den scheinbar ausweglosen Verstrickungen des alltäglichen Denkens und Sprechens befreit und sich in freier Reflexion über sie erhebt. Für den Universitätsprofessor, für den Philosophieren nur noch bedeutet, eine bestimmte Anzahl an Fachaufsätzen pro Jahr zu publizieren, dürfte die Philosophie hingegen alles Spielerische verloren haben und zum beruflichen Alltag verkommen sein. Auch die erwähnte These Plessners, wonach der Mensch in der Übernahme gesellschaftlicher Rollen ein spielender Mensch ist, ergibt nur Sinn, wenn man sie vor dem Hintergrund des Kontrasts von Gemeinschaft und Gesellschaft versteht. Gemeinschaften, wie etwa die Familie, basieren nach Plessner darauf, dass sich Individuen ihnen gegenüber ganz öffnen und sich rückhaltlos in sie integrieren. Die Gesellschaft hingegen beruhe auf dem Wechselspiel von Zurückhaltung und Begegnung: Der Einzelne trete hier nicht als Individuum, sondern als Person im Sinne des lateinischen »persona«auf, das heißt als Maskenträger oder Rollenspieler. Im Gegensatz zum unerbittlichen Ernst der Gemeinschaft habe der gesellschaftliche Umgang der Menschen miteinander, der durch allerlei Konventionen vermittelt ist, etwas distanziert Spielerisches.[20]
Hat man verstanden, dass der Begriff des Spiels auf einem Kontrast zu etwas Nicht-Spielerischem beruht, lässt sich auch erklären, warum wir darüber ins Grübeln geraten, ob ein Profifußballer eigentlich noch in dem Sinne spielt, wie es das Kind auf dem Bolzplatz tut. Für das Kind ist Fußball ein Ausstieg aus dem Alltag und damit Spiel, für den Profikicker ist Fußball beruflicher Alltag. Die Grenzen zwischen Spiel und Nicht-Spiel verschwimmen in seinem Fall ebenso wie beim Schachgroßmeister oder beim Pro-Gamer, der seinen Lebensunterhalt mit Computerspielen verdient.
Wenn der Begriff des Spiels immer nur im Kontrast zum Nicht-Spielerischen, der Notwendigkeit der Natur oder des Alltags, bestimmt ist, dann müssen wir einsehen, dass eine Definition ohne Zirkelschluss unmöglich ist. Denn den Begriff des Spiels mithilfe des Begriffs des Nicht-Spiels zu bestimmen, bedeutet eben, den Spielbegriff schon vorauszusetzen. Das sollten wir aber nicht als Scheitern auffassen. Denn es ist das Zeichen echter Grundbegriffe oder, philosophisch gesprochen, Kategorien, dass sie sich einer zirkelfreien Definition entziehen. Kategorien wie Wahrheit, Sein, Kausalität, Zeit oder Leben lassen sich nicht im strengen Sinne definieren, weil sie die fundamentalen Sinneinheiten unseres Denkens sind und als solche auch unsere gesamte Lebensform von Grund auf prägen. In diesem Sinne ist auch das Spiel, mit Huizinga gesprochen, eine »unbedingt primäre Lebenskategorie«.[21]
Das heißt aber nicht, dass all die geistige Arbeit in diesem Kapitel umsonst gewesen wäre. Denn zum einen ist die Tatsache, dass der Begriff des Spiels wegen seines fundamentalen Charakters nicht ohne Zirkel definierbar ist, keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Erkenntnis, die erarbeitet werden musste. Zum anderen können Kategorien zwar nicht im strengen Sinne definiert, dafür aber sehr wohl sinnvoll erläutert werden. Den ersten großen Schritt in diese Richtung haben wir bereits getan, indem wir das Spiel als eine überflüssige Tätigkeit, die ihren Sinn in sich selbst hat und die im Kontrast zu einer nicht-spielerischen Normalität steht, bestimmt haben. Diese allgemeine Charakterisierung lässt sich nun durch die Angabe weiterer zentraler Kennzeichen konkretisieren.
Kennzeichen des Spiels
Zum Glück müssen wir bei der Suche nach weiteren Charakteristika des Spiels das Rad nicht neu erfinden. Neben Johan Huizinga hat auch der schon erwähnte französische Soziologe und Philosoph Roger Caillois in seinem Buch Die Spiele und die Menschen aus dem Jahr 1958 eine Liste formaler Kennzeichen erarbeitet.[1]
Führt man die Überlegungen dieser beiden Denker zusammen und beseitigt dabei einige kleinere Ungereimtheiten und Schwächen, dann ergeben sich sechs zentrale Merkmale des Spiels, die wir uns der Reihe nach vor Augen führen wollen. Sie lauten: 1. Selbstzweckhaftigkeit, 2. Haltung des ernsten Unernstes, 3. Begrenztheit, 4. Freiheit, 5. Ungewissheit, 6. Regelhaftigkeit und Fiktionalität.
1. Selbstzweckhaftigkeit
Die Selbstzweckhaftigkeit des Spiels haben wir bereits im Rahmen unserer allgemeinen Bestimmung festgehalten. Der Spielcharakter eines Spiels lässt sich nicht erfassen, wenn man es als ein Werkzeug versteht, das fremden Zwecken dient. Stattdessen ist das Spiel eine Tätigkeit, die ihren Zweck, und damit ihren Sinn, in sich selbst hat. Wir spielen immer auch um des Spielens willen, und wo wir dies nicht tun, spielen wir nicht.
Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass Spiele auch durchaus nützlich sein können. In erster Linie taugen Spiele natürlich wunderbar zum Zeitvertreib. Das ist aber nicht alles. George Herbert Mead, Philosoph und einer der Gründungsväter der Sozialpsychologie, hat in seinen 1934 posthum unter dem Titel Mind, Self and Society (dt. Geist, Identität und Gesellschaft) erschienenen Vorlesungen dargelegt, wie gerade das Spiel einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass Kinder ein stabiles Selbst ausbilden. Ein Selbst zu sein beinhaltet nämlich die Fähigkeit, sich selbst gewissermaßen von außen betrachten zu können. Es setzt daher immer die Fähigkeit zur Selbstdistanz voraus – und diese Selbstdistanz lernt das Kind nach Mead auf vorzügliche Weise durch das Spielen. Zunächst geschieht dies im freien Spiel (engl. play), wenn das Kind in die Rolle anderer schlüpft und so tut, als sei es ein Elternteil, Lehrer oder Arzt. Im Rahmen des organisierten Spiels (engl. game) kommt dann noch die Fähigkeit hinzu, die eigene Rolle in Koordination mit einem ganzen Geflecht weiterer Rollen und den dazugehörigen Verhaltensregeln zu übernehmen. Spiele verkörpern damit auf exemplarische Weise den sozialen Gesamtprozess, der die Existenz von Personen mit einem stabilen und vielschichtigen Selbst ermöglicht.[1]
Neben dieser persönlichkeitsbildenden Funktion können Spiele auch noch in anderer Hinsicht von pädagogischem Nutzen sein: Von der Feinmotorik über das logische Denken bis hin zum strategischen Planen – mit den (richtigen) Spielen lassen sich zentrale menschliche Fähigkeiten einüben. Darüber hinaus können Spiele auch inhaltliches Wissen vermitteln. Neben traditionellen Quizspielen sind hier insbesondere die sogenannten Serious Games aus der Welt der Computerspiele zu nennen, die auch ernste Zwecke verfolgen und mit denen man etwa historische oder ökonomische Zusammenhänge auf spielerische Weise erlernen kann. Das Spiel kann also auf profunde Weise nützlich sein. Jeder Nutzen des Spiels ist und bleibt aber immer nur eine unwesentliche Dreingabe.
Das gilt übrigens auch für Wett- und Glücksspiele.[2] Zwar gehört die Hoffnung auf einen materiellen Gewinn zweifelsfrei zum Reiz dieser Spiele. Der eigentümliche Nervenkitzel besteht aber darin, nicht sicher zu wissen, ob am Ende ein Gewinn oder Verlust herauskommt. Ja, der Gewinn ist sogar außerordentlich selten, wie jeder Spieler weiß. Rationales Nutzendenken wird daher von derlei Spielen kategorisch abraten. Ins Casino geht man in Wahrheit nicht, um Geld zu gewinnen, sondern um Geld (oder Zeit) zu verlieren. Die Möglichkeit des Nutzens, die Hoffnung auf den großen Gewinn, die Vorstellung schicksalhaft zugeteilten Reichtums – das alles gehört zum Wesen bestimmter Wett- und Glücksspiele. All das ändert aber nichts daran, dass das Wett- und Glücksspiel letztlich um seiner selbst willen gespielt wird.
2. Haltung des ernsten Unernstes
Das Spiel verlangt dem Spieler eine geradezu paradoxe Haltung ab. Er muss das Spiel nämlich sowohl ernst als auch nicht ernst nehmen. Ernst und Unernst müssen vom Spieler in einer spannungsvollen Einheit zusammengehalten werden. Wer spielt, betreibt gewissermaßen Unernstes auf ernste Weise. Der Spieler weiß zum einen um die Überflüssigkeit des Spiels: Was er da tut, ist nicht wirklich wichtig; es gehört nicht zum gewöhnlichen Ernst des Lebens; es steht außerhalb der Notwendigkeiten des Alltags. Zugleich aber muss er dieses Bewusstsein von der Belanglosigkeit des Spiels ausblenden und eine Haltung der Ernsthaftigkeit einnehmen. Denn nur wenn er die Ziele und Regeln des Spiels temporär als die seinen akzeptiert und dadurch ernst nimmt, wird er überhaupt spielen. Wer bei einem Spiel nur nach außen hin dabei ist und die Regeln partout nicht ernst nimmt, ist ein Spielverderber: Er »zerbricht«, wie Huizinga treffend schreibt, »die Zauberwelt« des Spiels.[1]
So wichtig der Ernst für das Spiel auch ist, darf er sich doch nicht verselbstständigen. Andernfalls wird aus spielerischem Unernst spielfeindlicher Ernst. Auch der krankhaft verbissene Spieler kann das Spiel verderben. Diese Erfahrung wird jeder gemacht haben, der schon einmal mit einem schlechten Verlierer zu tun hatte – oder gar selbst einer gewesen ist.
Wie schwierig es zuweilen sein kann, dem Spiel mit der ihm angemessenen Form des Ernstes zu begegnen, zeigt eine Anekdote, die mir eine Studentin im Rahmen eines Seminars zur Philosophie des Spiels erzählte: Ihre Eltern hätten sich bei einer Partie Monopoly