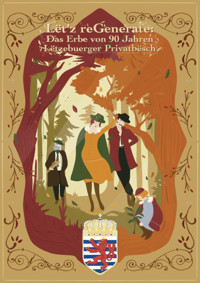
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schon immer haben Menschen mit dem Wald interagiert. Die dichten Wälder Mitteleuropas dienten bereits den Kelten und Germanen zu Urzeiten als Vorratskammer, Rückzugsort und Schauplatz mystischer Erzählungen. Mit der Sesshaftwerdung der Menschen hielten die Ackerbauwirtschaft und später die Industrialisierung Einzug in Europas Wälder, riesige Flächen wurden gerodet und teilweise vernichtet. An anderer Stelle hauchte der Mensch den Wäldern mit geschickter Bewirtschaftung neues Leben ein, sodass sie der Natur und ihren Bewohnern erneut Ressourcen, Kraft und Gesundheit spenden konnten. Seit 1933 vertritt der Lëtzeburger Privatbësch die Interessen der Waldbesitzer Luxemburgs, zu denen eine faire, nachhaltige und gesunde Bewirtschaftung der Familienwälder im Großherzogtum gehört. In diesem Buch finden Sie nie zuvor gesehenes Archivmaterial: Fundstücke aus dem Staatsarchiv des Großherzogtums, sowie persönliche Gespräche, bisher unveröffentlichte Privatarchive von historischen Persönlichkeiten; aber auch Texte von Reden, private Fotos und handgeschriebene Briefe werden präsentiert. Zur Feier seines 90-jährigen Bestehens illustriert Salvatore Coppola-Finegan in enger Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern, was es bedeutet, den Wald in Zeiten des Klimawandels und einer stärkeren Rückbesinnung auf die Natur zu schützen, zu pflegen und zu bewirtschaften. Dieses Buch ist der bunten Geschichte des Luxemburger Waldes gewidmet, sowie all jenen, die ihn schützten, pflegten und von ihm lebten. Von den Wirren der Nachkriegszeit über die kriegswirtschaftliche Ausbeutung durch die deutsche Besatzung bis hin zum plötzlichen Wertverlust des Waldes im Zuge der Globalisierung und seiner Neuentdeckung heute durchliefen der Wald und seine Besitzer eine teils spannende, teils tragische und immer auch hoffnungsspendende Geschichte, nämlich die des Großherzogtums Luxemburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LËT'Z REGENERATE:
DAS ERBE VON 90 JAHREN
LËTZEBUERGER PRIVATBËSCH
SALVATORE COPPOLA-FINEGAN
IMPRESSUM
Titel
Lët'z reGenerate: Das Erbe von 90 Jahren Lëtzebuerger Privatbësch
Herausgeber:
Der Lëtzebuerger Privatbësch
Registriert unter Groupement des Sylviculteurs A.S.B.L.
2, Am Foumichterwee
L-9151 - Eschdorf
Großherzogtum Luxemburg
www.privatbesch.lu
Autor:
Salvatore Coppola-Finegan
ISBN:
978-2-9199638-9-8
Druck:
Imprimerie de l'Est
Gestaltung und Illustrationen:
Ecocitizen
© Salvatore Coppola-Finegan
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung in irgendeiner Form, bleiben vorbehalten und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der Urheber übertragen, kopiert oder vervielfältigt werden.
To my beloved children Lucrezia V. M., Angelo N. J. T., and Pádraic F. M. G.
Vorwort der Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung
© SIP / Yves Kortum
Seit nunmehr 90 Jahren arbeitet das Groupement des Sylviculteurs, heute ebenso als Lëtzebuerger Privatbësch bekannt, für die Gesundung und Pflege von Luxemburgs Wäldern. In seiner ereignisreichen Geschichte wuchs er von einer kleinen Vereinigung von Waldbesitzer:innen zu einem wichtigen zivilgesellschaftlichen Partner heran. Immerhin stellen die Wälder in Privatbesitz über 50 % der Gesamtwaldfläche Luxemburgs. Als Vertreter jener Waldbesitzer:innen schützte der Lëtzebuerger Privatbësch nicht nur die Wälder, sondern auch das Recht der Menschen auf Privateigentum, und funktionierte in Zusammenarbeit mit der Natur- und Forstverwaltung als verlängerter Arm bei der Umsetzung der diesbezüglichen Gesetze und Strategien Luxemburgs. So trägt die Institution des Lëtzebuerger Privatbësch maßgeblich zum Erhalt und zum Schutz der Luxemburger Natur bei. Ich bin sehr dankbar, mit ihr einen professionellen Partner zu haben, der sich aktiv in die dringenden Diskussionen unserer Zeit einbringt und dabei nie das Wohl von Mensch und Umwelt aus den Augen verliert.
Angesichts der aktuellen Krisen im Bereich der Umwelt sind die Bedürfnisse der Wälder sowie der dort vorhandenen Artenvielfalt enorm gestiegen. Die Ökosysteme der Wälder und deren Dienstleistungen müssen heute mehr geschützt werden denn je. Gleichzeitig erhoffen wir uns von ihnen nachhaltige Rohstoffe und wollen in ihnen auch einen Platz für Mensch und Natur wissen, in dem ein glückliches Zusammenleben zwischen Waldbesitzer:innen und –nutzenden möglich wird. Diese Naturräume, die 35 % der Luxemburger Landesfläche ausmachen, sollen heute vielfältige Funktionen erfüllen, die weit über die früher dominierende forstliche oder industrielle Nutzung als Holzlieferant hinausgehen. Der Luxemburger Wald spielt deshalb eine vielfältige Rolle: Er dient dem Bodenschutz, versorgt uns mit sauberer Luft und Wasser und speichert Kohlenstoff im Holz und im Waldboden.
Angesichts der vielen neuen Herausforderungen im Umweltschutz müssen wir kollaborativ, vorausschauend und zielorientiert handeln. Der Lëtzebuerger Privatbësch bewies ebendiese Dynamik und Aufgeschlossenheit etwa nach dem verheerenden Orkan Wiebke, der weite Waldflächen des Landes zerstörte. Die Mitglieder des Privatbëschs halfen bei der Aufarbeitung der Sturmschäden und unterstützten die Aufforstung ideell und tatkräftig. Diese Art des zivilgesellschaftlichen Engagements müssen wir schätzen und fördern, im Interesse der Wald-Ökosysteme und deren Dienstleistungen. Für heutige und auch für zukünftige Generationen. Deshalb möchte ich den Mitglieder:innen und Mitarbeitern des Lëtzebuerger Privatbëschs meine herzlichsten Glückwünsche zu ihrem 90-jährigen Bestehen aussprechen. Ich wünsche Ihnen für die kommenden Jahre viel Motivation und Erfolg, und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit.
Joëlle Welfring Ministerin für Umwelt Klima und nachhaltige Entwicklung Die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
Vorwort des Präsidenten
Liebe Waldbesitzer, liebe Freunde des Waldes, wir feiern dieses Jahr das 90. Jubiläum unseres Vereins – welch ein schönes Event!
Den Gründungsmitgliedern der Vereinigung war es schon im Jahr 1933 wichtig, die Forstwirtschaft auf den richtigen Weg zu bringen, das private Eigentum zu schützen und sich für eine nachhaltige Bewirtschaftung einzusetzen. Dies hat sich im Grundsatz bis ins Jahr 2023 nicht geändert.
Natürlich hat es Veränderungen gegeben. Einmal hat sich der Wald in seiner Baumarten-Zusammensetzung verändert, insbesondere sind es aber die Ansprüche der Gesellschaft im heutigen Millennium, die nicht mehr mit denen aus dem Beginn des vergangenen Jahrhundert zu vergleichen sind.
Bedingt durch industrielle Übernutzungen musste der Wald zunächst wieder aufgebaut werden. Es folgen zwei verheerende Kriege, nach welchen die Nachfrage nach Holz in die Höhe schnellte, um den Wiederaufbau Europas zu ermöglichen. Jagd und Erholung waren für unsere Vorfahren natürlich auch schon wichtig.
Nach dem Wiederaufbau Europas, also in der letzten Waldgeneration, haben sich die Ansprüche der Gesellschaft rasant verändert, indem sie mehr und mehr „ihren“ Wald in den Blickpunkt nahm. In den 1980-er Jahren ging erstmals das Waldsterben durch die Presse – erste Anzeichen des Klimawandels, oder doch nur die Schuld der schlechten Filteranlagen der Industrie?
In jedem Fall geriet der Wald immer mehr ins Rampenlicht der breiten Öffentlichkeit, der er heute mehr denn je mit diversen Ökosystemdienstleitungen große ökologische wie soziale Dienste leistet. So ist er Garant für die Lieferung von Sauerstoff, die Fixierung von CO2, Lieferung von Wasser und die Filterung von Feinstaub, er ist unentbehrlicher Lebensraum für Flora und Fauna, und natürlich dient er auch weiterhin der Erholung der Bevölkerung und ist somit als „gemeines Gut“ nicht mehr wegzudenken. Öffentlich weniger ausgesprochen, aber dennoch wichtig, darf die ökonomische Funktion des privaten Waldes nicht verloren gehen, denn ohne diese kann der Mensch nicht leben!
Die praktischen Probleme der heutigen Waldbewirtschaftung sind vielfältig: Welche Baumarten sind dem Klimawandel gewachsen? Wie pflanze ich diese? Wie sichern wir eine Naturverjüngung in Kleinprivatwäldern? Und wie können wir all die kleinen, heranwachsenden Bäume vor dem Wildverbiss schützen? Diese Problematiken sind so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen!
Natürlich entwickelte sich auch die Vereinigung aus einem Club von ehrenamtlichen Waldfreunden, auf die auch heute noch gesetzt werden kann. Es entstand zusätzlich eine wichtige professionelle Beratungsstelle mit derzeit vier Forstfachleuten, die die Waldbesitzer in den verschiedensten Anliegen beraten und bei der Waldbewirtschaftung unterstützen. Die öffentliche Hand hat die Bedeutung des privaten Beratungssystems erkannt und kofinanziert die Vereinigung.
Wir sind froh und dankbar, dass wir Herrn Salvatore Coppola-Finegan gefunden haben und ihn beauftragen konnten, die Geschichte unseres Vereins zu recherchieren und in diesem Buch darzustellen. Ursprünglich studierter Historiker mit Masterabschluss der University of St. Andrews, dann beruflicher Experte mit weiteren Studien in Umwelt und Nachhaltigkeit, forscht er auch an der Universität Luxemburg über regenerative, sozio-ökologische Systeme.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!
Hubert de Schorlemer Präsident, Groupement des Sylviculteurs
Danksagung
Mein besonderer Dank gilt dem Groupement des Sylviculteurs, dem Lëtzebuerger Privatbësch. Ohne sein Vertrauen und sein Mitwirken wäre dieses Buch niemals entstanden.
Ganz besonders danke ich Winfried VON LOË und Hubert DE SCHORLEMER.
Für Ihre Geduld, Weisheit und Ermutigung danke ich allen Gesprächspartnern sehr herzlich. Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, Sie kennenzulernen und Ihre Erzählungen persönlich hören zu dürfen. Ich hoffe nur, dass ich Ihren Geschichten gerecht wurde.
Ich danke dem ehemaligen Staatssekretär, Minister und EU-Kommissar René STEICHEN für den Empfang und das Teilen seiner einzigartigen Perspektive.
Dem Förster und Historiker Jos HELBACH danke ich für seine Werke, die diese Geschichte inspiriert und informiert haben, sowie für die sehr fruchtbaren und angenehmen persönlichen Gespräche mit ihm in Grosbous.
Charles KROMBACH danke ich für die Idee, „die Geschichte vom Wald“ als Einleitung zur Geschichte des Vereins zu recherchieren und zu verfassen. Ich danke ihm auch für die konkreten Wegweiser, die er großzügig zur Verfügung gestellt hat, und für seinen ergänzenden interessanten Vortrag zu einer Vielzahl von damit zusammenhängenden Themen.
Ich bedanke mich bei Jos CROCHET für das Teilen seiner Lebensgeschichte mit mir, für die Einsicht in sein privates Archiv und für seine einzigartige Perspektive.
Ich danke Raymond BEFFORT für seine Freundlichkeit, die reichhaltigen Gespräche und für seine Kontaktvorschläge.
Henri WURTH danke ich für das interessante und weitreichend informative Gespräch sowie seine Kontaktvorschläge.
Ich danke Jos STROTZ und Jules HOLLERICH für den Empfang und die einzigartigen Einweisungen in die regionalen Facetten des Themas sowie in das Kulturerbe.
Ich bin dankbar, dass mein Epilog durch einen herrlichen Waldspaziergang mit Patrick LOSCH sowie durch sehr angenehme Gespräche mit sechs jungen, optimistischen Schülern der LTA Gildorf verbessert, kontextualisiert und insgesamt sehr bereichert werden konnte.
Ich danke Gaston FOHL für seine lebhaften Erinnerungen und seine Hilfe beim Aufspüren einer Fotografie von Gustave SINNER.
Ich danke Natalie HUFNAGL-JOVY für die Details über die wegweisende Rolle, die die Leiter des Vereins seinerzeit beim Aufbau internationaler Netzwerke gespielt haben.
Ich danke Fanny-Pomme LANGUE, Generalsekretärin der CEPF, für die Auskünfte über die engagierte und menschliche Leitung von Hubert de Schorlemer als Präsident der Konföderation.
Im Staatsarchiv möchte ich Pit EVEN und seinem stets höflichen und hilfsbereiten Team vom Service Accueil sowie den Konservatoren Gilles REGENER, Corinne SCHROEDER und Nicky BLAZEJEWSKI für ihre Unterstützung danken. Zusätzlich danke ich den zahlreichen Akteuren, die oft im Hintergrund agieren, um unser gemeinsames Erbe zu entdecken, zu retten, zu restaurieren, zu bewahren und für künftige Generationen zu sichern.
Bei der Nationalbibliothéik bedanke ich mich sehr bei Pascal NICOLAY, Christian SCHAEFFER und Tona PETERS.
Ebenso bedanke ich mich bei Bernhard SCHMITT, Diözesanarchiv Luxemburg; Ariane KÖNIG, Universität Luxemburg; Martine NEUBERG, Administration de la Nature et des Forêts; Philippe VICTOR, Musée National d'Histoire Militaire; Marie-France GINDT, Conseil d'Etat; Christine MAYR, Chambre des Députés; Emile LUTGEN, Wiltz; Robert L. PHILIPPART, Ministère de la Culture; Daniela LIEB & Myriam SUNNEN, Centre national de littérature, Mersch; Elvire GEIBEN, Les Amis des Musées d'art et d'histoire; Virginie DELLENBACH, Casino Luxembourg; Antoine LEJEUNE, L'Agence luxembourgeoise d'action Culturelle; Julie RODRIGUES, Ville de Luxembourg; Tom SCHOLTES, Cercle d'Études sur la Bataille des Ardennes; Emile ESPEN, POST Philately; Nicolas MALGET, Wiltz; Georges KEIPES, Clerf; Paul BLESER, Bascharage; Nora HERMES, Wiltz; dem Personal am Helpdesk des Luxembourg Business Registers; und dem Personal von Info-Legilux, Service Central de Legislation.
Für ihren Elan, ihre Motivation und ihren Glauben an eine bessere Welt danke ich den jungen Gesprächspartnern am Lycée Technique Agricole in Gilsdorf: Laura LUCIUS, Anna GARLINSKAS, Lea BARTZ, Lex HECK, Gregory KNEPPER, und Tim THIELEN.
Ich danke den Künstlern Asta KULIKAUSKAITE-KRIVICKIENE und Jean-Marie BIWER für die Erlaubnis, ihre Werke als Bildmaterial verwenden zu dürfen.
Für ihre geistliche Betreuung danke ich Pater Michael CUSACK, der als Pfarrer der Pfarrei „Lëtzebuerg Notre-Dame" für die Seelsorge der internationalen anglophonen Gemeinden der Erzdiözese verantwortlich ist, sowie seinem Vorgänger Pater Edward HONE.
Nicht zuletzt danke ich meiner Frau Adriana für ihre Liebe, Geduld und absolute Unterstützung auf unserem gemeinsamen Weg; meinen Eltern und Großeltern, und natürlich meinen Kindern, die mir den wahren Sinn des Lebens geben.
Vorwort des Autors
Diese bescheidene Geschichte möchte in erster Linie einen aufrichtigen Beitrag zur Bewahrung des historischen Gedächtnisses des Vereins der Luxemburger Privatwaldbesitzer und allgemein des Privatwaldes vorstellen.
Inspiriert und informiert wurde dieses Werk durch Gespräche, Material aus dem Staatsarchiv des Großherzogtums Luxemburg sowie dem deutschen Bundesarchiv, Zeitungsausschnitte, vorhandene Literatur, dem Stand der Wissenschaft der Nachhaltigkeit, insbesondere in Bereich der regenerativen sozial-ökologischen Systeme, sowie die persönlichen Erfahrungen des Autors in diesem Bereich.
Der Autor ist sich bewusst, dass nicht alle Fragen, die sich zu den in diesem Werk erwähnten Themen stellen könnten, beantwortet sind. Dem Autor ist auch schmerzlich bewusst, dass es noch unzählige weitere Geschichten über die sehr vielen anderen Mitglieder des Vereins aus den letzten 90 Jahren zu erforschen und zu erzählen gibt. Der Autor bittet daher um Entschuldigung für alle Auslassungen und übernimmt allein die Verantwortung für eventuelle Fehler.
Um die Lektüre hoffentlich zu erleichtern, wurde der Referenzstil MHRA bevorzugt, der nur einen kurzen Verweis auf der Seite ermöglicht, zusammen mit einem entsprechend vollständigen bibliographischen Index am Ende des Buches.
Salvatore J.M. Coppola-Finegan Stroossen, 2023
INHALTSVERZEICHNIS
Prolog : Die Geschichte vom Wald
Vorgeschichte des Waldes im Raum Luxemburg
Die Zeit des Buchdrucks und Entstehung eines Rechtssystems
Der Einmarsch Napoleons und die weitere Verstaatlichung des Waldes
Die Einführung der Eisenbahn und die Industrialisierung Luxemburgs
Erdöl und Strom als Entlastungsfaktoren des Waldes
Das 20. Jahrhundert und der Wald im Wandel
Wertverlust und Prestigegewinn des Waldes
Die Natur in Bewegung — Ein Ausblick
Forêts luxembourgeoises
Privater Waldbesitz in Luxemburg vor 1933
Die Vorgeschichte des Luxemburger Waldes
Privatwaldbesitz im Luxemburg der Antike und des frühen Mittelalters
Luxemburgs Wälder in der frühen Neuzeit
Gesetze gegen die Ausbeutung von Privatwäldern
Der freie Wald wird zum Politikum
Die Entrindung: Ein uraltes Handwerk
Der Niedergang der Gerbereien in Wiltz
Der Deutsche Forstverein in Straßburg und die Idee für ein Luxemburger Pendant
Graf Lamoral de Villers und die Gründung der Société Forestiére du Grand Duché
Die „Gründung einer Waldgenossenschaft“
Der Forstverein im Schatten des langen 19. Jahrhunderts
Nach der Gründung: Luxemburgs Forstverein und seine erste Veranstaltung
L‘Administration de la Nature et des Forêts im Dienst an Mensch und Natur
Etablierung und politische Aktivität
Internationale Forstkongresse und der Luxemburger Forstverein
Der Kongress der IUFRO in Ungarn 1936
Die Einladung des Forstvereins nach Helsinki
Die Internationale Forstzentrale in Berlin: Ein Hoffnungsschimmer für Europa?
Mir wölle bleiwe wat mir sin: Luxemburg Unabhängigkeitsfeier 1939
Der Luxemburger Forstverein vor und während des Zweiten Weltkriegs
1933-1939: Luxemburg vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
Ein Krieg bahnt sich an
Der deutsche Einmarsch in Luxemburg
Die Deutschen Verordnungen für Luxemburg
Der Wald im nationalsozialistischen Weltbild
Widerstand im Wald: Resistenz zu Lëtzebuerg
Der Untergang der Zivilverwaltung Luxemburgs
Die Wiederbelebung des Forstvereins 1947 bis 1965
Luxemburger Privatwaldbesitz nach dem Zweiten Weltkrieg
1947: Der Forstverein wird zum Groupement des Sylviculteurs
Eine große Gemeinschaft führt den Verein in die Zukunft
Baron Ludwig und Ludolf de Schorlemer
Die erste publizistische Meldung des Groupement des Sylviculteurs
Ein schwieriger Anfang und die „Wiederbelebung“ im Jahr 1952
Eine Familie von Waldbesitzern wächst zusammen
Der Aufstieg in den Jahren 1965-1979
Théodore Simon — ein Friedensrichter für den Verein
1964: Die Aussicht auf eine Zellstofffabrik
Die letzten Kriegsschäden werden behoben
In memoriam Georges Faber, 28.04.1967
„Dem Privatwald muß finanziell geholfen werden“
Annette Schwall-Lacroix — Luxemburgs Erste Frau Im Staatsrat
Ein neuer Präsident: Jos Crochet schreibt einen Brief an Baron Ludolf de Schorlemer
Abschied des Forstdirektor Emile Gillens am 04.04.1977
Die frühe Popularisierung des Umweltschutzes und der Forstverein 1979-1990
Das Element Holz im späten 20. Jahrhundert
1983: Der Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen
Der Orkan Wiebke und der Forstverein
Impulse des Service Techniques und die Beratung von Waldbesitzern
Parlamentswahlen und die Ernennung René Steichens zum Ackerbauminister
Der Umweltschutz und das Privatwaldeigentum
Kreativität, Innovation und Engagement
Die Zertifizierung der Wälder nach PEFC
Lobbying in Brüssel – eine Gefahr für die Privatwaldbesitzer?
Globales Engagement der Waldbesitzer Luxemburgs
Die CEPF — eine Konföderation für Europas Waldbesitzer
Gründung der IFFA, einer internationalen Allianz für Familienforstwirtschaft
Einladung zur Teilnahme am Forests Dialogue
Regionale Vereinsgründungen des Groupement des Sylviculteurs
Der Bëschdag 2006 zu Vaux-Sur-Sûre
Traditionsreiche Techniken im Bëschverain Wiltz
Einführung der Zertifizierung nach PEFC
2008: Die Ausrichtung des Vereins hin zu mehr Landwirtschaft
Klimabonusbësch und die gesellschaftliche Wertschätzung von Wäldern und Waldbesitzern
Abschied von Baron Ludolf de Schorlemer
Das Groupement des Sylviculteurs bis heute: eine Erfolgsgeschichte
Lët‘z reGenerate — Waldbesitzer für Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Wildschäden im Wald
Ein breites, zeitgemäßes soziales Engagement
De Privatbësch Hëlleft
Epilog
Éislek 2113 A.D.
Annex : Gesichter des Lëtzebuerger Privatbëschs
Vorstand und Verwaltungsrat
Hubert de Schorlemer
Henri Wurth
Patrick Losch
Jean Steffen
Maurice Probst
Venant Krier
Felix Faber
Georges Plumer
Jeannot Erpelding
Marie Kayser
Vic Mousel
Jemp Schmitz
Weitere Gesprächspartner
René Steichen
Jos Crochet
Jos Helbach
Charles Krombach
Raymond Beffort
Jules Hollerich
Jos Strotz
Lëtzebuerger Privatbësch – Das Team
Jörg Müller
Michel Dostert
Rothe Aaron
Winfried von Loë
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Zeitschriften
Zeitungsartikel
Unterlagen
Online-Inhalt
Gespräche
Audiovisuell
Abbildungsverzeichnis
Über den Autor
A Forest (n°2), Jean-Marie Biwer, 2022
Prolog
Die Geschichte vom Wald
„Höchstwahrscheinlich sind wir immer noch in Eden. Nur unsere Augen haben sich geändert.“
G.K. Chesterton
Vorgeschichte des Waldes im Raum Luxemburg
Der Wald war lange Zeit ein von Menschen genutzter Wildwuchs. Bis ins frühe Mittelalter wurde er punktuell gerodet, von Köhlern zum Schwelen verwendet und als Vorratskammer der Dörfer genutzt. Hier fand man Beeren, Wildbret, Holz, Gemüse, Kräuter und weitere Pflanzen, die unterschiedlichste Zwecke erfüllten. Für eine lange Zeit richteten die Menschen ihr Leben nach dem Wald aus. Im Norden Europas entstanden Dörfer in der Nähe großer Wälder, die genutzt und abgeholzt wurden. Entstand eine zu große Schneise, wurde das Dorf verlassen und an einer günstigeren Stelle wiederaufgebaut. So hatten die Wälder immer genügend Zeit, um nachzuwachsen. Doch im Zuge des technologischen Fortschritts und demographischer Übergänge wurde die gewaltige Waldmasse, welche bis zu 90 Prozent der Landfläche Europas bedeckt hatte, in großen Teilen gerodet. Sie musste dem Ackerbau und der Viehzucht weichen, die den Menschen eine sichere und konstante Nahrungsquelle boten.1
In vorchristlicher Zeit richteten sich Kelten, Megalithbauern und Germanen nach dem Wald aus und bauten ihre Dörfer immer in die Nähe von fruchtbaren, bewaldeten Böden. Waren diese nach einigen Generationen abgeholzt, wurde das Dorf oder die Wagenburg verlegt, sodass der genutzte Boden sich erholen konnte. Diese Form der Nutzung lies ein weitgehend ungestörtes Wachstum des Urwaldes zu, der stellenweise über 90 Prozent der Waldfläche Europas bedeckte.
Mit der Besetzung links- und rechtsrheinischer Gebiete und der Gründung von Städten wie Xanten, Trier, Köln und Mainz veränderten die Römer jedoch die Nutzung des Waldes. Nicht nur wurden erhebliche Mengen an Holz für den Bau von Städten und dem Grenzwall Limes abgeholzt. Auch wurden nährstoffreiche Böden im Limes eingeschlossen und Buchen- und Eichenwälder für den Feldbau und die Viehzucht abgeholzt. Nadelholz wurde ebenfalls in großen Mengen verwertet, um den Schiff- und Konstruktionsbau voranzutreiben. Neben dem intensiven Abbau führten die Römer allerdings auch lokal ausgestorbene Waldarten wie die Esskastanie im hohen Norden ein.
Die römische Waldnutzung war der erste Versuch, den mitteleuropäischen Wald im großen Maßstab planerisch zu nutzen und zu fördern. Doch die rein wirtschaftliche Nutzung des Holzes ließ keinen Raum zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder. Noch heute zeugen waldlose Wiesen nahe des Rheins von einer unachtsamen Rodung, von der sich große Flächen nicht wieder erholen sollten.2
Mit dem Ende des Römischen Reichs kehrte wieder die freie Waldnutzung zurück, die bis ins hohe Mittelalter kaum planerischen Regelungen unterlag. Waldbesitz war allerdings bis zum Entstehen staatlicher Strukturen keinen klaren Rechtsbestimmungen unterlegen. Wegelagerer bedrohten umherziehende Menschen und stürzende Bäume, wilde Tiere, tiefe Temperaturen im Winter und ausbrechende Feuer stellten eine Bedrohung für jeden dar, der sich hier aufhielt. Besitzansprüche wurden nicht schriftlich festgehalten, sondern mit Gewalt durchgesetzt.
So konnten schon früh Adlige ihren Besitzanspruch auf Wälder im Raum des heutigen Deutschlands, Frankreichs und Luxemburgs geltend machen, indem sie diesen mit Waffengewalt durchsetzten. Doch hier erwuchs eine neue Problematik: Der Wald wurde nicht eindeutig aufgeteilt und zahlreiche Fehden mussten ausgefochten werden, um Besitzverhältnisse zu klären.3
Die wechselhafte Geschichte des Waldbesitzes in Luxemburg kann als sozioökologische Erzählung verstanden werden, denn er hatte neben der ökologischen auch schon immer eine starke politische Komponente. So wird ermittelt, wie und warum sich der Wald als Spielball politischer und wirtschaftlicher Interessen zu einem derartig wichtigen Element der luxemburgischen Geschichte entwickeln konnte.
Die Zeit des Buchdrucks und Entstehung eines Rechtssystems
Mit dem Buchdruck erlebte die Schriftkultur in Europa einen enormen Auftrieb. So konnten Dokumente und Verträge Besitzverhältnisse festschreiben, sodass auch der Wald rechtlich bindend an einzelne Besitzer zugeteilt wurde. Nichtsdestotrotz wurden Waldflächen spontan für die freie Jagd, den Fischfang, das Köhlerhandwerk und für die noch junge Eisenindustrie ausgebeutet. Diese Praxis der Rodung erreichte schließlich unkontrollierbare Ausmaße, sodass der Wald geschützt werden musste. Schon hier kann von einer Tragik der Allmende gesprochen werden, nämlich dem Trend zur Ausbeutung knapper Ressourcen in einem sich ständig erhöhenden Tempo.4 In der Wirtschaftstheorie bezieht sich die Tragik der Allmende auf eine Situation, in der Personen mit Zugang zu einer öffentlichen Ressource (auch: Gemeingut) in ihrem eigenen Interesse handeln und dadurch letztendlich die Ressource erschöpfen.5
Mit der Renaissance begann auch die Bürokratisierung der Landbesitzungen.6 Es war nun einfacher, Besitzansprüche in Dokumenten festzuhalten und juristisch zu verfechten. Während das Mittelalter als Zeit des rudimentär ausgebildeten Rechtssystems gilt, trugen der Buchdruck und die allgemeine Staatswerdung zu einer verbindlichen Verteilung des Waldbesitzes bei. Waren es vormals die Stärksten, in der Regel also Adlige und Fürsten, die einen Großteil des Waldes an sich rissen, konnten nun Staat, Unternehmer und Privatleute, aber auch einfache Gemeinden, Wälder für sich beanspruchen. Hier gab es nicht selten Interessenskonflikte, da ein Bevölkerungsanstieg einerseits die Notwendigkeit der Nutzung gemeinschaftlicher Wälder erhöhte, andererseits ein intensiver Allmende-Raub betrieben wurde. So gilt der Raub gemeinschaftlicher Waldflächen durch weltliche Herrschaften als einer der Gründe für den Ausbruch des Bauernkrieges von 1524.7
Unter der Herrschaft Maria Theresias wurde die Ständegesellschaft sukzessive zurückgedrängt.8 Im Sinne des aufgeklärten Absolutismus und eines erstarkenden Staatswesens gingen große Teile des Luxemburger Waldes an die Habsburger Monarchie. Die Habsburger griffen durch und erließen im Jahr 1747 den Artikel über die rationelle Waldnutzung, also erste Bestimmungen darüber, wie mit den Ressourcen des Waldes umzugehen sei. Die Theresianische Wald- und Holzordnung sollte der willkürlichen Abholzung der Wälder zumindest in der Theorie ein Ende setzen.9
Fig. 3. Auszug aus: Waldordnung Maria Theresias von 1767
So gelang es, die Menge an Holzrodungen zu begrenzen. Auch die Verödung des Waldes durch unsinniges Abbrennen, zu frühen Austrieb des Viehs und das Köhlerhandwerk sollte durch eine konsequente Richtschnur beendet werden.10 Doch der Erlass zur Waldordnung war nicht nur restriktiver Natur: Auch wurde vorgesehen, dass Brennholz in Herren- und Gemeindewäldern den Bürgern gehören solle, wobei nur so viel Holz auszugeben sei, wie es in den städtischen Vorschriften festgelegt wurde. Diese Reformen trugen maßgeblich dazu bei, dass der Wald geschützt und die wirtschaftliche und private Nutzung des Ökosystems rationiert wurde.11
In diesem Kontext veränderte sich auch die mitteleuropäische Gesellschaftsstruktur. Anstatt dynastischer Adelsfamilien traten Großindustrielle in den Vordergrund, die zwar auch enge Familienbande nutzten, aber in erster Linie ihre Macht mit mutigen Investitionen und Unternehmungen ausbauten. So waren Großfamilien wie Hanel, Falck, später Krupp und im Raum des heutigen Luxemburgs insbesondere de Wendel aktiv. Der Offizier Jean-Martin de Wendel kaufte um 1704 die Seigneurie von Hayange im heutigen Lothringen, auf dem die Familie ihr Schloss erbauen und bedeutende Aktivitäten in der Stahlindustrie und später im Bergbau organisieren sollte.12 Waldbesitz und -nutzung bildeten die Grundlage für den Erfolg der großindustriellen Familie de Wendel.13
Dieser Wandel wurde auch in den Theresianischen Katastern zum Ausdruck gebracht. Für den deutschen Teil Luxemburgs, der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in österreichischer Hand lag, verkündete Marie Theresia um 1747 herum die Trennung von bäuerlich und herrschaftlich bewirtschafteten Ländereien. Die Trennung von Rustikalland und Dominikalland hatte eine steuerliche Rektifikation zur Folge. Ziel war es, die Steuerpflicht gerechter aufzuteilen, sodass nicht nur die Bauern auf sie abgewälzte Steuern, sondern auch Grundherren klare Sätze zahlen mussten. Auch wenn die Einteilung der Kataster gemeinhin als gescheitert gilt, war diese Einteilung ein progressiver Vorstoß hin zu einer rationalen und egalitären Landespolitik, in der dem Wald und dem Land klar nachvollziehbare Werte zugemessen wurden.14
„Der Wald hat früher der Reichsabtei St. Maximin gehört. Dann hat Napoleon jeder Gemeinde so viel Wald zugeführt, dass die Leute genügend Brennholz hatten. Auch wurde der Wald als Hutewald genutzt, in den man das Vieh eintreiben konnte. Die Leute nahmen auch Blätter und Streu für ihre Zwecke mit. Das führte aber natürlich dazu, dass die Wälder ausgebeutet wurden.“
Henri Wurth
Der Einmarsch Napoleons und die weitere Verstaatlichung des Waldes
Mit der auf Reformen und Modernisierung abzielenden Herrschaft Napoleon Bonapartes wurde die Rationierung des Waldbesitzes weiter vorangetrieben. Die formale Abschaffung der Ständegesellschaft erlaubte die Vergabe des Waldes an die Gemeinden und Städte.15 Doch die Verteilung war nicht immer ausgeglichen, sodass etwa Holz nach Konfession unterschiedlich verteilt wurde, wie ein Beispiel aus Luxemburgs Wald zeigt: Hier bekam ein evangelischer Pfarrer deutlich mehr Holz zugesprochen als der katholische.16
Geändert wurde zudem das Erbrecht. Unter Napoleon wurde die Praxis eingeführt, das Erbe gleichmäßig zu verteilen.17 So bekamen Kinder von Waldbesitzern gleich große Teile des Waldes, was letztendlich zu einer Zersiedlung der Luxemburger Wälder führte.18 Vormals hatte die Erbpraxis darauf abgezielt, nur dem Erstgeborenen Besitztümer wie etwa Waldflächen zu vermachen. Durch den Code Napoléon waren viele Bauernbetriebe auf alle Erben verteilt worden, wodurch vormals große Betriebe einer gewissen Zerstücklung unterlagen. So schreibt ein gewisser P.C. im Luxemburger Wort im Jahr 1944:
„Dieses Erbrecht [des Code Napoléon], unter dem auch Luxemburg zur Zeit der französischen Herrschaft nach der großen Revolution von 1799 bis 1814 stand, war die Ursache dafür, dass 85 Prozent der französischen Bauernwirtschaften und, entsprechend auch der luxemburgischen, zu Kleinbetrieben geworden sind, denen es zum guten Teil an der notwendigen Ackernahrung fehlte. Das war auch der Grund dafür, weshalb manchen unsere Kleinbauern vor dem Kriege in bedrängter Lage nicht geholfen werden konnte. Es fehlte einfach an der notwendigen Nutzungsfläche.“19
Ein weiteres Problem stellte die stete Verschuldung der Gemeinden dar. So wurde das Holz nicht selten versteigert und der Wald an Privatleute verkauft, was wiederum eine Privatisierung und verstärkte Abholzung von Waldflächen zur Folge hatte. Nichtsdestotrotz wurde Holz in großen Mengen auch an Familien abgegeben, damit diese mit ihm heizen und kochen konnten.20
„Napoleon teilte den Wald und das Land unter seinen Generälen auf, die diese Flächen entweder weitervererbten oder an die Luxemburger Bevölkerung verkauften. So entstand der Privatwaldbesitz. Und es gab nun die Realteilung, das heißt, wenn jemand fünf Kinder hatte, dann wurde die Parzelle auf fünf Kinder aufgeteilt. So gab es immer mehr Privatwald- und Landbesitzer. Deshalb haben wir Kataster mit ganz vielen kleinen Streifen, Waldflächen, die manchmal nur zehn Meter breit und dafür hundert Meter lang sind.“
Henri Wurth
Die Einführung der Eisenbahn und die Industrialisierung Luxemburgs
Woher kommt der Reichtum Luxemburgs? Heute mögen es vielleicht die Banken sein, die die Wirtschaftsleistung des Landes vorantreiben. Doch von deutlich größerer Bedeutung war der Fund von Eisenerz im Süden Luxemburgs im 19. Jahrhundert. Diese großen Mengen des edlen Rohstoffs machten das Land reich. Der Wald wurde fortan als Vorratskammer für das Heizmittel Holz genutzt, das man in großen Mengen brauchte, um aus Eisenerz Stahl und schließlich Waffen sowie industrielle Gerätschaften zu gießen. Holz wurde in großen Mengen zur Kohlegewinnung eingesetzt, um schließlich die Anlagen zu beheizen. Diese Praxis führte zu einer Verknappung des Waldes, der schon für die stetig wachsende Bevölkerung zu Heizzwecken gerodet wurde. Auch der Häuserbau erforderte große Mengen an Holz, das den wichtigsten Baustoff darstellte.
Die Industrialisierung schien auf den ersten Blick also eine ernste Gefährdung für Europas Wälder zu sein, insbesondere in Luxemburg mit seiner aufstrebenden Stahl- und Eisenindustrie. Etwas Gutes hatte diese Wandlung allerdings, denn mit dem direkten Transport des Holzes in die Fabriken und der dortigen Verschwelung wurde das Köhlerhandwerk überflüssig, sodass dieses die Wälder nicht mehr massakrieren konnte. Hier spielte die Implementierung des Eisenbahnnetzes eine große Rolle, da es ermöglichte, Holz zügig vom Wald in die Fabriken zu befördern, um sie dort direkt zu verbrennen oder zu Kohle zu verarbeiten.21 So kann behauptet werden, dass die Produktion, der Transport und der effektive Einsatz von Kohle den Wald vor einer noch größeren Rodung und irreversiblen Schäden schützten.
Firmen wie Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED) stellten eine entscheidende Grundlage für den Reichtum Luxemburgs dar,22 beanspruchten jedoch für die Stahlindustrie und vor allem zur Manufaktur schwerer Waffen erhebliche Mengen an Holz. Doch so hoch der Holzverbrauch dieser Zeit in Luxemburg auch gewesen sein musste, so scheint er in rural geprägten Ländern noch viel höher gewesen zu sein. So schrumpfte der Waldbestand in Ländern wie Dänemark, der Ukraine, im Baltikum oder in Irland im besorgniserregenden Tempo, sodass bis heute dort nur kleine Wälder mit einem geringen Anteil an der Gesamtfläche vorzufinden sind.
Doch obwohl der Wald etwa in den Ardennen zu großen Teilen verschont blieb, stellten die wachsenden Anforderungen eine existenzielle Bedrohung für Mensch und Umwelt dar. Die Wälder wuchsen schließlich noch wild, Bäume ließen Sporen auf den Boden fallen, aus denen neue Bäume hervorgingen. Dieses ungeregelte Wachstum reichte nicht mehr aus, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. So erlebte Luxemburg die Emigration von über 100.000 Menschen nach Amerika,23 deren Böden nicht mehr genug Ertrag brachten, von dem man hätte leben können. Felder und Bäume mussten fortan strategisch bewirtschaftet werden, um entsprechend des Klimas und des jeweiligen Bodens optimale Erträge zu bringen. So wurde vor allem aus der Waldnutzung, die über die Jahrhunderte hinweg weniger Engagement erfahren hatte als die Felderwirtschaft, ein Unterfangen, das Fachkenntnis und Hingabe erforderte. Beides konnte anfangs vor allem von einer Gruppe geleistet werden: den Waldbesitzern. So erkannte etwa Valentin Delvaux, ein Waldbesitzer aus den Ardennen, der sein Wissen in Publikationen und Vorträgen weitertragen sollte, dass auf seinem ertragsarmen Boden schlichtweg die falschen Bäume wuchsen. Infolgedessen pflanzte Delvaux, damals schon Mitglied der Chambre des Député und Bürgermeister von Weiswampach, Fichten an, die hervorragend mit den Gegebenheiten zurechtkamen. So wurde ein verwaistes Land mit einem kleinen Eingriff wieder fruchtbar und ertragreich gemacht. Delvaux selbst sagte über die Arbeit als Privatwaldbesitzer:
„Der Mutterwald, der durch intelligentes Arbeiten seines Besitzers einen fast genauso schönen und großen Tochterwald hervorbringt, wird ihm zwei gute Dinge bescheren: 1) eine alte Plantage, die bereinigt, verbessert, und produktiver gemacht wurde, so dass sie zu einer echten Alma Mater geworden ist, die nichts als starke und majestätische Kinder hervorbringt; 2) einen neugeborenen, hoffnungsvollen Tannenwald, der auf außergewöhnliche Weise geboren wurde, da er aus dem Schoß der Mutter, die ihn geboren hat, in voller Bekleidung hervorging, so wie Minerva einst bewaffnet aus Jupiters Gehirn entsprang“24
Doch nicht nur Privatpersonen, Vereine und politische Kräfte, sondern auch Unternehmer versuchten, den enormen Anforderungen der Demographie und der Umwelt gerecht zu werden. So kaufte Charles de Wendel im 19. Jahrhundert, der Blütezeit der Großindustriellen de Wendels, wichtige Kohlengruben der Luxemburger Wälder auf und setzte diese gewinnbringend für die familieneigenen Stahlwerke ein. Auch schuf er die Arbeiterstadt Stiring-Wendel (auch: Rühr-Wendel), die bis in die 1930er-Jahre durch ihre hierarchische und hochfunktionale Struktur vorbildhaft für Luxemburg bleiben sollte.25
Fig. 8. Ein früher Bericht über die Fusion der EBV.
Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen schlossen sich unterschiedliche Unternehmen zusammen und professionalisierten ihren Betrieb. So wurde etwa das Unternehmen ARBED durch eine Fusion im Jahr 1911 gegründet.26 Die Zusammenführung von Unternehmen wie der Völliger Hütte und dem Neunkirchen Eisenwerk stellte eine Professionalisierung der Eisenwerke dar, die nun auch in einer besseren Position waren, um Interessensverträge zu schließen. So konnte etwa im Jahr 1913 mit dem Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) die Koksversorgung in großer Dimension festgelegt und optimiert werden.27
Es ist wegen dieser enormen wirtschaftlichen und mittlerweile ökologischen Bedeutung nicht verwunderlich, dass sich im mitteleuropäischen Raum eine gewisse Zuneigung zum Wald entwickelte, die im Deutschen sogar ihr eigenes Wort gefunden hat: Waldlust. War der Wald im Mittelalter noch ein Ort der Unsicherheit, der die Grundlage gruseliger Märchen lieferte, wurde er ab dem 19. Jahrhundert zum Sehnsuchtsort, den man schützen und pflegen wollte.
Erdöl und Strom als Entlastungsfaktoren des Waldes
Mit dem Einsatz von Erdöl und weiteren Energien wurde die Nutzung der Holzkohle sukzessive zurückgefahren. Neuartige Destillationsverfahren und bedeutende Erdölfunde, etwa bei Titusville, Pennsylvania im Jahr 1859 oder in Saudi-Arabien in der Stadt Dammam im März 1938, führten zur Etablierung des Erdöls als günstigen und effizienten Energieträger. So konnten Industrieanlagen und private Haushalte zunehmend mit Erdöl beheizt werden. Die Schaffung moderner Zementsorten und des Stahlbetons im Jahr 1867 ermöglichte es, riesige Bauprojekte mit einem zwar energieintensiven, aber äußerst stabilen und einfach zu verbauenden Material zu bewältigen. Strukturverfall und Brandgefahren wurden mit dem weitläufigen Einsatz von Beton minimiert, ebenso wie die benötigte Menge an Holz als Baustoff.
Zeitgleich führten umfassende Wirtschaftsreformen und der allgemeine Wohlstandsanstieg dazu, dass Großindustrielle wie die Familie de Wendel an Macht einbüßten und ihre Unternehmen neu ausrichten mussten. Es war nun nicht mehr möglich, ganze Städte im Namen einer Firma zu bauen und bis in die Erbfolge der Arbeiter Einfluss auszuüben. So zerfiel das alte Zunftwesen nicht zum alleinigen Vorteil des Handwerks, sondern sollte auch den sich formierenden Großunternehmen Raum verschaffen.28 So ging es etwa auch der Familie de Wendel, die sich lange in der Stahl- und Bergbauindustrie einen Namen gemacht hatte, und es schaffte, aus dem Montansektor auszusteigen und durch Diversifizierungen und Modernisierungen einen beachtlichen wirtschaftlichen Einfluss zu erhalten.29 Aber auch Luxemburg brachte großindustrielle Familien, wie zum Beispiel die Mayrischs, hervor. Emil Mayrisch versuchte etwa in den 1920er-Jahren über das europäische Stahlkartell die deutsch-französischen Beziehungen zu verbessern. Auch wenn der Einfluss luxemburgischer Industrieller im Vergleich zu den deutschen und französischen Großindustriellen klein war, reichte er aus, um in dem Land und in seiner Region einen Beitrag zur Modernisierung und zum technischen Fortschritt zu leisten.
Das 20. Jahrhundert und der Wald im Wandel
Der Erste Weltkrieg brachte Vernichtungen unbekannten Ausmaßes mit sich. Sowohl Mensch als auch Natur fielen insbesondere in Ost- und Zentralfrankreich der Kriegsmaschinerie zum Opfer. Es mag als Glücksfall für die Ardennen gelten, dass der deutsche Einmarsch und der spätere Rückzug so schnell verliefen, denn der Wald Luxemburgs überstand das Kriegsgeschehen zumindest deutlich besser als die weiter westlich gelegenen französischen Wälder.
Vielmehr hatte der Krieg gezeigt, dass die Politik sich kurzerhand zu Kahlschlägen und massiven Eingriffen entscheiden konnte. So formierten sich zwischen den beiden großen Kriegen Interessengruppen, die sich für den Erhalt und die Bewirtschaftung der Wälder einsetzten.
Im Zweiten Weltkrieg geriet der Luxemburger Wald ins Fadenkreuz der deutschen Kriegsindustrie, so wurden große Kahlschläge angeordnet, mit deren Hilfe die Waffenproduktion angefacht werden sollte. Damit nicht genug: Die Rundstedt-Offensive in Ösling war verheerend, in amerikanisch-deutschen Gefechten versanken die Wälder im Kugelhagel, die einen wirtschaftlichen Schaden über Generationen bedeuteten. Auch Jahrzehnte nach dem Krieg wurden Bäume mit eingeschlossenen Geschossen an Sägewerke geliefert, die mindestens die Zerstörung von Sägen, wenn nicht gar gefährliche Spätzündungen zur Folge hatten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es, den Wald zum Wiederaufbau zu nutzen und ihn infolgedessen zu roden. Doch dieser Trend führte glücklicherweise nicht zur Entwaldung, da immer mehr Beton, Öl, Gas und andere Wertstoffe das Holz ersetzen sollten. So schwand das wirtschaftliche Interesse an den Wäldern Luxemburgs, sobald die größte Not der Bevölkerung gelindert war.
Wertverlust und Prestigegewinn des Waldes
Der Wald verlor fortan seinen ökonomischen Wert. 1974 brach die Stahlindustrie Luxemburgs zusammen, die ARBED verbüßte ihren Status als Begründerin des Reichtums in Luxemburg und wandte sich von der Stahlproduktion ab, die von nun an in China und anderen außereuropäischen Ländern fortgesetzt wurde. Die Fixierung auf einfache und billige Materialien, wie etwa Plastik, Erdgas und chemische Produkte, führten zu einer weiteren Entwertung des Waldes, dessen Potenzial als Lieferant hochwertiger Wert- und Rohstoffe bis heute unterschätzt zu werden scheint. Waldbesitzer erhielten ab den 1960er-Jahren nur noch sehr kleine Gewinne aus den Erträgen des Waldes, wenn es denn überhaupt welche gab. Dabei werden große Potenziale außer Acht gelassen, die Antworten auf drängende Fragen der Moderne liefern könnten. Erdöl und Erdgas sind als Energieträger beispielsweise endlich und somit tatsächlich fossil. Holz ist hingegen ein regenerativer Stoff, der ebenso gut zur Energieerzeugung genutzt werden kann. Moderne Technologien ebnen den Weg für eine feinstaubfreie und effiziente Ausbeute des Rohstoffs als Brennmaterial. Auch als Baustoff, der in Möbeln und Häusern jahrzehntelang Bestand hat und zeitgleich auch noch Kohlenstoffdioxid einspeichert, ist Holz einzigartig. Aber neben der klassischen Verwendung offeriert der Wald mit seinen unzähligen Naturstoffen das Potenzial zur Entwicklung hochmoderner Medizin, Energie-, Bau- und weiterer Nutzstoffe, die das Leben der Menschen maßgeblich erleichtern und seinen ökologischen Fußabdruck gleichzeitig verkleinern können. Hier bleibt zu hoffen, dass die Forschung sich nicht von diesem unschätzbar wertvollen Naturraum abwendet, sondern ihm die Aufmerksamkeit zukommen lässt, die er zur Nutzung seiner Potenziale benötigt.
Die populäre Einstellung der letzten Jahre machte aus dem Forst allerdings ein museales Objekt, das nur ohne menschliches Zutun gesunden konnte und dessen Ausbeute stets eine Gefahr für die Umwelt bedeutete. Während der ökonomische Wert des Waldes sank, wuchs der ökologische. Doch der grüne Trend, der auf die Erhaltung und den Schutz der Natur abzielt, möchte anscheinend jedweden menschlichen Einfluss aus der Natur verbannen. Dabei ist die Natur nicht imstande, selbständig und optimal zu regenerieren. Menschliches Zutun kann aus öden Landschaften blühende Hochwälder schaffen, alte Erde zu neuem Ertrag bringen und das Ökosystem damit enorm unterstützen, ohne dabei auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse verzichten zu müssen.
Heute wird der Wald als ökologisch wichtiges Ressort natürlicher Schätze betrachtet. Baumpflanzungen und die Schaffung freier Flächen ohne menschliche Eingriffe gelten als positive Maßnahmen zur Gesundung eines geschädigten Ökosystems. Durch die Zersiedlung des Waldes und die niedrigen Renditen des Forstbesitzes ist der Wald ein unattraktives Besitzobjekt, jedoch eines, das insbesondere von der Politik gefördert und als wertvolles Ressort gehandelt wird.
Doch hier liegt ein großes Problem: Dem Wald werden Selbstheilungskräfte zugeschrieben, die jegliches menschliches Handeln obsolet machen würden. Doch diese Annahme ist aus mehreren Gründen falsch. Wildwuchs ist nicht besser als besonnenes Wirtschaften im Wald. Insbesondere in Luxemburg besteht die Möglichkeit, eine Dynamik in der Forstforschung zu entwickeln und die Waldbewirtschaftung zu optimieren. Dabei gilt bei vielen Privatwaldbesitzern der Grundsatz, dass Waldbesitz nicht in erster Linie Gewinn, sondern vor allem Freude bringt. Charles Krombach, ein Enkel von Valentin Delvaux und ehemaliges Mitglied im Verwaltungsrat des Vereins, erzählt gern eine Anekdote seines Großvaters:
„Einmal wurde er gefragt: Herr Delvaux, wie viel Rendement, also Gewinn machen Sie denn mit Ihren Wäldern? Und dann hat er immer gesagt: 10 %. Und dann haben die Leute so geschaut, wie Sie jetzt schauen. Dann haben sie gesagt: Wie macht der Mann das denn? Und dann hat er geantwortet: 1 % habe ich Rendements financiers (franz.: Rendite) ich verdiene 1 %, aber 9 % Freude am Wald. Und ich habe das schön gefunden. Diese 9 % sind die Freude, die Sie am Wald haben. Sie sehen den Wald ja wachsen, er ist wie ein Kind.“
Doch die Zukunft des Waldbesitzes sieht nicht rosig aus. Reglements setzen voraus, dass nur eine bestimmte Menge an Holz geschlagen werden darf, die Bepflanzung unterliegt strengen Auflagen und die Kosten sind, im Vergleich zur finanziellen Rendite, enorm hoch. Es wäre folglich wünschenswert, mehr Vertrauen walten zu lassen und dem Waldbesitzer auch die Freude an seiner Arbeit zu lassen, anstatt seinen Umgang mit dem eigenen Besitz zu diktieren.
Fig. 9. Unsere Wälder.
In vielen Fällen ist der Wildwuchs sogar für den Wald selbst schädlich, sodass ein Kahlschlag und die Pflanzung geeigneter neuer Pflanzen nicht selten das Mittel der Wahl ist, um eine echte Nachhaltigkeit und Nutzbarkeit natürlicher Ressourcen zu garantieren. Man probiere nur einen wilden im Vergleich zu einem professionell gekelterten Wein, der Unterschied ist gigantisch. Erst wenn Pflanzen gepflegt und vor natürlichen Schädlingen geschützt werden, können sie ihr ökologisches Potenzial gänzlich entfalten. Den Wald verwaisen zu lassen, käme einer Aufgabe gleich, mit der der eigentliche Wert und das Potenzial des Waldes für Mensch und Tier unerreichbar würden. Der Luxemburger Tagesspiegel schrieb am 01. September 1942:
„Das ist schon sehr lange her, viele Jahrhunderte lang, daß Europa so bedeckt war mit Wäldern, daß sich die Menschen Platz schaffen mußten, um genügend Stätten zum Wohnen und Platz für Ackerbau und Viehzucht zu finden. Holz war das einzige Brennmaterial und selbst das Eisen und andere Metalle wurden mit Holzfeuer geschmolzen. Um Weideland zu gewinnen, wurden oft – wie bei der Rodung tropischer Urwälder – ganze Waldstrecken ungenützt niedergebrannt.“30
Der Autor beklagt diese Entwicklung und stellt in Aussicht, dass diese sich sogar verschärfen würde:
„Holz gibt uns außer Möbeln und Baumaterial die wichtigsten Zellstoffe, Medikamente, Zucker, Papier usw.





























