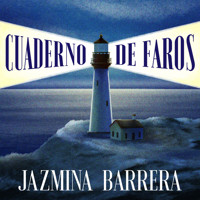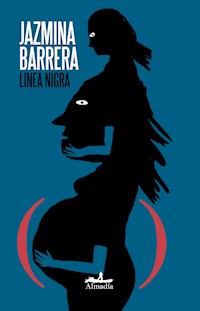14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wäre es nicht schön, wenn man Leuchttürme sammeln könnte? Die Schriftstellerin Jazmina Barrera erinnert sich in ihrer engen New Yorker Wohnung sehnsüchtig an all die Küsten, die sie besucht hat. Leuchttürme haben sie schon immer fasziniert, stehen sie doch für das Abenteuer und die Sicherheit, das Reisen und das Ankommen zugleich. Und das tun sie schon beinahe, seit es Menschen gibt – der Leuchtturm von Pharos zählte zu den Sieben Weltwundern der Antike. In ihren Gedanken nimmt uns die Autorin mit zu all den Leuchttürmen, die sie besucht hat oder die ihr in der Weltliteratur begegnet sind, und macht dabei überraschende Entdeckungen. Oder hätten Sie gewusst, dass der Großvater von Robert Louis Stevenson maßgeblich daran beteiligt war, die schottische Küste mit Leuchttürmen auszustatten? Und wie kam es, dass Virginia Woolf dem Leuchtturm in ihrem Werk einen so prominenten Platz gab? Ein literarischer Essay in hochwertiger Gestaltung für alle, die das weite Meer ebenso lieben wie das Nachhausekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jazmina Barrera
Leuchttürme
Eine literarische Reise
Aus dem mexikanischen Spanisch von Grit Weirauch
Dörlemann
Inhalt
Widmung
Yaquina Head
Jeffrey’s Hook
Montauk Point
Der Leuchtturm von Goury
Blackwell
Der Leuchtturm von Tapia
Bibliografie
Danksagung
Über Jazmina Barrera
Über Grit Weirauch
Für Lucía und Marina
44°40’36.4”N 124°4’45.9”O
Yaquina Head Lighthouse. Weiß getünchter Backsteinturm, 28 Meter hoch. Lampe mit Original- Fresnel-Linse, 31 Kilometer meerwärts sichtbar. Leuchtphasen: zwei Sekunden angeschaltet, zwei Sekunden ausgeschaltet, zwei Sekunden an, vierzehn Sekunden aus.
Yaquina Head
Wir kamen nach Portland, um in dem Haus von Willey, dem Freund meiner Tante, zu übernachten. Willey war Militärarzt und in seiner Jugend bei den Black Panthers gewesen; er hatte seine morgendliche Routine, die aus einem reichhaltigen Frühstück mit Eiern und Speck, Grießbrei und Toastbrot bestand, er las Tageszeitung und rauchte auf dem Balkon seines Hauses zwei oder drei Zigaretten.
Ich rauche nicht, aber am ersten Tag in jenem Haus verbrachte ich einen ausgedehnten Moment auf dem Balkon und schaute auf den Fluss mit seinen vielen Booten und Meeresvögeln. So muss wohl Rauchen sein. Tags darauf fuhren wir Richtung Süden. Mein Cousin, ein Zwei-Meter-Mann, und ich quetschten uns auf den Rücksitz des roten Pick-ups, den Willey my baby nannte. Wir übernachteten in dem Hotel, in dem The Shining gedreht wurde, am Fuß eines schlafenden Vulkankraters, der sich in einen saphirblauen See verwandelt hatte.
Zwei Jahre später kam ich wieder nach Portland. Meine Mutter, meine Tante, Willey und ich machten einen Ausflug in den Küstenort Newport. Es war September. In demselben Pick-up fuhren wir eine von Wald umgebene Straße entlang und hielten zum Essen auf halber Strecke in einem Restaurant, wo uns ein freundliches altes Paar bediente. Wir aßen Marionberry Cupcakes, die mit der dort heimischen Brombeersorte zubereitet wurden. Ich erinnere mich, wie ich Kopfhörer trug und die kahlen Wälder vorbeiziehen sah, mit Bäumen ohne Blätter, Stämmen, die erst dunkel waren, dann weiß und schließlich rot. Wir kamen nach Newport, und noch nie stand ich vor einem so grauen, so kalten Meer. Selbst im Sommer legte sich Nebel über die ganze Stadt und wir mussten das Hotel zwischen den Wolken suchen.
*
Die meisten meiner Sammlungen waren ein Misserfolg. Als kleines Mädchen beeindruckten mich die Kinder, die alle Figuren der Krieger des Zodiac besaßen oder anderer Spielzeugserien, die in Chipstüten kamen. So sehr ich mich auch bemühte, mir blieb so eine Heldentat verwehrt. Die zwei Sammlungen, in denen ich es weit gebracht hatte, waren eine aus Edelsteinen (heute weiß ich, dass fast alle verschiedene Arten von Quarz waren) und eine aus Murmeln. Ich liebte die Farben und Texturen, vielleicht habe ich mich deswegen darauf spezialisiert. Auch meine Trockenblumensammlung wuchs beachtlich, noch immer bewahre ich sie auf, mit Exemplaren aus den verschiedenen Gärten meines Lebens.
Die größte Sammlung, die ich besitze, besteht aus Büchern. Als Kind las ich die Bücher meist am selben Tag, an dem ich sie gekauft hatte. Noch in meiner Jugend hatte ich jedes Buch in meinem Besitz gelesen. Eines Tages aber hatte ich mehr Bücher als Zeit, sie zu lesen. Bald stellte ich fest, dass ich vermutlich nie alle Bücher in meiner Bibliothek lesen würde (dafür gibt es im Japanischen ein Wort: tsundoku). Inzwischen kann ich zwischen zwei Formen des Sammelns unterscheiden: dem Sammeln der Bücher an sich – als physische Objekte – und dem von Leseerfahrungen, die man ebenso wertschätzt und anhäuft.
*
Noch bevor ich Leuchttürme kannte, träumte ich schon als kleines Mädchen von einem; er war verlassen und weit von der Küste entfernt. Unten gab es einen Garten und ein Haus, in dem ich mit meinen Eltern wohnte. Im Traum fragte ich meinen Vater, was er auf seiner Runde durch die verfallenen Räume gefunden hatte. Er antwortete, nur das Skelett einer Fledermaus. Ich bestand darauf, dass sie schon tot sei, aber er sagte zu sich selbst, wie in einem Trailer zu einem Horrorfilm: »tot, aber lebendig«. Man sah die Spitze des Leuchtturms: ein dunkler Dachboden, auf dem das Fledermausskelett mit seinen Fingerknochen einen Trank in einem Kessel umrührte. Die Kamera näherte sich dem Schädel, der mit schriller Stimme sprach: »Ich bereite die Rache für den vor, der mich tötete«.
*
Herman Melville schreibt in Moby Dick, dass alle Menschen »eine natürliche Anziehung zum Wasser teilen«. An einer Stelle erklärt Ishmael, warum man Ersparnisse und Boni verschwendet, um diesen saphirblauen See in einem erloschenen Vulkankrater zu besichtigen, einen so hohen Wasserfall, dass das Wasser vor dem Auftreffen auf die Felsen zerstäubt, ein Ensemble an Becken, in denen winzige und prähistorische Wesen leben, mitten in der Wüste, einen im Wald verlorenen Steinbruch. Er beschreibt die Faszination der Farbe, die wir heute International Klein Blue nennen, und des Türkis der Lagune von Bacalar im mexikanischen Quintana Roo. Alle Wege führen zum Wasser, sagte Ishmael. Und der Grund, warum niemand seinem Lauf widerstehen könne, sei derselbe, aus dem Narziss in seinem eigenen Gesicht ertrank: Denn im Wasser zeichne sich »das ungreifbare Phantom des Lebens« ab.
Die Spiegelkraft des Wassers brachte Joseph Brodsky auf den Gedanken, dass Gottes Geist, wenn er sich nah an der Oberfläche bewegte, von dieser reproduziert werden müsste. Gott ist für Brodsky die Zeit; das Wasser ist daher ein Abbild von ihr, und eine Welle, die mitternachts das Ufer streift, ist ein Stück Zeit, das aus dem Wasser auftaucht. Sollte dem so sein, bedeutet das Betrachten des Ozeans aus einem Flugzeug heraus das Gleiche, wie das unruhige Antlitz der Zeit zu bezeugen.
Keine Zivilisation mit Küsten, bedeutenden Seen oder Flüssen war immun gegen die Notwendigkeit, die Gewässer zu befahren, die Weiten der Meere zu erkunden, Waren auf den Wellen zu transportieren oder sich selbst davon tragen zu lassen. Und dennoch erscheinen Seeleute in ihren Booten so verletzlich wie Pinguine auf dem Trockenen. Das Wasser, vertraut und notwendig, ist zugleich fremd und gefahrvoll. Trotz der Tatsache, dass es den größten Teil des Körpers eines Menschen ausmacht, kann es ihm auch das Leben nehmen.
Die ersten Leuchttürme erwuchsen aus dem kollektiven Bemühen, vor gefährlichen Zonen in der Nähe der Küsten und Häfen zu warnen. Heutzutage mögen Schiffbrüche seltener geschehen, aber lange Zeit waren sie an der Tagesordnung: Laut Jean Delumeau sanken 1853 in englischen Gewässern 832 Boote. In seinem Buch Angst im Abendland zitiert er Rabelais’ Figur Pantagruel und dessen Angst vor dem Meer, »diesem Tod durch Schiffbruch«, der ihn in Panik versetzt. Und Homer zitierend fügt Pantagruel hinzu, »es ist ein schlimmes, abscheuliches und unnatürliches Ding, im Meer umzukommen«.
Die Höllen vieler Mythologien sind von Wasser umgeben, zu ihnen gelangt man nur per Boot, denn das kollektive Bewusstsein der Antike, so Delumeau, assoziierte das Meer mit den schrecklichsten Angstgespinsten. Es stand in Verbindung mit dem Tod, der Nacht und dem Abgrund.
Die Mayas bauten Monumente, die von innen heraus leuchteten, um anzuzeigen, wo es riskant oder möglich war, an Land zu gehen. Die Kelten zündeten Fackeln an, um Botschaften entlang der Küste zu senden. Aber die Griechen waren es, die diesen Lichtern den Namen Pharos gaben, von dem sich in vielen Sprachen das Wort für Leuchtturm ableitet.
Das Feuer, das auf das Ende des Meeres zeigt. Homer spricht in der Ilias von brennenden Türmen, mit Feuerstellen, die bewacht werden mussten, wie das heilige Feuer in den Tempeln des Apollon. Er berichtet von einem Feuer an einem einsamen Ort auf einem Berg, das den Seeleuten erschien, die auf dem Meer umherirrten, »da die Stürme sie von den Freunden entfernten«, und das wie der Schild des Achilles leuchtete, »bis zu den Göttern hin sichtbar«.
Anscheinend gab es während des Trojanischen Krieges einen Leuchtturm in der Einfahrt in die Dardanellen – den antiken Hellespont – und einen am Bosporus. Sueton schreibt über einen Leuchtturm auf der Insel Capri, und Plinius der Ältere nennt weitere in Ostia und Ravenna (er warnt zudem vor der Gefahr, sie mit Sternen zu verwechseln). Herodian erwähnt Türme in Häfen, die aus Licht seien und deren Feuer den Schiffen des Nachts Orientierung gebe. Einer auf einer Insel aber sollte in den romanischen Sprachen namensgebend für alle nachkommenden werden. Für den faro auf Spanisch und Italienisch, phare auf Französisch, farol auf Portugiesisch, far auf Rumänisch. Es ist der Pharos von Alexandria. Auf dieser Insel Pharos, von der es in der Odyssee heißt, sie habe »einen gut gelegenen Hafen, in dem die Schiffe auf günstige Winde warteten«, befand sich ein gigantischer leuchtender Wachtturm, den Ptolemaios der Erste, mazedonischer General unter Alexander dem Großen, im 3. Jahrhundert vor Christus erbauen ließ.
Dieser Turm aus hellem Gestein und gläsernen Gewölben soll 135 Meter hoch gewesen sein, mit Flammen auf seiner Spitze, die um eine glänzende Statue des Gottes Helios loderten. Es wird berichtet, dass der Architekt Sostratos von Knidos seinen Namen in den Stein gravierte, ihn mit Gips überzog und darauf den Namen Ptolemaios schrieb, in dem Wissen, dass der Gips irgendwann abfallen und sein eigener Name für die Nachwelt verewigt sein würde. Das Feuer brannte ununterbrochen, Tag und Nacht, und die Schiffe konnten es bereits 56 Kilometer von der Küste entfernt sehen. Der Leuchtturm von Alexandria überdauerte die Hängenden Gärten und fast alle anderen der Sieben Weltwunder, bis 1323 ein Erdbeben ihn zum Einstürzen brachte. Aber Alexandria wird immer die Stadt des Leuchtturms bleiben, eines riesengroßen Phantoms, das sich in die Geschichte eingeschrieben hat.
»Dieselben Straßen und Ecken werden in meiner Fantasie brennen, wie der Leuchtturm in der Geschichte brennt«, sagt der Erzähler in Justine, dem ersten Roman des Alexandria-Quartetts von Lawrence Durell. Darin verschmilzt der Protagonist mit der Stadt, beide verführerisch, stürmisch und unerreichbar.
Später entstanden Leuchttürme in verschiedenen Teilen der Welt. In Ostia bei Rom und in entlegeneren Hafeneinfahrten im Römischen Reich ragten hohe Türme als Abbild des Leuchtturms von Alexandria, wie der Herkulesturm im galizischen La Coruña. Der Überlieferung nach erklärte der Gewaltherrscher Caligula in seinem Wahn Neptun den Krieg und wollte ihn beleidigen, indem er Muscheln vom Seeufer aufsammeln ließ. Als Neptun darauf nicht reagierte, entschied der Tyrann, dass er gewonnen habe. Er baute als Zeugnis seines Sieges einen sehr hohen Turm, in dem wie auf Pharos des Nachts Lichter brannten, damit Schiffe navigieren können.
Anfangs wurden Leuchttürme mit Brennholz betrieben, dann mit Kohle und später mit Teer. Anschließend kamen die Petroleum- und Gaslampen, und als Strom erzeugt werden konnte, funktionierten sie im Zusammenspiel mit den vergrößernden Fresnel-Linsen: fantastische, gläserne Köpfe wie urzeitliche Monster, die Licht meilenweit ins Meer tragen können.
Die ältesten uns verbliebenen Leuchttürme stammen fast alle aus dem Mittelalter. Auf manchen Zinnen wurden Feuer entfacht, um Seeleute vor der Nähe zur Küste zu warnen. In jener Zeit betreuten Mönche die Leuchttürme freiwillig, und es war ihnen ein Herzensanliegen. Ihr Einsatz stand im Gegensatz zur Haltung der Monarchen, die sich das Recht anmaßten, alles, was an ihren Küsten Schiffbruch erlitt, in Besitz zu nehmen (Männer und Frauen eingeschlossen). Deshalb wuchs der Reichtum in Regionen wie der Normandie, wo die starken Strömungen häufig Schiffe zerschellen ließen. Zur selben Zeit wurden in China riesige Pagoden errichtet, die als Leuchttürme dienten.
Im Jahr 1128 wurde der Leuchtturm von Genua, die Lanterna, erbaut, deren Leuchtturmwärter Mitte des 15. Jahrhunderts Antonio Colombo war, angeblich der Onkel des Seefahrers Christoph Kolumbus.
*
Das Sylvia Beach Hotel in Newport ist die Schöpfung zweier literaturbegeisterter Damen. Es ist ein riesiges Haus, voller Katzen und Gruppen reisender Rentnerinnen mit kleinen Hüten (nahe Verwandte jener Herren, die Schiffe in Flaschen bauen, die zur Vogelbeobachtung gehen und wie wir Leuchtturmfiguren sammeln). Es verfügt über eine Bibliothek im Dachgeschoss und etwa zwanzig Zimmer, die bekannten Autoren und Autorinnen gewidmet sind; es gibt eines für Emily Dickinson, eines für Walt Whitman, eines für Jane Austen und andere für Shakespeare, Herman Melville und Gertrude Stein (wenngleich der Name eine Hommage an James Joyces Mäzenin ist, wurde kein Zimmer dem Autor von Ulysses gewidmet). Jedes Zimmer ist im Stil der Zeit und nach dem Geschmack dieser Autoren eingerichtet, mit deren jeweiligen Gesamtwerken in den Bücherregalen. Ich hätte liebend gerne im Virginia-Woolf-Zimmer geschlafen, mit seiner viktorianischen Einrichtung und dem Fenster zum Meer, von wo aus man in der Ferne das Kap Yaquina Head und den Leuchtturm darauf erspähen konnte. Ich hatte gerade begonnen, Zum Leuchtturm zu lesen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob es Zufall war oder ob ich, weil ich wusste, dass ich zu einem Leuchtturm fahren würde, diese Übereinstimmung herbeiführte.
Virgina Woolf ließ sich für ihren Roman von einem Leuchtturm an der Küste von Cornwall inspirieren, wo sie die Sommer mit ihrer Familie verbrachte: ein kleines weißes Gebäude mit vielen Fenstern, das über eine kleine Insel ragt. Zum Leuchtturm beginnt vor einem Fenster mit dem Versprechen, das Mrs. Ramsay ihrem Sohn James gibt: Bei schönem Wetter würden beide am nächsten Tag den Leuchtturm in der Nähe ihres Sommerhauses besichtigen. Später erneuert sie ihr Versprechen, während sie ein Paar Socken für den tuberkulosekranken Sohn des Leuchtturmwärters strickt. Seit Monaten sitzt er in dem Turm auf dem Felsen aufgrund des Unwetters fest, ohne jemanden zu Gesicht zu bekommen. Mrs. Ramsay stellt sich vor, wie er dort ausharrt, Woche für Woche, wie die stürmischen Wellen an den Leuchtturm peitschen, an ihm rütteln, ihn mit Gischt überschäumen. An ihre Töchter gerichtet sagt sie, man sollte Leuchtturmwärtern alle erdenklichen Annehmlichkeiten bringen, um ihnen zu helfen, sie zu trösten und zu unterhalten, da es schrecklich und sehr langweilig sein muss, die ganze Zeit dort eingesperrt zu sein, ohne etwas zu tun zu haben.
*
Ich lebe auf einer Insel, im fünften Stock eines roten Hauses. Im Flur steht die Nummer fünf angeschrieben, aber es gibt zwei zweite Stockwerke, niemand konnte mir erklären, warum. Nur selten steige ich aus diesem Ziegelsteinturm hinunter. Wenn doch, dann meist in der Nacht oder weil ich mir Leuchttürme anschauen will.
In meiner Wohnung gibt es vier Fenster. Zwei sind mit Gittern versehen, die vor Kurzem angebracht wurden, weil ein Dieb in der Nachbarschaft einstieg. Die beiden anderen gehen auf eine Ziegelwand in ein Meter Entfernung. Die Mauer ist so hoch, dass es, selbst wenn man nach oben blickt, nicht möglich ist, den Himmel zu sehen. Den Boden erblickt man auch nicht; der Zwischenraum ist zu eng und die Ziegel verlieren sich im Schwarz. Klaustrophobie hatte ich nie, aber manchmal verspüre ich ein unkontrollierbares Bedürfnis, in die Ferne zum Horizont zu schauen. In dieser Stadt aus Hochhäusern ist es schwierig, ihn zu finden, man muss auf die Dachterrasse steigen, zum Fluss gehen oder eine dieser weiten Straßen suchen, die die gesamte Insel durchqueren, um etwas von einer Hintergrundlandschaft zu erhaschen. Manchmal mache ich eines davon. Als ich Zeichenunterricht nahm, lernte ich, dass der Geist den Augen folgt, und wenn ich meinen Blick zu lange einschränke, wird auch mein Denken enger.
Ein anderes Problem mit den Fenstern der Wohnung ist die Dunkelheit. In mein Zimmer und ins Wohnzimmer gelangt gräuliches und gedämpftes Licht, wie an einem bewölkten Tag. Meine einzige Pflanze starb in wenigen Wochen. Ich bade mich den ganzen Tag in Kunstlicht; an einem sonnigen Tag, und wenn niemand anderes in der Wohnung ist, muss ich, um die Sonne zu sehen, nah an das Fenster des anderen Zimmers gehen, mich an die Gitterstäbe kleben und sie über den anderen Gebäuden suchen.
Ich frage mich, was mit mir nach langer Zeit ohne direktes Sonnenlicht passieren würde, ob ich mich in einen dieser blinden und durchsichtigen Fische verwandele, die in unterirdischen Flüssen und in Höhlen leben.
Ich glaube, meine Nerven sind etwas angespannter als bei den meisten Menschen. In Kontakt mit Nadeln werde ich ohnmächtig, fast alle starken Emotionen verursachen mir Kopfschmerzen. Vielleicht ist meine Haut sehr dünn und Leute stellen für mich eine permanente Gefahr dar.
Schmerz hat die Eigenschaft, stärker zu werden, sobald man an ihn denkt. Wenn ich mich auf irgendeinen Teil meines Körpers konzentriere, tut er mir am Ende weh. Wenn ich mich stark auf mich selbst konzentriere, tue ich mir weh. Zum Beispiel gerade jetzt, während ich dies schreibe. Wenn ich allerdings Leuchttürme besichtige, wenn ich lese oder über Leuchttürme schreibe, gehe ich von mir weg. Manche mögen es, in Brunnen zu blicken. Mich macht es schwindelig. Aber bei den Leuchttürmen denke ich nicht mehr an mich. Ich entferne mich räumlich und gehe zu entlegenen Orten. Ich entferne mich auch zeitlich, hin zu einer Vergangenheit, die ich idealisiere, ich weiß, in der die Einsamkeit einfacher war. Ich nehme auch Abstand zu meiner Generation und deren Geschmack, denn Leuchttürme scheinen heute romantisch und sublim, zwei Wörter, die aus der Mode sind. Es ist schwierig, über die Themen zu sprechen, die mit Leuchttürmen assoziiert werden: die Einsamkeit und den Wahn. Versuchen wir es doch, müssen wir uns damit abfinden, dass es kitschig wirkt.
Achte ich auf mich selbst, wird der Schmerz größer. Wenn ich mich allerdings im Vergleich zum Leuchtturm denke, fühle ich mich wie neugeboren und winzig. Fast verschwunden. Was ich für Leuchttürme empfinde, ist das genaue Gegenteil von Leidenschaft – oder vielmehr ist es Leidenschaft für die Anästhesie. Die Sucht nach einem Betäubungsmittel. Vielleicht würde ich mich gern in einen Leuchtturm verwandeln: kalt, gefühllos, fest, gleichgültig. Wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, ich könnte wirklich zu Stein werden und diesen absoluten Frieden von Felsen genießen.