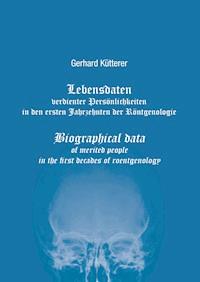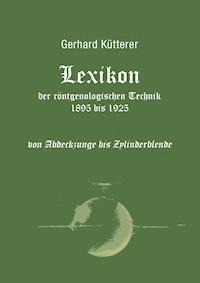
Lexikon der röntgenologischen Technik 1895 bis 1925 von Abdeckzunge bis Zylinderblende E-Book
Gerhard Kütterer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zum Lexikon: Die Entdeckung der X-Strahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 hat die Medizin von Grund auf verändert. Auch Technik und Technologie haben durch diese „neuen Strahlen“ gewaltige Fortschritte erzielt. Medizin und Technik haben sich bis in unsere Tage gegenseitig befruchtet und in allen beteiligten Fachgebieten zu teils revolutionären Weiterentwicklungen geführt. Diese rasanten Weiterentwicklungen haben aber auch dazu geführt, dass Fachtexte und Problemstellungen aus den ersten Jahrzehnten der Röntgenologie – auf medizinischem wie auf technischem Gebiet – heute von Lesern oft kaum mehr verstanden werden. Dies wird in naher Zukunft noch weit mehr der Fall sein, wenn die Fachvertreter, die von ihrer beruflichen Entwicklung her mit den analogen Bildgebungsverfahren noch vertraut sind, nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Entwickler und Anwender der digitalen Techniken werden dann Mühe haben, die Wurzeln ihres Fachgebietes in die „analogen Zeiten“ zurück zu verfolgen und zu verstehen. Und: Nur mit Kenntnis der analogen Techniken und deren Probleme können die Leistungen der Röntgenpioniere ausreichend gewürdigt werden! Das vorliegende Lexikon erfasst die in der frühen Literatur – etwa bis 1925 – zu findenden Begriffe und stellt dar, was unter diesen zur damaligen Zeit verstanden wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erweitertes Glossar aus
Gerhard Kütterer, „Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe,
den Menschen durchsichtig zu machen wie eine Qualle“,
Books on Demand, Norderstedt 2005, ISBN 3-8334-2093-6
mit Literaturnachweisen
Dipl.-Ing. Gerhard Kütterer
Lipsweg 2
D-91056 Erlangen
Tel. 09131 99 21 76, international: 0049 9131 99 21 76
Fax 09131 99 18 18, international: 0049 9131 99 18 18
E-Mail: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Einführung
Erläuterungen
Benutzungshinweise
Lexikalischer Teil
Quellenverzeichnis
Weitere Bücher des Autors
Danksagung
Bei meinen Recherchen zu dem vorliegenden Lexikon habe ich vielfältige Unterstützung erhalten. Mein besonderer Dank gilt Frau Doris-Maria Vittinghoff, der Leiterin des Siemens Medizintechnik Archivs in Erlangen und ihrem Team. Ein weiterer besonderer Dank geht an Frau Christina Falkenberg und Herrn Dr. Uwe Busch vom Deutschen Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep. Herrn Marcel Michels, Experte für die Historie der Medizintechnik, danke ich für die jederzeitige Unterstützung mit dem überaus großen Fundus seines Wissens. Von Herrn Gerrit J. Kemerink PhD, Maastricht, habe ich durch die freundschaftliche Zusammenarbeit bei verschiedenen Publikationsprojekten Anregungen zu Stichworten und Formulierungen erhalten, die ich dankbar aufgenommen habe.
Das Titelbild dieses Lexikons stellte freundlicherweise das Siemens Medizintechnik Archiv, Erlangen, zur Verfügung. Es zeigt eine Ionen-Röntgenröhre in Betrieb. Entnommen ist das Bild der Broschüre von Gustav Großmann „Einführung in die Röntgentechnik – Verfaßt für die Teilnehmer der Röntgenkurse der Siemens & Halske A.-G.“ von 1912.
Gerhard Kütterer
Einführung
Die Entdeckung der X-Strahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 hat die bis dahin geübte Medizin revolutioniert. Und nicht nur die Medizin, auch Technik und Technologie haben durch diese „neuen Strahlen“ und ihre Anwendung gewaltige Fortschritte erzielt. Medizin und Technik haben sich seit dieser Zeit bis in unsere Tage gegenseitig befruchtet und in allen beteiligten Fachgebieten zu bedeutsamen Weiterentwicklungen geführt.
Eben diese Weiterentwicklungen haben aber auch dazu geführt, dass viele Erkenntnisse sehr schnell auch wieder veralten. So kommt es, dass Fachtexte aus den ersten Jahrzehnten der Röntgenologie, sowohl solche auf dem medizinischen wie auch auf dem technischen Gebiet, von heutigen Lesern oft kaum mehr verstanden werden. Dies wird durch den Wandel während der letzten Jahrzehnte von den analogen hin zu den digitalen Techniken in naher Zukunft noch weit mehr der Fall sein. Die heutigen Entwickler und Anwender der digitalen Techniken werden bald Mühe haben, die Wurzeln ihres Fachgebiets in die „analogen Zeiten“ zurück zu verfolgen und zu verstehen, wenn die Fachvertreter, die von ihrer beruflichen Entwicklung her mit den analogen Bildgebungsverfahren noch vertraut sind, nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das vorliegende Lexikon erfasst die in der frühen Literatur – etwa bis 1925 – zu findenden Begriffe und stellt dar, was unter diesen Begriffen zur damaligen Zeit verstanden wurde. Dabei ist zu bedenken, dass es zu dieser Zeit – wie so oft bei schnell voranschreitenden Entwicklungen – eine allgemein abgestimmte Nomenklatur nicht gibt. Auch wurden mitunter von verschiedenen Autoren für denselben Tatbestand unterschiedliche Begriffe geprägt und/oder unterschiedliche Definitionen für die gleichen Begriffe verwandt.
Das Lexikon enthält auch einige Begriffe aus benachbarten Fachgebieten, soweit dies zum Verständnis der frühen Literatur hilfreich erschien.
Die unzähligen Varianten sowohl von Ionen-Röntgenröhren wie von Hochvakuum-Glühkathoden-Röntgenröhren konnten nicht einzeln erfasst werde, schon weil nicht jede dieser Röhren namensgebende Eigenheiten besaß. Das Gleiche gilt auch für die Vielzahl von Unterbrecherkonstuktionen; hier werden nur die wichtigsten aufgeführt. Für die Nutzer des Lexikons, die sich vertieft mit der Materie befassen möchten, sind aber detaillierte Literaturzitate genannt, denen weitere Details entnommen werden können.
Erläuterungen
In diesem Lexikon sind die in den ersten drei Jahrzehnten der Röntgenologie gebräuchlichen Fachbegriffe erfasst. Zu beachten ist, dass sich die Inhalte verschiedener Begriffe innerhalb des betrachteten Zeitraumes mitunter verändert haben können. Zu beachten ist insbesondere, dass damalige Definitionen in vielen Fällen nicht mehr gleichbedeutend sind mit den heutigen.
Die Literaturangaben geben beispielhaft eine oder mehrere Quellen an, denen die Begriffe entnommen sind, sowie solche, denen die damalige Definition oder aber die Grundlagen für eine abgeleitete Definition entnommen sind. Alle benutzten Quellen sind auf Seite 203 ff aufgelistet.
Dieses Glossar will nicht in Konkurrenz zu speziellen medizinischen Wörterbüchern (Pschyrembel u. a.) treten. In der Regel nicht erfasst sind deshalb medizinische Begriffe, die dort enthalten sind.
Ähnliches gilt für fremdsprachliche Begriffe: Aufgenommen wurden die damals üblichen Bezeichnungen, nicht jedoch die, die heutigen Wörterbüchern entnommen werden können.
Benutzungshinweise
Die Umlaute ä, ö, ü gelten in der alphabetischen Sortierung wie die einfachen Buchstaben a, o, und u
ß gilt in der alphabetischen Reihenfolge als ss
Wortverbindungen mit Photo-/Foto- werden in diesem Lexikon mit ph geschrieben
Worte, die unter C vermisst werden, suche man unter K oder unter Z und umgekehrt: Camera – Kamera, Celluloid – Zelluloid usw.
Oft sind auch unterschiedliche Schreibweisen innerhalb eines Wortes üblich: Azeton – Aceton, Lochkamera – Lochcamera usw.
Die Begriffe Bismut und Wismut sind gleichbedeutend und werden in der Literatur wahlweise benutzt, man suche deshalb gegebenenfalls unter beiden Begriffen
Das Verweiszeichen (>) hat die Bedeutungen von siehe, siehe dort, siehe auch, vergleiche auch
Abdeckzunge
Zungenförmiges, Röntgenstrahlen absorbierendes Filter mit Handgriff, das während einer Zahnaufnahme manuell über die Zähne bewegt wurde, um eine gleichmäßige Belichtung von unterschiedlich strahlenabsorbiernden Zahn- und Kieferpartien zu erreichen.
Reiniger, Gebbert & Schall; Katalog „Die Röntgenapparate nebst deren Zubehör“; Berlin/Erlangen 1912, S. 115
abgestumpfter Brennpunkt
Gleichbedeutend mit > stumpfer Brennfleck.
Abschmelzsicherung
Elektrische Sicherung, in der feuersicher eingebaute Metalldrähte (Silber, Blei, > Stanniol) beim Erreichen einer bestimmten Stromstärke zum Durchschmelzen gebracht werden.
1.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 172 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Abschmelztubus
Verbindendes Glasrohr zwischen dem Kolben einer > Ionen-Röntgenröhre und der Vakuumpumpe, das nach dem Evakuieren der Röntgenröhre abgeschmolzen, d. h. vakuumdicht getrennt wird, um die Röntgenröhre von der Vakuumpumpe zu trennen.
Fürstenau, Robert; Die Technik der Röntgenapparate; Dr. Max Jänicke Verlagsbuchhandlung, Hannover, etwa 1908, S. 82
abschwächen
Überbelichtete, überentwickelte oder verschleierte > photographische Platten und Filme können durch chemische Behandlung mit Silberlösungsmitteln verbessert („abgeschwächt“) werden: Der meist verwendete > Farmersche Abschwächer (> Blutlaugensalz) ist kontrastverbessernd, der > Kaliumpermanganat-Abschwächer kontrasterhaltend, der > Ammoniumpersulfat-Abschwächer kontrastmindernd.
> Schleier
1.) Albers-Schönberg, H.; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1903, S. 104 – 2.) Dessauer, Friedrich; Wiesner, B.; Kompendium der Röntgenographie; Leipzig 1905, S. 289-292 – 3.) Fürstenau, R.; Immelmann, M.; Schütze, J; Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1919, S. 346
Absoluter Härtemesser
Härtemesser nach Theophil Christen um 1912, der auf der Bestimmung der > Halbwertschicht beruht: In den Strahlengang zwischen Röntgenröhre und Leuchtschirm wird einerseits die > Halbwertscheibe eingebracht, andererseits direkt daneben ein verschieblicher stufenförmiger Absorptionskörper aus gewebeähnlichem Material, hier > Bakelit der Dicken 2 mm bis 30 mm. Die Stufe des Absorptionskörpers, die die gleiche Fluoreszenzhelligkeit wie die Halbwertscheibe aufweist, entspricht der Halbwertschicht dieses Materials. Ein dem > Kryptoskop ähnlicher Aufsatz ermöglicht die Ablesung im Hellen.
> Härtemesser
1.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 23-29 (mit Abbildungen) – 2.) Schmidt, H. E.; Röntgen-Therapie; Verlag von August Hirschwald, Berlin 1915, S. 39-42 (mit Abbildungen)
Absorptionsgesetz
> Röntgensches Absorptionsgesetz
Absorptionsquotient
In der Strahlentherapie das Verhältnis der Strahlung in einer bestimmten Ebene (ohne Vorhandensein eines Objektes) zu der durch Absorption in einem Objekt geschwächten Strahlung in der gleichen Ebene.
> Dispersionsquotient und > Dosenquotient
Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 101-105
Vorschlag von Alfred W. Porter als Bezeichnung für > X-Strahlen.
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 169
Röntgenkinematographie
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 172
Röntgenologe (USA)
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 621
Gleichbedeutend mit > Aktinographie.
Röntgenologe (USA)
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 628
Strahlenbehandlungen (als Oberbegriff für die Therapie mit Licht- und Röntgenstrahlen).
Burrows, E. H.; Pioneers and early Years – A History of British Radiology; Colophon Limited, St. Anna 1986, S. 93
(Röntgen-) Strahlentherapie
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 646
Anpassung an Sinnesreize.
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 519 – 2.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961
Adaptationsbrille
Brille mit roten Gläsern nach Wilhelm Trendelenburg, mit der das Auge bereits im hellen Raum an das niedrige Leuchtdichteniveau des > Durchleuchtungsschirmes angepasst werden kann.
> Schwarzbrille
1.) Trendelenburg, W.; Die Adaptationsbrille, ein Hilfsmittel für Röntgendurchleuchtungen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 25, 1917/1918, S. 30-32 – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 2, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 190-191
Gerät nach Bucky zur Prüfung der Augenanpassung an das Helligkeitsniveau des Durchleuchtungsraumes: Kästchen mit grüner durchscheinender Scheibe, die mit einer nur bis zur Rotglut erhitzten Glühlampe beleuchtet wird. Wenn ein auf der Scheibe befindliches schwarzes Kreuz erkannt werden kann, ist eine ausreichende > Adaptation erreicht.
Trendelenburg, W.; Die Adaptationsbrille, ein Hilfsmittel für Röntgendurchleuchtungen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 25, 1917/1918, S. 30-32
Adit
Elektrisches Isoliermaterial, hergestellt aus Harzen und Silikaten von der Fa. Gebr. Adt A.-G.. Die Durchschlagfestigkeit beträgt bei
1 mm Dicke
1 kV
2 mm Dicke
1,8 kV
5 mm Dicke
4 kV
Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Adria-Röntgenplatten
> Photographische Platten der Firma Josef Eduard Rigler, Budapest, für den Einsatz in der Röntgentechnik, mit einseitiger oder beidseitiger Emulsion, „silberreich, höchstempfindlich“.
Anzeige in: Kraft, H., Wiesner, B. (Herausg.); Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik; II. Bd., Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1907, nach S. 90
Adurol-Entwickler
Typ eines photographischen Entwicklers der Firma J. Hauff, Feuerbach/Württ. und der Firma Schering, Berlin. Hauptbestandteil: Monochlorhydrochinon. Vorteile: hohe Deckung, arbeitet rasch und weich, wenig temperaturabhängig, geringe Schleierneigung.
Rezeptbeispiel: Lösung A, bestehend aus 10 g Adurol, 80 g krist. Natriumsulfit und 500 g Wasser. Lösung B, bestehend aus 60 g > Pottasche und 500 g Wasser. Zur Entwicklung wird je 1 Teil der Lösungen A und B und 1 Teil Wasser vermischt.
> photographische Entwickler und > Schleier
1.) Eder, J. M.; Ausführliches Handbuch der Photographie; Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1902, S. 323 – 2.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 261 –– 3.) Anzeige in: Kraft, H., Wiesner, B. (Herausg.); Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik; II. Bd., Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1907, nach S. 90
AEG, A.E.G.
Der Berliner Unternehmer Emil Rathenau erwarb 1881 die Lizenz auf Edison-Patente und gründete 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität, aus der 1887 die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG, Berlin, hervorging.
dtv-Lexikon 1971
(Auf etwas ein-) wirkendes Mittel
1.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961. – 2.) Pschyrembel; Klinisches Wörterbuch; 257. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin New York 1994
Agfa
Die Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrication, Leverkusen, Hersteller photographischer Materialien, ging 1873 aus dem Zusammenschluss der Gesellschaft für Anilinfabrikation (gegründet 1867 von den Chemikern Paul Mendelssohn Bartoldy und Carl Alexander von Martius) und einer weiteren Firma hervor.
Internet-Suchmaschine Google
In der Technik ein Maschinensatz aus mehreren zusammenwirkenden Einzelmaschinen, -apparaten oder -geräten.
1.) Fürstenau, Immelmann, Schütze; Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal; Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1919, S. 31 – 2.) Internet-Such
maschine Google
AJR
American Journal of Roentgenology, Fachzeitschrift der > American Roentgen Ray Society.
> Yellow Journal
Akkumulator
Von Raymond Gaston Planté 1860 entwickelter elektrochemischer Apparat, in dem zugeführter elektrischer Strom in den Elektroden eine Energieumwandlung auslöst. Diese Umwandlung der elektrischen Energie in chemische Energie wird als Ladung bezeichnet. Die akkumulierte (gesammelte) Energie kann dann wieder in elektrischen Strom überführt werden (Entladung). Am Anfang des 20. Jahrhunderts besteht das Gefäß im Allgemeinen aus Glas, > Hartgummi, > Celluloid oder mit Blei ausgekleideten Holzkisten. Als Elektrolyt dient verdünnte, chemisch reine Schwefelsäure. Die Elektroden bestehen üblicherweise aus einem Bleikörper mit einer aktiven Masse aus > Bleisuperoxyd (positiver Pol) bzw. > Bleischwamm (negativer Pol). Mehrere solcher Platten bilden eine Zelle, mehrere Zellen miteinander verbunden eine > Batterie.
1.) Reiniger, Gebbert & Schall; Katalog „Elektro-Medizinische Apparate; Erlangen 1897, S. XXXIV, 101 – 2.) Büttner, O.; K. Müller; Encyclopädie der Photographie, Heft 28: Technik und Verwerthung der Röntgen’schen Strahlen im Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft; Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1897, S. 24-39 – 3.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 14-27 (mit Abbildungen) – 4.) Stechow; Das Röntgen-Verfahren mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse; Verlag von August Hirschwald, Berlin 1903, S. 72-76 – 5.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 42 – 6.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Akkumulator, Auswahl und Pflege
Friedrich Dessauer gibt Hinweise zu Auswahl und Pflege von > Akkumulatoren (gekürzt):
Die > Batterie muss, wenn sie lange halten soll, alle 6 Wochen einmal entladen und geladen werden.
Je sanfter die Ladung und Entladung vor sich geht, desto besser ist es für die Batterie. Nichts schädigt die Batterie so sehr, wie die stossweise Ladung und Entladung mit zu starken Strömen.
Peinlichste Sauberkeit! Reine Säure von vorschriftmässiger Dichte.
Beim Transporte sanft mit dem Akkumulator umgehen, ihn nicht zu sehr stossen!
Beim Einkauf die Kapazität nicht zu klein, aber auch nicht zu gross wählen. 18, 25 bis 30 Ampèrestunden sind gebräuchliche mittlere Kapazitäten.
Nicht zu stark überladen. Es ist gut, wenn der Akkumulator so kräftig geladen wird, dass sich gegen Ende der Ladung eine heftige Gasentwicklung zeigt.
Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 163-164
Akkumulatorenbatterie
> Batterie
aktinisches Licht
Chemisch wirksames Licht.
1.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961 – 2.) Kienle, Richard von; Fremdwörterlexikon; 1964
Röntgenaufnahme
1.) Sehrwald, E.; Das Verhalten der Halogene gegen Röntgenstrahlen; Deutsche Medicinische Wochenschrift No. 30, 23.07.1896, S. 477 – 2.) Appunn, F.; Über die Methodik der Photographie mit X-Strahlen zu medizinisch-diagnostischen Zwecken; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen; Bd. 1, 1897/1898, S. 41-51
Anwender der Röntgenstrahlen, Röntgenologe
Röntgenaufnahme, Röntgenaufnahmetechnik
1.) Gocht, Hermann; Röntgographie oder Diagraphie?!; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 138-139 – 2.) Isenthal, A. W.; Snowden Ward, H.; Practical Radiography; Third Edition, Dawborn and Ward Ltd., 1901, S. 13
Eine Röntgenaufnahme erstellen.
Gocht, Hermann; Röntgographie oder Diagraphie?!; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 138-139
Eine mit einer photographischen Emulsion beschichtete Glasplatte.
> Röntgen-Platte
Appunn, F.; Über die Methodik der Photographie mit X-Strahlen zu medizinisch-diagnostischen Zwecken; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen; Bd. 1, 1897/1898, S. 41-51
Messgerät für die Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen, nach dem gleichen Prinzip wie das > Skiameter aufgebaut. „Aktinometer“ wurde oft auch als Oberbegriff für derartige Geräte benutzt.
1.) Gocht, Hermann; Lehrbuch der Röntgen-Untersuchung zum Gebrauche für Mediciner; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1898, S. 47 – 2.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 108 (mit Abbildung) – 3.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913
Aktinoskopie
Röntgendurchleuchtung
1.) Gocht, Hermann; Röntgographie oder Diagraphie?!; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 138-139 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 3.) Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 172
aktinoskopieren
Mit Röntgenstrahlen durchleuchten.
1.) Gocht, Hermann; Röntgographie oder Diagraphie; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 138-139. – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
aktive Kathode
Die > Kathode einer > Bikathoden-Ionen-Röntgenröhre, mit deren Hilfe – im Gegensatz zu deren zweiter („inaktiver“) Kathode – eine Ventilwirkung erzeugt wird.
> Ventilröhre
Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediciner; 5. Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 157-158 (mit Abbildung)
ALARA-Prinzip
(As Low As Reasonably Achievable – so gering wie vernünftigerweise erforderlich), wurde erstmals 1908 durch Viktor Blum formuliert: „Wir haben es uns zur Regel gemacht, die minimalste Dosis wirksamen Röntgenlichtes anzuwenden, die gerade hinreicht, bei einem gewöhnlichen Menschen den gewünschten Erfolg zu zeitigen.“
Blum, Victor; Ein Röntgenschadenersatzprozess; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 12, 1908, S. 186-202
Alaunbad
Bad zur Härtung einer photographischen Emulsion im Anschluss an die Wässerung, um die Emulsion gegen höhere Temperaturen widerstandsfähiger zu machen; Alaun ist ein Doppelsalz aus Kalium- und Aluminiumsulfat.
> Formaldehydbad
Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 272
Albumin ist das Eiweiß frischer Hühnereier, das nach dem Zusatz von Chlor-, Brom- oder Jodsalzen auf ein Trägermaterial (üblicherweise Papier, aber auch Glasplatten) aufgebracht und durch Sensibilisieren mit Silbernitrat lichtempfindlich gemacht wurde. Die Schicht wurde sowohl als Aufnahme- wie als Kopierschicht benutzt.
> Auskopierpapier
1.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 300 – 2.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961 – 3.) Baatz, Willfried; Geschichte der Photographie; DuMont Buchverlag, Köln 2004, S. 30-31
all-seeing light
Vorschlag von Egbert Guernsey um 1896 für > X-Strahlen.
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 171
Alpharöhre
> Ionen-Röntgenröhre nach Josef Rosenthal 1897, erste Röntgenröhre mit massiver metallreicher > Antikathode. Die Röhre besteht aus zwei nebeneinander liegenden Glaskugeln, womit das Volumen der Röhre zur besseren Konstanz des Vakuums vergrößert wird.
1.) Ohne Verfasserangabe; Ausgestellte Gegenstände; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Bd. IV, 1908, S. 167-177 (mit Abbildungen) – 2.) Rosenthal, Josef; Röntgentechnik; Sonderabdruck aus dem „Lehrbuch der Röntgenkunde“, herausgegeben von H. Rieder und J. Rosenthal, Band II, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1918, S. 318-319 (mit Abbildungen)
Ambroin
Elektrisches Isoliermaterial, hergestellt aus halbfossilen Harzen (Kopal), > Glimmer und Asbest. Die Durchschlagfestigkeit beträgt bei
0,34 mm Dicke 5 kV
1.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 2.) Internet-Suchmaschine Google
American Journal of Roentgenology
> The American Journal of Roentgenology
American X-ray Journal
> The American X-Ray Journal
„amerikanische Normalwerte“
> Funkenlänge und Hochspannung, Tabelle 1a
Amidol-Entwickler
Typ eines photographischen Entwicklers der Fa. J. Hauff, Feuerbach/Württ.; Vorteile: schnelle Entwicklung, guter Standentwickler; Nachteile: Schleiergefahr, schlechte Haltbarkeit.
> Schleier, > photographischer Entwickler und > Standentwicklung
1.) Eder, J. M.; Ausführliches Handbuch der Photographie; Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1902, S. 325-326 – 2.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 266-267 – 3.) Anzeige in: Kraft, H., Wiesner, B. (Herausg.); Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik; II. Bd., Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1907, nach S. 90
> Satrap-Schnellfixage
Ammoniumpersulfat-Abschwächer
Chemotechnisches Bad zum > Abschwächen (= Verminderung der Optischen Dichte) von photographischen Bildern. Dieser Abschwächer greift vor allem die höheren Dichten an und wirkt somit kontrastmindernd.
Rezeptbeispiel: 500 cm3 Wasser + 10 g Ammoniumpersulfat + 5 Tropfen konz. Schwefelsäure + 7,5 cm3 1%ige Kochsalzlösung. Das Bad ist nicht haltbar. Bildträger danach 5 bis 10 Minuten im Fixierbad belassen und gründlich wässern.
> abschwächen und > Kaliumpermanganat-Abschwächer
Internet-Suchmaschine Google
Amrheinsche Maximum-Röhre
> Maximum-(Ionen-Röntgen-)Röhre nach Franz Amrhein, Firma > Veifa, Frankfurt/M.-Aschaffenburg, mit einem neuen Kühlprinzip: Mit Hilfe eines Luftgebläses wird Wasser aus einem Gefäß äußerst fein zerstäubt (erhält also die denkbar größte Oberfläche) und durch den Luftstrom mit großer Wucht gegen die Rückwand der hohlen Antikathode geschleudert. Der Wärmeentzug ist gewaltig, die Röntgenröhre kann stark belastet werde, ohne dass die Antikathode erheblich warm wird.
Dessauer, Friedrich; Homogenität und Absorption; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Band 21, 1914, S. 562-569 (mit Abbildung)
Anker
Der Teil maschineller Stromerzeuger, in dem die elektromotorischen Kräfte erzeugt werden.
> Elektromotorische Kraft EMK
1.) Guttmann, Walter; Elektrizitätslehre für Mediziner; Verlag von Georg Thieme, Leipzig 1904, S. 115 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 3.) Graetz, L.; Die Elektrizität und ihre Anwendungen; Verlag von J. Engelhorns Nachf., Stuttgart 1928, S. 432, 459
Anode
Positive Elektrode (z. B. bei > Ionen-Röntgenröhren) oder positiver Pol (z. B. bei > Akkumulatoren)
1.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 78 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Anodenhals
Annähernd zylindrischer (halsförmiger) Teil der ansonsten kugelförmigen > Ionen-Röntgenröhre, der die > Anode enthält.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 96
Anodenlicht
Rötliches Glimmlicht, das beim Anlegen einer elektrischen Spannung an der > Anode von Vakuumröhren mit mäßiger Luftverdünnung (> Gasentladungsröhren) entsteht.
> Kathodenlicht
1.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 2.) Internet-Suchmaschine Google
Anodenstrahlen
Von der > Anode einer > Ionen-Röntgenröhre ausgehende Strahlen mit positiver Ladung.
Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Ansco, ANSCO
Anthony & Scoville Co, unter anderem Hersteller von Röntgenplatten und Röntgenfilmen, gegründet 1901/1907 durch Zusammenschluss von Anthony & Co. und Scovill & Adams, 1928 von Fa. > Agfa übernommen.
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965
anstechen
Bei > Ionen-Röntgenröhren durch > scharf gebündelte > Kathodenstrahlen verursachtes Anschmelzen der Antikathodenfläche.
1.) Klingelfuß, Fr.; Über die Messung der Größe des Brennfleckes und die Bestimmung der zulässigen Belastung bei einer Röntgenröhre; Zeitschrift für Röntgenkunde und Radiumforschung, 14. Band, 1912, S. 124-129 – 2.) Schwenter, J.; Leitfaden der Momentaufnahme im Röntgenverfahren; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1913, S. 18
Anthion
„Fixiersalzzerstörer“ der Fa. Schering, der dem der > Satrap-Schnellfixage nachfolgenden Wässerungsbad zur Abkürzung der Wässerungszeit beigegeben wird.
Gillet, J.; Die ambulatorische Röntgentechnik in Krieg und Frieden; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1909, S. 131-132
Anthroposkop
Apparat nach A. M. Esseltja, 1846, mit dem man in der Lage gewesen sein soll, durch den menschlichen Körper hindurch zu sehen und tief sitzende Krankheiten festzustellen. Über die Konstruktion des Apparates und seine Benutzung ist nichts bekannt.
Glasser, Otto; Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen; Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 3. Auflage 1995
Antikathode
Bei > Ionen-Röntgenröhren: die Elektrode, die der > Kathode – in der Regel unter einem schrägen Winkel – gegenüberliegt und auf der die Röntgenstrahlen entstehen. Beim Auftreffen der > Kathodenstrahlen auf die > Antikathode lädt sich die Antikathode negativ auf. Diese Aufladung wirkt abstoßend auf die nachfolgend auftreffenden Kathodenstrahlen mit der Folge schlechter werdender Bildqualität bis hin zu dem Punkt, an dem keine Röntgenstrahlung mehr erzeugt wird. Um dies zu vermeiden, werden Antikathode und > Anode außerhalb der > Ionen-Röntgenröhre elektrisch verbunden, so dass die an der Antikathode entstehende Ladung durch das an der Anode herrschende positive Potential neutralisiert wird.
Für die Wahl des Antikathodenmaterials ist auf einen hohen Schmelzpunkt zu achten sowie auf eine hohe Atommasse: Je höher die Atommasse, desto höher ist die Ausbeute an Röntgenstrahlen. Platin (Pt) ist sehr gut geeignet, aber auch Iridium (Ir), Tantal (Ta), Wolfram (W) und ähnliche Metalle wurden verwendet:
Material
Schmelzpunkt
Atommasse
Ordnungszahl
Pt
1768° C
195,1 u
78
Ir
2447° C
192,2 u
77
Ta
3020° C
180,9 u
73
W
3422° C
183,8 u
74
> Hilfsanode und > metallreiche Röntgenröhre
1.) Appunn, F.; Über die Methodik der Photographie mit X-Strahlen zu medizinisch-diagnostischen Zwecken; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 1, 1897/1898, S. 43 – 2.) Fürstenau, Robert; Die Technik der Röntgenapparate; Dr. Max Jänicke Verlagsbuchhandlung, Hannover, etwa 1908, S. 48 – 3.) Knox, Robert; Radiography and Radio-Therapeutics; Part 1: Radiography; The Macmillan Company, New York, London 1917, S. 71 (mit Tabelle) – 4.) Rosenthal, Josef; Röntgentechnik; Sonderabdruck aus dem „Lehrbuch der Röntgenkunde“, herausgegeben von H. Rieder und J. Rosenthal, Band II, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1918, S. 332 – 5.) Fürstenau, Immelmann, Schütze; Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal; Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1919, S. 105-106 – 6.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Antikathodenfokus
Andere Bezeichnung für > Brennfleck.
1.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Verlagsbuchhandlung Schulze & Co., Leipzig 1912, S. 276 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, 2. Auflage, Leipzig 1922, S. 563
Antikathodenhals
Annähernd zylindrischer halsförmiger Teil der ansonsten kugelförmigen > Ionen-Röntgenröhre, der die > Antikathode trägt.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 96
Antikathodenkopf
Mit der > Antikathode verbundener, wärmeableitender Körper, teils auch zur Kühlung mit Wasser gefüllter Hohlkörper.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 4. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 216
Antikathodenspiegel
Bei > Ionen-Röntgenröhren die Fläche der > Antikathode, auf die die > Kathodenstrahlen auftreffen und in Röntgenstrahlen umgewandelt werden.
Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Antix-Strahlenschutzstoff
Vermutlich abgeleitet von Anti-X-Strahlen: Strahlenschutzstoff, geliefert von der Fa. Müller (> C. H. F. Müller?) und der Fa. Heinr. Traun & Söhne, Hamburg.
> Müller-Schutzstoff
1.) Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1905, Bd. I, S. 27 – 2.) Wiesner, B.; Zur Bestrahlungstechnik; in: Kraft, H., Wiesner, B. (Herausg.); Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik; II. Bd., Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1907, S. 161-164 – 3.) Albers-Schönberg; Die gasfreien Röhren in der röntgenologischen Praxis; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 24, 1916/1917, S. 423-446 – 4.) Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediciner; 5. Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 524 – 5.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 1, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 247
Öffnung („lichte Weite“) am Eingang und Ausgang von röhrenförmigen Blenden wie z. B. bei > Rohrblenden zur Eingrenzung des Röntgenstrahlenbündels.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 96
Wechselstrom-Röntgenapparat der Fa. Reiniger, Gebbert & Schall (> RGS), Erlangen, ab 1913. Prinzip: Ein umlaufender > Quecksilber-Unterbrecher wird von einem Synchronmotor im Takt der Netzfrequenz angetrieben; der Eisenkern des > Induktors wird in beiden Stromrichtungen im gleichen Sinne magnetisiert. Ab 1924 Verwendung sowohl von > Ionen-Röntgenröhren wie auch von > Hochvakuum-Glühkathodenröhren möglich.
> Unterbrecher und > Gas-Unterbrecher
Siemens-Med-Archiv Erlangen: RGS-Katalog 1913, Prospekt 25 und RGS-Katalog 1919, Prospekt 6 und RGS-Katalog 1922, Prospekt 22
> Quecksilberstrahl-Unterbrecher der Fa. Reiniger, Gebbert & Schall (> RGS), Erlangen. > Unterbrecher und > Gas-Unterbrecher
1.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 2.) Zacher, F.; Zur Entwicklung der Vorrichtungen zur Unterbrechung elektrischer Ströme; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 29, 1922, S. 411-441
Apollo-Trockenplatte
Trockenplatte der Firma Unger & Hoffmann, Dresden.
Internet-Suchmaschine Google
Apps-Unterbrecher
> Platin-Unterbrecher nach Alfred Apps.
Reiniger, Gebbert & Schall; Katalog über Elektromedizinische Apparate; 6. Auflage, Erlangen 1897, S. 150
Arbeitskathode
Bei der > Hochvakuum-Glühkathoden-Röntgenröhre nach Edgar Lilienfeld die mit einer Bohrung versehene kalte > Kathode (> Lochkathode), von der aus die > Kathodenstrahlen zur > Antikathode gelangen.
1.) Koch, F. J.; Die Röntgenröhre nach J. E. Lilienfeld; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 23, 1915/1916, S. 2-8 (mit Abbildung) – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Archives of Clinical Skiagraphy
Erste englische Röntgenfachzeitschrift, gegründet im Mai 1896, im April 1897 umbenannt in Archives of Skiagraphy, im Juli 1897 umbenannt in Archives of the Roentgen Ray, 1915 umbenannt in Archives of Radiology and Electrotherapy, 1924 umbenannt in The British Journal of Radiology (B.A.R.P./B.I.R. Section), 1928 vereint mit The British Journal of Radiology (Röntgen Society Section).
Burrows, E. H.; Pioneers and early Years – A History of British Radiology; Colophon Limited, St. Anna 1986, S. 144-164
Archives of Radiology and Electrotherapy
> Archives of Clinical Skiagraphy
Archives of Skiagraphy
> Archives of Clinical Skiagraphy
Archives of the Roentgen Ray
> Archives of Clinical Skiagraphy
> photographischer Verstärker und > verstärken
Aristopapier
Typ eines > Auskopierpapiers.
Armamentarium
> Röntgeninstrumentarium
1.) Pfahler, George E.; Die Veränderlichkeit des Brennflecks einer Röntgenröhre und eine einfache Methode eine scharf zeichnende Röhre auszuwählen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 18, 1911/1912, S. 340-343 – 2.) RadioGraphics, Monograph Issue: The technical history of radiology; Volume 9, Number 6, November 1989, S. 1239 (mit Abbildungen) – 3.) Internet (www.hbz-nrw.de/)
Armatur
> Anker
arrodierte Antikathode
Im Bereich des > Brennfleckes aufgerauhte > Antikathode.
1.) Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 110 – 2.) dtv-Lexikon; 1971
ARRS
American Roentgen Ray Society, US-amerikanische Röntgengesellschaft, gegründet 1900.
Arrowrot
Eigentlich: Arrow root, Pfeilwurzel, die Wurzel der in Westindien vorkommenden Knollenpflanze maranta arundinacea. Die aus dieser Wurzel gewonnene Stärke ist u. a. Bestandteil einer Lösung zur Kontrolle der Ausfixierung von > photographischen Platten und Filmen: 1 g Arrowrot wird 100 cm3 kochendem destilliertem Wasser zugesetzt, nach dem Erkalten 2,5 cm3 Jodtinktur beigefügt. Bringt man einige Tropfen dieser Lösung in ein Reagenzglas mit dem zu prüfenden Fixier-Waschwasser, färbt sich reines Waschwasser bläulich, bei Vorhandensein von Fixiersalzspuren wird es farblos.
1.) Pierer, H. A. (Herausgeber); Universal-Lexikon oder vollständiges encyclopädisches Wörterbuch; Literatur-Comptoir, Altenburg 1835, S. 238 (Google) – 2.) Gillet, J.; Die ambulatorische Röntgentechnik in Krieg und Frieden; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1909, S. 132 – 3.) Internet (AltaVista)
Arsonvalisation
> d’Arsonvalisation
„Aschaffenburger Richtung“
Die so genannte „Aschaffenburger Richtung“ vertrat die Meinung, dass preisgünstige Röntgeninstrumentarien mit kleinen > Funkenstrecken völlig ausreichend seien; Wortführer: Friedrich Dessauer und Bernhard Wiesner. Im Gegensatz dazu stand die > „Hamburger Richtung“.
Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, 9 ff
Borsäure, die unter der Warenbezeichnung Aseptin für Konservierungszwecke im Handel war.
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 169 – 2.) Merck’s Warenlexikon – Klassische Warenkunde von 1920 (Internet)
Astralschirm
Grüngelb fluoreszierender > Durchleuchtungsschirm, entwickelt von Georg Rupprecht, Hamburg, hergestellt von Reiniger, Gebbert & Schall (> RGS), Erlangen. Leuchtstoff: künstlicher > Willemit; nachleuchtend.
1.) Haenisch; Ein neuer Röntgendurchleuchtungsschirm; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 18, 1911/1912, S. 231 – 2.) Reiniger, Gebbert & Schall; Katalog „Die Röntgenapparate nebst deren Zubehör“; Berlin/Erlangen 1912, S. 53 – 3.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Äther
Nach einer bis Anfang des 20. Jahrhunderts herrschenden Vorstellung mussten Wellen zu ihrer Fortpflanzung stets ein materielles Medium haben, das man Äther nannte. Dieser den ganzen Raum erfüllende feinste Stoff, der nach dieser Vorstellung auch zwischen allen Körpermolekülen eingelagert ist, diente zur Erklärung der Licht-, Wärme- und Elektrizitätserscheinungen. So wurde z. B. angenommen, dass sich das Licht durch wellenförmige Bewegung des Äthers ausbreitet.
> Fluidum, elektrisches
1.) Sehrwald; Das Wesen der Elektricität und Röntgenstrahlen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 1-12 – 2.) Walter, B.; Über die Natur der Röntgenstrahlen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 144-150 – 3.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 151-169 – 4.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 57-69 – 5.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961 – 6.) dtv-Lexikon 1971
Ätzkali
Bei > Reguliervorrichtungen von > Ionen-Röntgenröhren verwendetes Hydroxyd eines Alkalimetalls, das beim Erhitzen Wasserdampf abgibt und diesen bei Abkühlung allmählich wieder resorbiert.
1.) C. H. F. Müller; Ausgestellte Gegenstände; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Bd. IV, 1908, S. 167-169 – 2.) dtv-Lexikon 1971
Aufblasung
> Gelenkaufblasung und > negatives Kontrastmittel
Aufspeicherungsapparat
> Kondensator
Auftreibung
> Gelenkauftreibung
Augenmagnet
Elektromagnet zur Entfernung von Eisensplittern aus Körpergewebe, insbesondere aus dem Auge.
Guttmann, Walter; Elektrizitätslehre für Mediziner; Verlag von Georg Thieme, Leipzig 1904, S. 211-213 (mit Abbildungen)
Lichterscheinung an elektrisch hoch geladenen Körpern, z. B. an einer > Funkenstrecke.
1.) Büttner, O.; K. Müller; Encyclopädie der Photographie, Heft 28: Technik und Verwerthung der Röntgen’schen Strahlen im Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft; Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1897, S. 50 – 2.) Kienle, Richard von; Fremdwörterlexikon; 1964
Auscultation
> Auskultation
Ausdosieren einer Ionen-Röntgenröhre
Messung der Dosis unter definierten Betriebsverhältnissen mit nachfolgender Nutzung der Röntgenröhre unter den gleichen Betriebsbedingungen, jedoch ohne laufende Dosismessung.
1.) Schmidt, H. E.; Röntgentherapie mit geaichter Röhre und ihre Vorzüge gegenüber der Anwendung eines direkten Dosimeters bei jeder einzelnen Bestrahlung; Jahrbuch über Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiet der physikalischen Medizin; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1912, S. 265 ff – 2.) Fürstenau, Immelmann, Schütze; Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal; Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1919, S. 255
Auskopierpapiere
Photographische Papiere, bei denen im Gegensatz zu den photographischen Entwicklungspapieren keine photographische Entwicklung erforderlich ist. Auskopierpapiere (> Albuminpapier, > Aristopapier, > Gelatoidpapier, > Zelloidinpapier u. a.) tragen eine reine Chlorsilberemulsion, die noch lösliche Silbersalze (Silbernitrat, Silbercitrat) enthält.
> Auskopierprozess
1.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 300 – 2.) Borden, W. C.; The Use of the Röntgen Ray by the Medical Department of the United States Army in the War with Spain; Government Printing Office, Washington 1900, S. 98 – 3.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961
Auskopierprozess
Vorgang der Bilderzeugung bei > Auskopierpapieren: Das Auskopierpapier wird in Kontakt mit dem > Negativ, z. B. der Röntgenaufnahme, intensivem (Tages-) Licht ausgesetzt; dabei erfolgt eine Photolyse des Chlorsilbers. Der Auskopierprozess ist beendet, wenn das entstandene metallische Silber ein genügend dichtes Silberbild darstellt. Das nicht zersetzte Chlorsilber wird durch Fixieren entfernt.
1.) Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 300 – 2.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961
Abhorchen des Körpers mit dem Stethoskop zur Diagnostik von Herz-, Lungen- und Abdominalerkrankungen.
Pschyrembel; Klinisches Wörterbuch; 257. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin New York 1994
Ausschaltuhr
> Gochtsche Weckeruhr
äußere Regenerierung
Regenerierung von > Ionen-Röntgenröhren mit Maßnahmen von außen wie:
Erhitzung der Glaswand,
Erhitzung der ganzen Röhre im Trockensterilisator,
feuchte Packung um die Kathode,
Erwärmung von > Ätzkali, Kohle oder > Glimmer, der in einem Rohrfortsatz platziert ist, mit einer Flamme,
Zuführung von Wasserstoff durch > Osmose,
Zuführung von atmosphärischer Luft über ein Ventil
oder Ruhe (Nichtgebrauch) über einige Zeit hinweg.
> Osmose-Regulierung, > Reguliervorrichtung und > Regenerierautomat
Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediciner; 5. Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 126-131
äußere Spule
> Sekundärspule z. B. eines > Induktors.
Autotypie
Drucktechnisches Reproduktionsverfahren für Halbtonbilder (Photographien) mittels einer durch Raster- oder Netzätzung entstandenen Druckplatte.
Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961
A. W. L. Universal Coil
> Induktor nach William Rollins.
Internet-Suchmaschine Google
A-W-L X-Light Tube
Röntgenröhre nach William Rollins, erste Röhre mit gekühlter Anode, gebaut von der Fa. Oelling & Heinze, Boston/Massachusetts.
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 56-57
A-Zahl
Ampèrezahl: der an einem Ampèremeter abgelesene Stromwert.
Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 91
B
1. > Härtegrad der Röntgenstrahlung nach Benoist (> Benoist-Skala)
2. > Dosiseinheit Bordier (B, Teinte I-IV) Bad Kreuznacher Mutterlauge
> Kreuznacher Mutterlauge
Bakelit
Handelsname für eine Reihe von Kunstharzpressstoffen auf der Grundlage von Phenol- und Kresolharzen, deren Röntgenstrahlenabsorption der des Wassers annähernd äquivalent ist. 1907 entwickelt von Leo H. Baekeland.
1.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 2.) dtv-Lexikon 1971
Ballastwiderstand
Ein regulierbarer oder auch unveränderlicher elektrischer Widerstand hoher Ohmzahl, der z. B. Messinstrumenten vorgeschaltet werden kann, um deren Empfindlichkeit zu verringern.
1.) Freund, Leopold; Grundriss der gesammten Radiotherapie; Urban & Schwarzenberg, Berlin/Wien 1903, S. 29 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Balmainsche Leuchtfarbe
Farbe nach William Henry Balmain, die mit > Wismut aktiviertes Calciumsulfid enthält.
1.) Parzer-Mühlbacher, Alfred; Photographische Aufnahmen und Projektion mit Röntgenstrahlen mittelst der Influenz-Elektrisiermaschine; Photographische Bibliothek No. 6, Verlag von Gustav Schmidt, Berlin 1897, S. 26 – 2.) Freund, Leopold; Grundriss der gesammten Radiotherapie; Urban & Schwarzenberg, Wien 1903, S. 407/408 – 3.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 57 – 4.) Mütze, Karl; Foitzik, Leonhard; Krug, Wolfgang; Schreiber, Günter; ABC der Optik; VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1961
Bandkompressorium
Vorrichtung zur Verringerung der zu durchstrahlenden Körperdicke und zur Fixierung des Patienten, bestehend aus einem zwischen Lagerungstisch und Patient liegenden Brett und einem breiten, kräftigen Stoffband, welches über Hebel und Walze soweit festgespannt wird, dass es für den Patienten gerade noch erträglich ist. > Hirschmannscher Gurt und > Kompressorium
Hackenbruch; Berger; Vademekum für die Verwendung der Röntgenstrahlen und des Distraktionsklammer-Verfahrens in und nach dem Kriege; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1915, S. 48-50 (mit Abbildung)
Baradiol
Bariumsulfat-Kontrastmittel nach Carl Bachem, das vor der Anwendung mit Wasser angerührt und aufgekocht wird.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 4. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 604
Bardelebensche Brandbinde
Verbandmaterial zur antiseptischen Wundbehandlung: eine Wismut-Stärke-Binde zur Behandlung von Verbrennungen und Frostbeulen, benannt nach Heinrich Adolf von Bardeleben. 1.) Unna, P. G.; Die chronische Röntgendermatitis der Radiologen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Band 9, 1905/1906, S. 67-91 – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 168 – 3.) Internet-Suchmaschine Google
Bardenheuer-Extension
Angewandt bei unkomplizierten Extremitätenfrakturen, wobei mittels Heftpflasterzügen und Anlegen eines Gewichtszuges eine verbesserte Bruchenden-Einstellung angestrebt wird; benannt nach Bernhard Bardenheuer.
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 3. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910 – 2.) Internet-Suchmaschine Google
Bariumplatincyanür
BaPtC4N4, Leuchtstoff für > Durchleuchtungsschirme, unter Röntgenbestrahlung grün fluoreszierend, wenig nachleuchtend.
1.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 76, 104 – 2.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 64-65 – 3.) Gleßmer-Junike, Simone; X-Strahlen, Radiometer und Hauteinheitsdosis; Dissertation Hamburg 2015, S. 82-88
Baryt hat die chemische Bezeichnung Bariumsulfat BaSO4, hat die Dichte 4,5 g/cm3 und ist Bestandteil sowohl von > Barytgummi wie auch von Kontrastmitteln für Röntgenuntersuchungen, insbesondere des Magens.
> positives Kontrastmittel
Internet-Suchmaschine Google
Strahlenschutzmaterial ähnlich dem > Bleigummi, bestehend aus einer Mischung aus Kautschuk und > Baryt (auch Schwerspat genannt). Internet-Suchmaschine Google
Bathyskopsometer
Hilfsmittel nach Henry K. Wachtel zur Bestimmung der Tiefenlage von in die Wunde eingeführten Marken und deren Lageänderung auf dem > Durchleuchtungsschirm bei Verschiebung des > Fokus.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 2, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 313
Batterie
Vereinigung mehrerer einzelner Stromquellen (beispielsweise > Akkumulatoren, > galvanische Elemente, > Thermoelemente) zu einer gemeinsam wirkenden Stromquelle.
> Primärbatterie und > Sekundärbatterie
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 138 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Bauer-Regulierung
Vorrichtung nach Heinz Bauer zur Regulierung des Vakuums von > Ionen-Röntgenröhren mittels eines tonartigen Materials, das für Luft durchlässig, für Quecksilber undurchlässig ist. In einem Kapillarröhrchensystem wird das Quecksilber per Knopfdruck abgesenkt, über das Tonfilter kann Luft in die Röntgenröhre einströmen, der Druck über der Quecksilbersäule lässt nach, es steigt und verschließt das Tonfilter wieder.
> Reguliervorrichtung
1.) Loose, Gustav; Ein halbes Jahr Bauersche Luft-Fernregulierung; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Band 18, 1911/1912, S. 156-165 (mit Abbildungen) – 2.) Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediciner; 5. Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 130-131 – 3.) Rosenthal, Josef; Röntgentechnik; Sonderabdruck aus dem „Lehrbuch der Röntgenkunde“, herausgegeben von H. Rieder und J. Rosenthal, Band II, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1918, S. 340-341 (mit Abbildungen) – 4.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 1, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 340
Bauer-Skala
> Qualimeter
Bauer-Ventil
> Bauer-Regulierung
Baumé
Eine von Antoine Baumé eingeführte Skala eines Aräometers (Senkwaage), mit dem das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten, z. B. des Elektrolyten eines > Akkumulators, bestimmt werden kann. Das spezifische Gewicht ist entweder direkt ablesbar oder wird in so genannten Baumé-Graden (x° Bé) angezeigt.
1.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 66 – 2.) dtv-Lexikon 1971
Bé
Abkürzung für > Baumé
Beckenflecken
Bei Röntgenuntersuchungen als > Schatten dargestellte Venensteine (Phlebolithen), verkalkte Venenthromben.
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 3. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 502-505 – 2.) Pschyrembel; Klinisches Wörterbuch; 257. Auflage, Walter de Gruyter; Berlin/New York 1994
Beckenhärte
> Strahlenhärte einer > Ionen-Röntgenröhre, die für Beckenaufnahmen geeignet ist.
Walter; Über die Erzeugung harter Röntgenstrahlen zur therapeutischen Bestrahlung innerer Organe; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1907, S. 110-111
Beckenröhre
> Ionen-Röntgenröhre mit einer für Beckenaufnahmen geeigneten Strahlenqualität.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 95
Becquerel’s light
Radiumstrahlung, benannt nach Antoine Henri Becquerel.
Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 171
Beez-Skala
Prüfgerät nach Carl Beez um 1907 zur Härtegrad-Bestimmung von > Ionen-Röntgenröhren (> Schwellenwertskala): Bei einem Bleiblech mit der Ausstanzung „CBEEZ“ ist jeder Buchstabe mit gleich dicken Scheiben verschiedener (nicht genannter) Absorptionsmaterialien hinterlegt. Wird dieses Prüfgerät im Kontakt mit einem Leuchtschirm in den Strahlengang gebracht, so ist aus der Zahl der erkennbaren Buchstaben die Röhrenhärte ablesbar:
Buchstabe Röntgenröhre zu weich,
Buchstaben Röntgenröhre sehr weich,
Buchstaben Röntgenröhre weich,
Buchstaben Röntgenröhre mittelweich,
Buchstaben Röntgenröhre zu hart.
> Skala
1.) Beez, Carl; Ein neuer Härtemesser für Röntgenröhren; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 11, 1907, S. 285-287 – 2.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913
Behandlungsuhr
Uhr, die das Ende der festgelegten therapeutischen > Expositionszeit akustisch und visuell anzeigt.
> Gochtsche Weckeruhr
Freund, Leopold; Grundriss der gesammten Radiotherapie; Urban & Schwarzenberg, Berlin/Wien 1903, S. 187
Beleuchtung
Belichtung, Bestrahlung mit Röntgenstrahlen.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 1, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 200
Beleuchtungszeit
In der Diagnostik: > Belichtungszeit; in der Therapie: Bestrahlungszeit.
Belichtungsschieber
Gleichbedeutend mit > Expositionsmesser.
Belichtungszeiten
Hand:
1896/1897
20“-20‘
1898
10“-60“
1903
10“-30“
1913
0,25“-0,5“
Schädel:
1896/1897
11‘-120‘
1898
2‘-10‘
1903
1‘-3‘
1913
12“-3‘
heute
kleiner 0,1“
Zähne:
1896/1897
--
1898
--
1903
2“-20“
1913
0,1“-25“
Thorax:
1896/1897
10‘-70‘
1898
2‘-10‘
1903
0,15“-1‘
1913
0,1“-20“
heute
kleiner 0,02“
Abdomen:
1896/1897
20‘-55‘
1898
2‘-10‘
1903
--
1913
0,2“-5“
Becken:
1896/1897
10‘-50‘
1898
45“-10‘
1903
30“-2‘
1913
30“-40“
heute
kleiner 0,2“
Knie:
1896/1897
3‘
1898
1‘-3‘
1903
1‘-2‘
1913
6“-2‘
Der technische Fortschritt innerhalb weniger Jahre ist offensichtlich. Die Bandbreite der Belichtungszeiten erklärt sich aus dem unterschiedlichen Stand der Technik in einzelnen Röntgenabteilungen.
> Bewegungsunschärfe, > Widerstandstabelle
Kütterer, Gerhard; Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe, den Menschen durchsichtig zu machen wie eine Qualle!; Books on Demand, Norderstedt 2005, S. 195
Benoist-Skala
Prüfmethode nach Louis Benoist 1901 zur Härtegrad-Bestimmung von > Ionen-Röntgenröhren (> zweimetallige Härteskala): Um ein kreisförmiges Silberblech von 0,11 mm Dicke herum sind 12 Aluminiumschichten von 1 mm bis 12 mm Dicke in 1 mm-Abstufungen angebracht, verbunden mit einem > Leuchtschirm. Die Aluminiumdicke gleicher Helligkeit mit dem Mittelfeld ergibt die Kennzahl des > Härtegrades. Diese Kennzahl wird mitunter auch in Gradform ausgedrückt (das 8. Feld wird dann mit 8° bezeichnet).
> Radiochromometer, > Skala, > Härtemesser
1.) Wetterer, Josef; Ein radiotherapeutischer Versuch bei einem Falle von Arthritis deformans; in: Kraft, H.; Wiesner, B. (Herausg.); Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik; II. Bd., Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1907, S. 210-215 – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 100 (mit Abbildung) – 3.) Großmann, Gustav; Einführung in die Röntgentechnik – Verfaßt für die Teilnehmer der Röntgenkurse der Siemens & Halske A.-G.; 1912 – 4.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913
Benoist-Walter-Skala
Prüfmethode nach Louis Benoist mit einer Modifikation von Bernhard Walter 1902 zur Härtegrad-Bestimmung von > Ionen-Röntgenröhren (> zweimetallige Härteskala): Um ein kreisförmiges Silberblech von 0,11 mm Dicke sind 6 Aluminiumbleche der Dicken 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,4 / 6,0 und 8,0 mm angeordnet, die den 6 Härtestufen der Benoist-Walter-Skala entsprechen. Die Aluminiumdicke gleicher Helligkeit wie das Mittelfeld ergibt die Kennzahl des > Härtegrades.
Vergleichswerte nach Literaturquelle 2:
B
2,0
2,4
3,2
4,4
6
8
BW
1
2
3
4
5
6
Wh
2
4
6
8
10
12
FL [cm]
2
4
8
12
16
22
Andere Quellen geben teils andere Zahlenwerte an, dies ist vermutlich auf Messunsicherheiten zurückzuführen.
> Radiochromometer und > Skala
1.) Albers-Schönberg, H.; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1903, S. 32-38 – 2.) Kienböck, Robert; Radiotherapie; Heft 6 der Reihe „Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen“, herausgegeben von J. Marcuse und A. Strasser; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1907, S. 46-50 – 3.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 100-104 – 4.) Großmann, Gustav; Einführung in die Röntgentechnik – Verfaßt für die Teilnehmer der Röntgenkurse der Siemens & Halske A.-G.; 1912 – 5.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, Seite 14-15
Benzindynamo
Maschinensatz, der aus einem Benzinmotor mit direkt gekoppelter Dynamomaschine (Gleichstromgenerator) besteht.
Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Benzinkerze
Eine mit Petroleum-Benzin (Leichtbenzin) gespeiste und mit einem runden, verstellbaren Baumwolldocht versehene Lampe mit regulierbarer Flammenhöhe, die in der Frühzeit der Sensitometrie als Lichtquelle für Sensitometer und als Vergleichsflamme für photometrische Zwecke benutzt wurde.
Die Lichtmenge 1 „Benzinkerze“ entspricht 0,0758 > Hefnerkerzen.
1.) Eder, J. M.; Ausführliches Handbuch der Photographie; Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1902, S. 209, 231 – 2.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 63 – 3.) Internet-Suchmaschine Google
Beobachtungskasten
Schaukasten zur Röntgenfilmbetrachtung.
Großmann, Gustav; Einführung in die Röntgentechnik – Verfaßt für die Teilnehmer der Röntgenkurse der Siemens & Halske A.-G.; 1912, S. 125 (mit Abbildung)
Bergonié-Skala
Messgerät nach Jean A. Bergonié 1907 zur indirekten Bestimmung des > Härtegrades der Röntgenstrahlung ähnlich dem > Sklerometer. Prinzip: Spannungsmessung auf der Sekundärseite des > Induktors mit einem elektrostatischen Voltmeter; konnte sich in der Praxis nicht durchsetzen.
> Skala
1.) Christen, Th.; Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 21-22, 29-30 – 2. ) Gleßmer-Junike, Simone; X-Strahlen, Radiometer und Hauteinheitsdosis; Dissertation Hamburg 2015, S. 52-55 (mit Abbildungen)
Beryllium-Fenster
Bei einer > Ionen-Röntgenröhre im Bereich des medizinisch genutzten Röntgenstrahlenaustrittes mitunter eingesetztes, besonders strahlendurchlässiges Fenster aus Beryllium. Damit sollten die anfangs sehr langen > Belichtungszeiten reduziert werden.
> Lindemann-Fenster und > Lindemann-Glas Internet-Suchmaschine Google
Beschleuniger (photographischer)
Zusätze (z. B. Natriumsulfit, verschiedene Karbonate, Hydroxyde) zu photographischen Entwicklern, die den Entwicklungsprozess fördern; verwendet vorzugsweise bei unterexponierten > photographischen Platten.
Dessauer, F.; B. Wiesner; Kompendium der Röntgenographie; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1905, S. 230
Bestrahler
Ärztliches und technisches Personal, das die Röntgenbestrahlung durchführt.
Flaskamp; Röntgenschädigungen an Bestrahlern und Bestrahlten und ihre zivil- und strafrechtlichen Folgen; Verhandlungen der Deutschen Röntgen-Gesellschaft, Band XIII, 1923
Bestrahlungsjournal
> Röntgenjournal
Bestrahlungskonzentrator
Strahlentherapiegerät nach Richard Werner um 1905, bei dem mit mehreren auf einem Kreisbogen verschieblichen Röntgenröhren unter verschiedenen Winkeln bestrahlt wird, um die Strahlungsenergie bei möglichst geringer Hautbelastung im Kreuzungspunkt der Strahlen zu konzentrieren. Vorläufer der späteren Pendelbestrahlung; Hersteller: Fa. Kohl, Chemnitz.
Werner, R.; Ein Bestrahlungskonzentrator für Röntgentherapie; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Bd. III, 1907, S. 114-118
Bestrahlungskur
Folge von einzelnen therapeutischen Röntgenbestrahlungen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes.
Albers-Schönberg; Seeger; Lasser; Das Röntgenhaus des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg-Hamburg, errichtet 1914/1915; Verlag von F. Leineweber, Leipzig 1915, S. 36
Betaröhre
> Ionen-Röntgenröhre nach Josef Rosenthal, Weiterentwicklung der > Alpharöhre; mit > Reguliervorrichtung.
Ohne Verfasserangabe; Ausgestellte Gegenstände; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Bd. IV, 1908, S. 167-177 (mit Abbildungen)
Beugung der Röntgenstrahlen
Durch Beugung der Röntgenstrahlen am Kristallgitter der > Zinkblende gelang Max v. Laue, Walter Friedrich und Paul Knipping 1912 der experimentelle Nachweis der Wellennatur der Röntgenstrahlen.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 1, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 70-71
Beutelelement
> Galvanisches Element, bei welchem die Kohle-Elektrode mit einem Leinenbeutel umgeben ist, der eine Mischung aus Braunsteinpulver (> Braunstein) und Graphitpulver enthält. Der Braunstein dient als Depolarisationsmittel, der Kohlestab bildet den positiven, der den Braunsteinbeutel umgebende Zinkzylinder den negativen Pol. Erregungsflüssigkeit ist eine gesättigte Salmiaklösung (Ammoniumchlorid); die Klemmenspannung eines Elementes beträgt ca. 1,5-1,54 Volt.
1.) Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediciner; 5. Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 23 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Bewegungsunschärfe
Bei den extrem langen > Belichtungszeiten von Röntgenaufnahmen in den ersten Jahren der Röntgentechnik ist alleine die Bewegungsamplitude A0 der Organe für die Bewegungsunschärfe UB im Röntgenbild verantwortlich:
wobei
Bei heutigen Röntgenaufnahmen wird die Bewegungsunschärfe UB durch die Objektgeschwindigkeit v und die Belichtungszeit tB bestimmt:
wobei
Kütterer, Gerhard; Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe, den Menschen durchsichtig zu machen wie eine Qualle!; Books on Demand, Norderstedt 2005, S. 191
saugfähig, feuchtigkeitsspeichernd
1.) Gottschalk; Demonstration eines Gehirntumors (alveoläres Sarkom), welcher 6 Monate vor dem Tode durch Röntgenographie sicher diagnostiziert worden war; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg, Bd. III/1907, S. 92-95 – 2.) Persönliche Mitteilung von Martin Kluge, Papiermuseum Basel
Bikathodenröhre
Typ einer > Ionen-Röntgenröhre, von den Firmen > Emil Gundelach, Gehlberg/Thüringen, > C. H. F. Müller, Hamburg und > Koch & Sterzel, Dresden, hergestellt. Eine integrierte zweite > Kathode verleiht der Röntgenröhre Ventilcharakter.
1.) Koch, F. J.; Sterzel, K. A.; Über „schließungslichtfreie“ Röntgenröhren; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 8, 1904/1905, S. 271-275 – 2.) Fürstenau, Robert; Die Technik der Röntgenapparate; Dr. Max Jänicke Verlagsbuchhandlung, Hannover, etwa 1908, S. 75 (mit Abbildung) – 3.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 213-214 – 4.) Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 157
Billroth-Batist
Wasserdichter Baumwoll-Verbandstoff, mit fettsaurem Blei durchtränkt, steril, benannt nach Theodor Billroth.
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 345 – 2.) dtv-Lexikon; 1971 – 3.) Zetkin-Schaldach; Wörterbuch der Medizin; VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin 1975 – 3.) Internet-Suchmaschine Google
Bimsstein (althochdeutsch pumiz aus lat. pūmex)
Schwammig oder schaumig aussehendes Gestein, entstanden beim Hindurchströmen von Gasen und Dämpfen durch flüssige Lava. In der Frühzeit der Röntgentechnik verwendet zum Abreiben warziger Hautverdickungen als Folge von Strahlenschädigungen.
dtv-Lexikon 1971
Röntgenaufnahme
1.) Levy, Max; Über Abkürzung der Expositionszeit bei Aufnahmen mit Röntgenstrahlen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, 1. Bd., 1897/1898, S. 75-82 – 2.) Gocht, Hermann; Röntgographie oder Diagraphie?!; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 2, 1898/1899, S. 138-139
biologische Dosis
> wirksame Dosis
biologischer Faktor
Nach Bernhard Krönig und Walter Friedrich die Zahl, die angibt, um wie viel mal stärker eine Strahlenart biologisch wirksam ist als eine andere Strahlenart bei gleicher Dosis. Zur Festlegung dieses Faktors dienen als Vergleichsstrahlenart stets die mit 1 mm Kupfer gefilterten Röntgenstrahlen.
Krönig, Bernhard; Friedrich, Walter; Physikalische und biologische Grundlagen der Strahlentherapie; Urban & Schwarzenberg, Berlin/Wien 1918, S. 166
Serienaufnahmegerät nach Karl Kästle, Hermann Rieder und Josef Rosenthal, Vorläufer eines > Röntgenkinematographie-Gerätes: Größe der > photographischen Platten: 24 cm x 30 cm, max. 18 Aufnahmen möglich.
1.) Schwenter, J.; Leitfaden der Momentaufnahme im Röntgenverfahren; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1913, S. 89-91 (mit Abbildung) – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 4. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 711 – 3.) Rosenthal, Josef; Röntgentechnik; Sonderabdruck aus dem „Lehrbuch der Röntgenkunde“, herausgegeben von H. Rieder und J. Rosenthal, Band II, Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1918, S. 378-379 (mit Abbildung)
Bioröntgenographie
1. Verfahren von Karl Kästle, Hermann Rieder und Josef Rosenthal 1909 ähnlich dem der späteren > Polygraphie, um die Bewegung eines Objektes durch aufeinanderfolgende > Momentaufnahmen auf einem Film zu erfassen.
> Bioröntgenograph
2. Serienaufnahmetechnik, Vorläufer der Röntgenkinematographie.
Schwenter, J.; Leitfaden der Momentaufnahme im Röntgenverfahren; Otto Nemnich Verlag, Leipzig 1913, S. 90
Bioskopie
Röntgendurchleuchtung
1.) Rosenfeld, Georg; Die Diagnostik innerer Krankheiten mittels Röntgenstrahlen; Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1897, S. 15, 53-61 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
bioskopisches Bild
Durchleuchtungsbild
> Bioskopie
Rosenfeld, Georg; Die Diagnostik innerer Krankheiten mittels Röntgenstrahlen; Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1897, S. 53-61
Birne
Umgangssprachliche Bezeichnung für eine > Ionen-Röntgenröhre.
1.) Büttner, O.; K. Müller; Encyclopädie der Photographie, Heft 28: Technik und Verwerthung der Röntgen’schen Strahlen im Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft; Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1897, S. 58, 62 – 2.) Gocht, H.; Lehrbuch der Röntgen-Untersuchung zum Gebrauche für Mediciner; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1898, S. 48
Bismuthmahlzeit
Gleichbedeutend mit > Wismutmahlzeit.
Bismut, Bismuth, Bismutum
> Wismut
black light
Auch > invisible light genannt: Röntgenstrahlen (= „schwarzes“ bzw. „unsichtbares“ Licht).
1.) Morton, William J.; Edwin W. Hammer; The X Ray or Photography of the Invisible and its Value in Surgery; American Technical Book Co., New York 1896, S. 103 – 2.) Grigg, Emanuel Radu Newman; The Trail of the Invisible Light – From X-Strahlen to Radio(bio)logy; Charles C. Thomas Publisher, Springfield/Illinois, USA; 1965, S. 171
Blaugas
Ein nach dem Chemiker Hermann Blau benanntes Gemisch gasförmiger Kohlenwasserstoffe, das sich unter Druck ohne Anwendung von Kälte verflüssigen lässt. Blaugas fand auch in > Gas-Unterbrechern Verwendung.
1.) Grashey, Rudolf; Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Weltkriege 1914/1918, Bd. IX: Röntgenologie; Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1922, S. 19 – 2.) dtv-Lexikon 1971
Blaupapier
> Eisenblaupapier
blausaures Eisenpapier
> Eisenblaupapier
Blaustift
Auch als Kopierstift oder Tintenstift bezeichnet: Stift, dessen Mine wasserlösliche Teerfarbstoffe enthält.
1.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende; 2. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906, S. 231, 237, 249 – 2.) dtv-Lexikon 1971
Blauverfahren
Positiv-Kopierverfahren auf > Eisenblaupapier: Das Papier wird Schicht auf Schicht mit der entwickelten > photographischen Platte in Kontakt gebracht und 3 bis 20 Minuten lang dem Sonnenlicht ausgesetzt. Danach wird die Kopie gewässert, eine Fixierung ist nicht erforderlich. Ein zehnminütiges Bad in einer zweiprozentigen Salzsäurelösung intensiviert die blaue Farbe. Trocken und dunkel aufbewahrt beträgt die Lebensdauer einige Monate.
> Positiv
1.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 147-148 – 2.) Fürstenau, Immelmann, Schütze; Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1919, S. 352-353
Bleiakkumulator
> Akkumulator
Lochblende aus Blei zur Begrenzung des Röntgenstrahlenbündels.
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1903, S. 60, 74
Bleiglas
Stark bleioxidhaltiges Glas, verwendet als Strahlenschutzmaterial sowie bei > Ionen-Röntgenröhren im Einschmelzbereich der Platinelektroden, da beide Materialien einen annähernd gleichen Wärmedehnungskoeffizienten haben. Beispiel für die chemische Zusammensetzung eines von der Glashütte > Emil Gundelach hergestellten Bleiglases (Angaben in Gewichts-Prozenten): 54,1 % SiO2, 8,7 % K2O (Pottasche), 2 % Na2O und 35,2 % PbO.
> Bleiglasblende
1.) Fürstenau, Robert; Die Technik der Röntgenapparate; Dr. Max Jänicke Verlagsbuchhandlung, Hannover, etwa 1908, S. 81 – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 3. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 359 – 3.) Hübscher, Martin; Thüringer Glas – Werkstoff der ersten Röntgenröhren; in: 100 Jahre Röntgenstrahlen – Thüringer Beiträge; Herausgeber Technische Universität Ilmenau et al., 1995 – 4.) Internet-Enzyklopädie Wikipedia
Bleiglasblende
Halbkugelförmige, aus stark bleioxidhaltigem Glas bestehende Abdeckung für die > Ionen-Röntgenröhre mit einer Öffnung im Bereich des Strahlenaustritts. Die Blende wird mit Lederriemen an der Röhre befestigt.
1.) Heber, Georg; Zickel, Georg; Elektrotherapie; Verlag Dr. Walter Rothschild, Berlin und Leipzig 1906, S. 234-235 (mit Abbildung) – 2.) Fürstenau, Robert; Die Technik der Röntgenapparate; Dr. Max Jänicke Verlagsbuchhandlung, Hannover, etwa 1908, S. 112 – 3.) Göcke, C.; Erfahrungen mit einer neuen Röntgentherapieröhre mit Kompressionsluftkühlung; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 21, 1914, S. 440 ff (mit Abbildung) – 4.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
> Spekulum
Bleiglätte
Blei(II)-oxid PbO mit 92,8 % Blei und 7,2 % Sauerstoff, in der Röntgentechnik als Strahlenschutzmaterial verwendet.
1.) Donath, B.; Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch; Verlag von Reuther & Reichard, Berlin 1899, S. 15 – 2.) Wichmann; Demonstration einer Röntgenröhre für Therapie und Aufnahmezwecke; Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1905, S. 156 – 3.) www.kremer-pigmente.de
Bleigummi
Strahlenschutzmaterial, bestehend aus einer Mischung aus Kautschuk und Bleioxidpulver. Bleioxid PbO hat die Dichte 9,53 g/cm3.
1.) Gocht, Hermann; Handbuch der Röntgen-Lehre zum Gebrauche für Mediciner; 5. Auflage, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1918, S. 524 – 2.) Internet-Suchmaschine Google
Bleikabel
Elektrisches (Hochspannungs-)Kabel, bei dem die isolierten Leitungsdrähte auf der ganzen Länge mit Werg, Pech o. ä. isoliert sind und – vornehmlich zum Schutz gegen Feuchtigkeit – mit einem Bleimantel umgeben sind.
> Panzerkabel
1.) Rosenfeld, Georg; Die Diagnostik innerer Krankheiten mittels Röntgenstrahlen; Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1897, S. 73 – 2.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage
Bleikammer
Gleichbedeutend mit > Bleikiste.
Bleikiste
Um etwa 1897 strahlenabsorbierendes Gehäuse nach Bernhard Walter zum Schutz der > photographischen Platte und der Umgebung des Patienten gegen Streustrahlen aus dem Patienten: zur Patientenliege hin offene Kiste von etwa 80 cm Länge, 60 cm Breite und 30 cm Höhe zur Abdeckung des Patienten, mit Öffnungen für die darüber hinaus ragenden Körperteile und für den Strahleneintritt (zur Begrenzung des Strahlenbündels), mit 2 mm dickem Blei ausgeschlagen.
1.) Walter, B.; Physikalisch-Technische Mitteilungen; Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 1, 1897/1898, S. 82-87 – 2.) Gocht, Hermann; Lehrbuch der Röntgen-Untersuchung zum Gebrauche für Mediciner; Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1898, S. 53 – 3.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1903, S.140, 217, 221
Bleikistenblende
Geschlossenes Strahlenschutzgehäuse für die > Ionen-Röntgenröhre, mit integrierter Primärblende für den austretenden Röntgenstrahl, ab etwa 1903.
1.) Albers-Schönberg, H.; Die Röntgentechnik; Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1903, S. 215 – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 4. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913, S. 236
Bleikisten-Orthoröntgenograph
Gerät nach Heinrich Albers-Schönberg, bestehend aus der > Bleikistenblende, einer Spaltblende und der Zeichenvorrichtung eines
> Orthoröntgenographen.
> Spaltblendenverfahren
Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 3. Auflage, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910, S. 607-609 (mit Abbildung)
Bleischwamm
Hochporöses Blei mit schwammartiger, flächenvergrößernder Oberfläche, das den Hauptbestandteil der negativen Akkumulatorenelektroden bildet.
1.) Büttner, O.; K. Müller; Encyclopädie der Photographie, Heft 28: Technik und Verwerthung der Röntgen’schen Strahlen im Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft; Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1897, S. 24-39 – 2.) Albers-Schönberg; Die Röntgentechnik; 5. Auflage, Bd. 1, Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1919, S. 148-151 – 3.) Heber, Georg; Elektro-Auskunftei – Erklärendes Wörterbuch; Paul Schulze Verlag, Leipzig 1922, 2. Auflage – 4.) Internet-Suchmaschine Google
Bleisuperoxyd
Chemische Verbindung des Bleis mit Sauerstoff (Pb O2), von dunkelbrauner Farbe, bildet den Hauptbestandteil der positiven Akkumulatorenplatten.