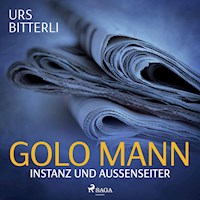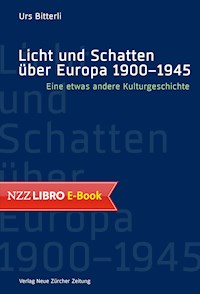
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Urs Bitterli legt eine innovative Darstellung der europäischen Kulturgeschichte im Zeitraum von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor. Er erzählt dabei den Geschichtsverlauf nicht in der üblichen Art nach, sondern stellt ihn durch 50 wichtige und zum Zeitpunkt ihres Erscheinens repräsentative Bücher vor. Besprochen werden Titel wie «Betrachtungen eines Unpolitischen» von Thomas Mann, «Brave New World» von Aldous Huxley, «Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert oder «Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen » von Hannah Arendt. Die Werke entstammen der europäischen Literatur, deren Autoren und Inhalte werden auf wenigen Seiten prägnant vorgestellt und ihre Wirkung beurteilt. Unterteilt ist das Buch in acht Hauptkapitel, die durch je einen kurzen, aber informativen Überblickstext eingeführt werden. Vertieft geht Urs Bitterli auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg, auf die Zwischenkriegszeit und auf den Holocaust ein. So entsteht für den an Geschichte und Belletristik interessierten Laien eine äusserst anregende Kulturgeschichte, die spannende Zusammenhänge aufzeigt und Lust auf weitere Lektüre macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Urs Bitterli
Licht und Schatten über Europa 1900–1945
Eine etwas andere Kulturgeschichte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
© 2016 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2016 (ISBN 978-3-03810-151-2)
Lektorat: Ulrike Ebenritter, Giessen
Titelgestaltung: GYSIN [Konzept+Gestaltung], Chur
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-210-6
www.nzz-libro.ch
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Impressum
Inhalt
Einleitung
I Die Jahrhundertwende
1. John Galsworthy, The Forsyte Saga (1906 – 1921) – Deutsch: Die Forsyte Saga (1925)
2. Heinrich Mann, Professor Unrat (1905)
3. Émile Zola, «J’accuse» (1898) – Deutsch: «Ich klage an» (1898)
4. Maxim Gorki, Matj (1906) – Deutsch: Die Mutter (1907)
5. Peter Rosegger, Als ich noch der Waldbauernbub war (1900 – 1902)
6. Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905)
II Der Grosse Krieg
7. Norman Angell, The Great Illusion (1910) – Deutsch: Die falsche Rechnung (1913)
8. Ivo Andrić, Na Drini ćuprija (1945) – Deutsch: Die Brücke über die Drina (1953)
9. Romain Rolland, «Au-dessus de la mêlée» (1914) – Deutsch: «Über dem Getümmel» (1919)
10. Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen (1918)
11. Henri Barbusse, Le Feu (1916) – Deutsch: Das Feuer (1918)
12. Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues (1929)
13. Joseph Roth, Radetzkymarsch (1932)
14. Meinrad Inglin, Schweizerspiegel (1938)
III Kulturpessimismus
15. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1918 – 1922)
16. Paul Valéry, «La crise de l’esprit» (1919) – Deutsch: «Die Krise des Geistes» (1956)
17. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1929) – Deutsch: Der Aufstand der Massen (1931)
IV Ferne Welten
18. Joseph Conrad, Heart of Darkness (1899) – Deutsch: Herz der Finsternis (1926)
19. Pierre Loti, Les Désenchantées (1906) – Deutsch: Die Entzauberten (1912)
20. Thomas Edward Lawrence, The Seven Pillars of Wisdom (1926) – Deutsch: Die sieben Säulen der Weisheit (1936)
21. André Malraux, Les Conquérants (1928) – Deutsch: Die Eroberer (1929)
22. Hans Grimm, Volk ohne Raum (1926)
V Die zerrissenen Jahre
23. Julien Benda, La Trahison des clercs (1927) – Deutsch: Der Verrat der Intellektuellen (1927)
24. Hans Fallada, Kleiner Mann – was nun? (1932)
25. Aldous Huxley, Brave New World (1932) – Deutsch: Welt – wohin? (später: Schöne neue Welt) (1932)
26. David Herbert Lawrence, Lady Chatterley’s Lover (1928) – Deutsch: Lady Chatterley und ihr Liebhaber (später: Lady Chatterleys Liebhaber) (1930)
27. Hermann Hesse, Der Steppenwolf (1927)
28. Jean-Paul Sartre, La Nausée (1938) – Deutsch: Der Ekel (1949)
29. Knut Hamsun, Siste Kapitel (1923) – Deutsch: Das letzte Kapitel (1924)
VI Aufziehendes Gewitter
30. Ignazio Silone, Fontamara (1947) – Deutsch: Fontamara (1933)
31. George Orwell, Homage to Catalonia (1938) – Deutsch: Mein Katalonien (1964)
32. Curzio Malaparte, Technique du coup d’État (1931) – Deutsch: Die Technik des Staatsstreichs (1931)
33. Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin (1939) – Deutsch: Leb wohl, Berlin (1949)
34. Bertrand Russell, Which Way to Peace? (1936) – (Nicht übersetzt)
35. Johan Huizinga, In de schaduwen van morgen (1935) – Deutsch: Im Schatten von morgen (1935)
VII Nochmals Krieg
36. Ernst Jünger, Strahlungen (1949)
37. Vercors, Le Silence de la mer (1942) – Deutsch: Das Schweigen des Meeres (1945)
38. Wassili Grossman, Zhizn’ i sud’ba (1988) – Französisch: Vie et Destin (1980) – Deutsch: Leben und Schicksal (1984)
39. Peter Bamm, Die unsichtbare Flagge (1952)
40. Hans Erich Nossack, Der Untergang (1948)
41. Wolfgang Borchert, Draussen vor der Tür (1947)
42. Max Frisch, Tagebuch 1946–1949 (1950)
43. Albert Camus, La Peste (1947) – Deutsch: Die Pest (1948)
44. Graham Greene, The Quiet American (1955) – Deutsch: Der stille Amerikaner (1956)
VIII Völkermord
45. Jurek Becker, Jakob der Lügner (1969)
46. Primo Levi, Se questo è un uomo (1947) – Deutsch: Ist das ein Mensch? (1961)
47. Wladyslaw Szpilman, Śmierć miasta (1946) – Deutsch: Das wunderbare Überleben. Warschauer Erinnerungen (1998)
48. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil (1963) – Deutsch: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen (1964)
49. Arthur Koestler, Darkness at Noon (1940) – Deutsch: Sonnenfinsternis (1946)
50. Alexander Solschenizyn, Odin den’ Ivana Denisovicha (1962) – Deutsch: Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch (1962)
Dank
Editorische Notiz
Personenregister
Einleitung
Nie zuvor in der Weltgeschichte hat der Mensch in einem kurzen Zeitraum so viel Gutes geleistet und so viel Schlimmes angerichtet wie zwischen 1900 und 1945. Im Jahr 1900 fand die Pariser Weltausstellung statt. Europa zeigte sich selbst und der Welt voller Stolz die wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften einer voranschreitenden Zivilisation. Die Ausstellung wurde zum Symbol ungetrübter Fortschrittsgläubigkeit. Der alte Kontinent sah sich an der Spitze eines Modernisierungsprozesses, der das Leben des Menschen sicherer, bequemer und glücklicher zu machen versprach. Ja, man glaubte sogar, dass sich nicht nur die Lebensumstände, sondern auch die Menschen selbst verbessern liessen.
14Jahre später zerfleischte sich Europa in einem unsinnigen Bruderkrieg. Völker, die eben noch im friedlichen Handelsverkehr gestanden hatten, wandten sich gegeneinander, um ihre Träume von nationaler Grösse zu verwirklichen. Zu Land, zu Wasser und in der Luft bekämpfte man sich mit den mörderischen Waffen, die der technische Fortschritt bereitgestellt hatte. Es war ein Krieg, an dem sich selbst die Sieger nicht zu freuen vermochten – zu hoch war die Zahl der Menschenopfer, und zu verheerend waren die Zerstörungen. So schlimm war diese Erfahrung, dass man hoffte, sie würde sich nie mehr wiederholen. Es sei, schrieb damals der englische Schriftsteller H. G. Wells, «der Krieg, der alle Kriege beendet». Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Versailler Friedensverträge zielten nicht auf Versöhnung ab und trugen den Keim künftiger Konflikte bereits in sich.
Die Zwischenkriegszeit brachte für die meisten europäischen Länder eine Periode sozialer Unrast, wirtschaftlicher Krisen und politischer Verunsicherung. Wenn der amerikanische Präsident Woodrow Wilson 1917 gehofft hatte, der Kriegseintritt der USA würde dazu führen, der Demokratie in Europa den Weg zu ebnen, täuschte er sich. In vielen europäischen Ländern funktionierte die parlamentarische Demokratie schlecht, und die sozialen Reformen, die der industrielle Wandel erforderte, schritten nur langsam voran. In Russland herrschte eine kommunistische Diktatur, und in Italien, Spanien und Deutschland drängten Faschisten und Nationalsozialisten zur Macht.
In auffallendem Gegensatz zur sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung stand die ausserordentliche kulturelle Blüte der Zwischenkriegszeit. Die Leistungen auf den Gebieten der Technik und der Wissenschaften setzten sich fort. Fortschritte in Medizin und Hygiene erhöhten die Lebenserwartung. Wichtige technische Errungenschaften wie Automobil, Telefon, Radio oder Grammofon fanden bald weite Verbreitung. Man übertreibt nicht, wenn man feststellt, dass alles, was das Leben des heutigen Menschen vor der digitalen Revolution erleichtert, bereichert und zuweilen auch kompliziert hat, zwischen 1900 und 1945 erfunden oder entscheidend perfektioniert worden ist. Selbst das Fernsehen geht in seinen Anfängen auf diese Zeit zurück.
Nicht weniger spektakulär waren die Leistungen auf den Gebieten von Literatur, bildender Kunst oder Musik. Der Krieg hatte die geistigen Kräfte der Menschen absorbiert und gelähmt; das Kriegsende aber setzte eine Flutwelle kreativer Energie frei. Das Bedürfnis, sich zu verwirklichen, führte zu originellen und exzentrischen Ergebnissen. Traditionen verloren ihre Verbindlichkeit, moralische Normen wurden verletzt, sexuelle Tabus wurden missachtet. Neu und von weitreichender Konsequenz war, dass die Kultur, einst Privileg des Bürgertums, dank Presse, Radio, Film und Werbung eine grössere Breitenwirkung erzielte und propagandistisch eingesetzt werden konnte. Der Vielfalt und dem Reichtum des kulturellen Angebots kamen die Neugier und Genusssucht eines urbanen Massenpublikums entgegen, das die Sorgen des Alltags zu vergessen suchte. Verkürzte Arbeitszeiten und bezahlte Ferien ermöglichten eine neuartige Gestaltung der Freizeit. Der Sport begann, seine wichtige Rolle zu spielen. Der Kultur der Zwischenkriegszeit haftete jedoch viel Fragwürdiges, Widersprüchliches und Gewalttätiges an, und bei allem rauschhaften Überschwang war ein pessimistisches Endzeitbewusstsein weitverbreitet. Zeitkritischen Kommentatoren wie dem englischen Historiker Eric Hobsbawm entging das nicht. «Wir fuhren auf der ‹Titanic›», schreibt Hobsbawm, «und jeder wusste, dass sie den Eisberg rammen würde. Das einzig Ungewisse daran war, was passieren würde, wenn es so weit war.»
Die kulturelle Blüte der Zwischenkriegszeit endete mit der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs durch Adolf Hitler. Der neue Krieg war nicht nur eine politische, sondern auch eine ideologische Auseinandersetzung. Mit der kriegerischen Machterweiterung verband sich der gezielte Völkermord an den Juden. Auch der Zweite Weltkrieg griff auf die Leistungen von Wissenschaft und Technik zurück. Er erhielt mit dem Luftkrieg eine neue schreckliche Dimension und gipfelte im Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Das Jahr 1945 bezeichnet eine tiefe Zäsur. Europa hatte sein humanistisches Erbe verraten, seine Weltstellung verloren und seine kulturelle Leitfunktion eingebüsst.
Mit diesem Buch möchte ich Leserinnen und Leser einladen, mich auf einem ungewohnten Weg durch diese wichtige Periode der europäischen Kulturgeschichte zu begleiten. Ich biete keine Darstellung, die den Geschichtsverlauf, wie gemeinhin üblich, chronologisch nacherzählt. Ich stelle vielmehr fünfzig Bücher von Schriftstellern und Gelehrten vor, die zwischen 1900 und 1950 in Europa erschienen sind oder auf diese Zeitperiode Bezug nehmen. Ich habe Publikationen ganz verschiedener Art ausgewählt: Zeitungsartikel, Berichte, Essays, Romane. Ihre Autoren sind fast immer Schriftsteller oder doch Persönlichkeiten, die zur Literatur ein besonders enges Verhältnis hatten. Bei der Auswahl bevorzugte ich Publikationen, die ich als besonders «geschichtshaltig» empfand, weil sie mir ein Zeitphänomen oder eine Zeittendenz unmissverständlich und repräsentativ zu widerspiegeln scheinen. Der Erfolg einer Publikation zum Zeitpunkt ihres Erscheinens war für mich ein wichtigeres Selektionskriterium als ihre künstlerische Qualität. Beabsichtigt war keine Literaturgeschichte, welche die Stilentwicklung vor dem Hintergrund der Geschichte verfolgt. Auch bin ich kein Literaturwissenschaftler, der dem literarischen Text als einem Kunstwerk begegnet, das er zum Gegenstand seiner Interpretation macht. Als Historiker betrachte ich die hier vorgestellten Texte als Quellen zur Geschichte, als Zeugnisse, die mir über eine bestimmte Zeitperiode Auskunft geben und mir bei der Vergegenwärtigung von Vergangenem behilflich sein können.
Gewiss ist der historische Gehalt von literarischen Texten von unterschiedlicher Qualität, und man mag kritisch fragen, was fiktionale Literatur wie Romane und Erzählungen in meiner Auswahl zu suchen haben. Aber auch Romane sind Dokumente ihrer Zeit und als solche in ihrer Besonderheit und Aussagekraft sofort erkennbar. Keine Frage: Joseph Roths Roman Radetzkymarsch bietet eine melancholisch verklärte Sicht der Donaumonarchie, und Meinrad Inglin zeichnet im Schweizerspiegel ein nachdenkliches Bild des Kleinstaats, das viele seiner Zeitgenossen nicht geteilt haben dürften. Aber kein Historiker, der über Österreich-Ungarn oder die neuere Schweizer Geschichte arbeitet, kann es sich leisten, die Darstellungen Roths oder Inglins zu ignorieren. Gewiss: Schriftsteller, auch wenn sie sehr erfolgreich sind, machen keine Geschichte. Maxim Gorki hat die russische Oktoberrevolution nicht ausgelöst, und Knut Hamsun hat Norwegens Industrialisierung nicht verhindert. Aber Schriftsteller heben ein Problem ins kollektive Bewusstsein und können mit ihrem Werk dazu beitragen, die Voraussetzung für historisch wirksames Handeln zu schaffen.
Es ist ein vielstimmiger Chor, der in den Zeugnissen der Schriftsteller der ersten Jahrhunderthälfte hörbar wird. Die Stimmen begleiten, überlagern und widersprechen sich. Und doch präsentiert sich dem heutigen Betrachter das geistige Europa von damals mit seinen Problemen, Bedrohungsängsten und Sehnsüchten als eine kulturelle Einheit. Gut möglich, dass der Historiker, der in fünfzig Jahren über unsere Zeit nachdenkt, dieses geistige Europa vermissen wird.
Jede Auswahl, das versteht sich, ist subjektiv. Andere Historiker hätten andere Schriftsteller berücksichtigt oder von denselben Schriftstellern andere Werke ausgewählt. Mir war neben der «Geschichtshaltigkeit» der vorgestellten Werke auch wichtig, diese untereinander in Bezüge zu stellen, die es ermöglichen, einen historischen Tatbestand klarer zu erkennen. Im Übrigen versteht es sich, dass literarische Zeugnisse immer nur einen kleinen Teil des schriftlichen Materials ausmachen, dessen der Historiker bedarf, um der geschichtlichen Wahrheit möglichst nahezukommen.
Dieses Buch ist das Werk eines Autors, der die Geschichte zu seinem Beruf gemacht und die Lektüre literarischer Werke als Liebhaberei betrieben hat. Ich habe an allen Stufen des schweizerischen Bildungswesens und in verschiedenen Gegenden unseres Landes Geschichte und Deutsch unterrichtet, und es hat mir, und vielleicht auch meinen Schülern, Spass gemacht. Die Frage, wie sich Politik und Geschichte zueinander verhalten und ob der Schriftsteller sich politisch engagieren müsse, hat mich immer wieder beschäftigt.
An der Universität Zürich studierte ich im ersten Nebenfach Deutsche Literatur bei Emil Staiger und habe mich von seiner Kunst der «werkimmanenten Interpretation» ansprechen lassen. Staigers Wahlspruch «Begreifen, was uns ergreift» klang ermutigend in den Ohren des Neulings; denn Empfindungen hat jeder, und das Wissen kann man hinzulernen. Nicht immer war ich mit meinem hochgeschätzten Professor einverstanden. Die strikte Trennung von Literatur und Politik, die er betrieb und forderte, schien mir realitätsfern. Auch glaube ich noch heute, dass Heinrich Heine der wichtigste deutschsprachige Schriftsteller der Moderne ist, während Staiger ihn für einen talentierten Tunichtgut hielt. Im Jahr 1966 begann, woran sich meine älteren Leserinnen und Leser noch erinnern mögen, der Stern Staigers zu sinken. In der Rede, die er anlässlich der Verleihung des Kulturpreises der Stadt Zürich hielt, warf er, knapp resümiert, der zeitgenössischen Literatur vor, ihrem sittlichen Auftrag nicht nachzukommen. Diese Rede empörte Max Frisch und eine grosse Zahl von Schriftstellern, auch in Deutschland. Sie warfen Staiger vor, er nehme einen elitären und realitätsfremden Standort ein, welcher der politischen Verantwortung des Schriftstellers in der Gesellschaft nicht Rechnung trage. Der «Zürcher Literaturstreit» war eines der aufregendsten Ereignisse meiner Studienzeit. Ich suchte als Assistent am Historischen Seminar zwischen den Studierenden zu vermitteln und wurde, ähnlich wie der damalige Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung, der sanfte Humanist Werner Weber, zwischen den sich streitenden Parteien zerrieben.
In den folgenden Jahren wurde die Frage nach dem politischen Engagement des Schriftstellers zu einem der wichtigsten Themen der kulturellen Debatte. Im Mai 1968 arbeitete ich an meiner Habilitationsschrift in Paris, und der Zufall wollte, dass ich zum Zimmernachbarn des Schriftstellers Niklaus Meienberg im Schweizerhaus der Cité universitaire wurde. Meienberg hatte drei Vorbilder: Karl Marx, Heinrich Heine und Jean-Paul Sartre. Von Marx pflegte er das bekannte Diktum zu zitieren, dass die Philosophen zwar die Welt verschieden interpretiert hätten, dass es aber darauf ankomme, sie zu verändern. Mit Heine teilte er das Pariser Exil und die Lust, das, was man damals Establishment nannte, zu provozieren. In Sartre, der bereits 1947 eine wegweisende Schrift unter dem Titel «Qu’est-ce la littérature?» publiziert hatte, sah er das Vorbild des engagierten Intellektuellen, der nicht müde wurde, die elementare Ungerechtigkeit des westlichen Kapitalismus zu geisseln. Meienberg hasste Staiger und wusste dessen Ostschweizer Mundart nicht ohne hämisches Geschick nachzuahmen. Er war ein schwieriger Zimmernachbar, und wir schieden im Streit. Doch imponierte mir die Konsequenz seiner Haltung, die ihn zu einem der glaubwürdigsten Exponenten der engagierten linken Schriftsteller in der Schweiz werden liess. Es schmerzte mich, zusehen zu müssen, wie Meienberg seinen immer einsameren Weg bis zum bitteren Ende ging, während viele von denen, die mit ihm 1968 auf die Pariser Barrikaden gestiegen waren, den «Weg durch die Institutionen» antraten und wichtige Positionen in jener Gesellschaft einnahmen, die sie verflucht hatten. Unter den vielen Schweizer Schriftstellern, die sich im Gefolge von Frisch und Dürrenmatt in den 1970er-Jahren politisch engagierten, hat die Stimme Meienbergs ihren unverkennbaren Klang.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurde das politische Engagement des Schriftstellers zu einem beherrschenden Thema. Günter Grass engagierte sich 1969 im Wahlkampf für Willy Brandt, bereiste im VW-Bus die Bundesrepublik und trat an Wahlveranstaltungen auf. Heinrich Böll publizierte 1973 seinen viel beachteten Aufruf «Einmischung erwünscht». Heinrich Heine wurde zum wichtigsten und zugleich umstrittensten Vorbild des politischen Engagements. Marxistische Professoren aus der DDR und aus der Bundesrepublik beanspruchten in wilden Auseinandersetzungen die Deutungshoheit über das Werk des Dichters. Während über zehn Jahren stritten sich Konservative und Progressive darüber, ob man die Universität Düsseldorf in Heinrich-Heine-Universität umbenennen solle, was schliesslich 1988 geschah. Im Jahr 1972 hielt der Historiker Golo Mann am Düsseldorfer Heine-Kongress seine Rede «Heine, wem gehört er?». Und er schloss mit den Worten: «Heine gehört niemandem. Besser: Er gehört allen, die ihn lieben.» Das war mir aus dem Herzen gesprochen. Und auch Emil Staiger hätte wohl zugestimmt – wenn es nicht um Heine gegangen wäre.
Die Frage nach der politischen Wirkung von Literatur bewegte auch die Pädagogen. Der hoch angesehene deutsche Literaturwissenschaftler Robert Jauss, dessen Nähe zum Nationalsozialismus erst spät ruchbar wurde, propagierte 1967 eine «neue Literaturgeschichte», die sich als Ziel die «Emanzipation des Menschen aus seinen naturhaften, religiösen und sozialen Bindungen» setzte. Die Hessischen Rahmenrichtlinien zur Gesellschaftslehre von 1972 sprachen dem Deutschunterricht eine zentrale Rolle bei der Schaffung einer neuen, emanzipierten Gesellschaft zu. An Tagungen und Weiterbildungskursen in Deutschland und der Schweiz rannten streitbare Schriftsteller und Germanisten gegen das an, was sie den «Kanon einer elitären bürgerlichen Kultur» nannten. Sie verkündeten, die Lektüre von Boulevardzeitungen bereite besser als Faust I auf das Leben vor – erläuterten aber nicht, welches Leben sie meinten. An Tagungen in Deutschland bekam ich von gelehrten Professoren zu hören, dass Hans Fallada der weit bedeutendere Schriftsteller als Thomas Mann sei und dass Eichendorff als überholt zu gelten habe, weil schon längst keine Mühlen mehr klapperten. Mit Staunen folgte der Gymnasiallehrer und Privatdozent, der ich damals war, diesen Vorgängen, und ich tröstete mich mit der Feststellung, dass der grobe pädagogische Unfug aus dem Norden in unserem Land eine verspätete und abgeschwächte Wirkung entfaltete. Mein Interesse für die Beziehung zwischen Literatur und Geschichte aber blieb wach.
Heute, vierzig Jahre später, sind die leidenschaftlichen Auseinandersetzungen um den politischen Stellenwert von Literatur verstummt. Die Schriftsteller wollen die Welt nicht mehr verändern und bewegen sich mit Vorliebe auf abseitigen Pfaden der Seelenerkundung. Individualismus dominiert den Gemeinsinn. Die Literaturwissenschaftler, so scheint es zuweilen, wollen von der Gesellschaft, in der sie leben, nicht mehr wahrgenommen werden. Wenn früher feststand, dass Lehre und Forschung das Arbeitspensum der Professoren zu gleichen Teilen bestimmen sollten, so hat heute die Forschung einen deutlich höheren Stellenwert erlangt. Der Literaturwissenschaftler, der unter Fachkollegen etwas gelten will, betreut heute Forschungsprojekte, gründet Kompetenzzentren, tauscht sich an Kongressen aus und publiziert Beiträge in Fachzeitschriften. Auch benutzt er nicht selten eine Fachsprache, die nur mehr wenig mit dem zu tun hat, was Hofmannsthal einst «Wert und Ehre deutscher Sprache» nannte. Emil Staiger konnte noch schreiben: «Heute sollte ein Forscher es aber doch nicht nötig haben, den Ernst und die Sachlichkeit seiner Wissenschaft durch schlechtes Schreiben zu beweisen.» Diese Botschaft scheint heute vergessen. Wer sich, wie Emil Staigers Schüler Peter von Matt, in elegantem Stil zu Literatur und Politik äussert, die Öffentlichkeit nicht scheut und ein dankbares Publikum findet, erscheint in der Schar seiner gelehrten Kollegen als bunter Vogel, dessen wissenschaftlichem Ernst nicht ganz zu trauen ist. Fast gewinnt man als aussenstehender Betrachter den Eindruck, das elitäre Wissenschaftsverständnis, das man einst Emil Staiger vorwarf, sei durch die Hintertür in anderer Form zurückgekehrt. Vor Jahrzehnten hat Joachim Fest, der beides war, ein tüchtiger Historiker und ein vorzüglicher Schriftsteller, davon gesprochen, dass sich die Geisteswissenschaften mehr und mehr aus unserer Gesellschaft verabschiedeten. Und in der Tat: Ausgerechnet in einer Zeit, da man dazu neigt, die Wissenschaften nach ihrem messbaren gesellschaftlichen Nutzen zu bewerten, macht es den Anschein, als hätten die Geisteswissenschaften den Kampf um öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung aufgegeben.
Dieses Buch will keine neuen Forschungsergebnisse vorlegen, keine These zur Diskussion stellen und nicht zur Theoriebildung beitragen. Es wendet sich nicht an Spezialisten und möchte bloss Kenntnis vermitteln und Verständnis ermöglichen. Ich wünsche mir Leserinnen und Leser, die an Geschichte und Literatur interessiert sind und die Beschäftigung mit beiden Wissensbereichen als Bereicherung ihres Lebens empfinden. Wenn mein Buch dazu beiträgt, dass das eine oder andere der hier vorgestellten Werke wieder gelesen wird, habe ich mein Ziel erreicht.
I Die Jahrhundertwende
Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des Bürgertums. Die Aristokratie, durch Herkunft und Grundbesitz gegenüber den anderen Bevölkerungsschichten privilegiert, war in ihrer Machtstellung durch die Französische Revolution erschüttert worden. Zwar verschwand sie nicht von der Bildfläche, musste aber immer mehr politische Macht abgeben. Es war das Bürgertum, das vom wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung des Jahrhunderts am meisten profitierte und dem dieser Aufschwung gleichzeitig zu verdanken war. Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts setzte in England die industrielle Revolution ein. Das Land verfügte mit seinen Kohle- und Erzvorkommen über die wichtigsten Voraussetzungen zur Eisenverarbeitung, in der es bald eine Führungsrolle übernahm. Der Handel mit dem riesigen Kolonialreich, nicht zuletzt der Sklavenhandel, blühte. Hinzu trat englischer Erfindergeist. Im Jahr 1769 liess James Watt seine Dampfmaschine patentieren. Mechanische Spinnmaschinen ersetzten das handbetriebene Spinnrad. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts konstruierte Stephenson die ersten Dampflokomotiven; sie sollten den europäischen Personen- und Warenverkehr revolutionieren. Mit dem Bau von Eisenbahnlinien begann, so urteilte Heinrich Heine, «ein neuer Abschnitt der Weltgeschichte». Immer mehr wurde die Handarbeit von Maschinen übernommen. Fabriken traten an die Stelle von Werkstätten. Die Fabrik ermöglichte arbeitsteilig organisierte Produktionsabläufe und war dem herkömmlichen Handwerksbetrieb weit überlegen.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts griff dieser Industrialisierungsprozess erst auf Nordeuropa, dann auf West- und Osteuropa und schliesslich auf Südeuropa über. Erfindungen und Neuerungen jagten sich, Fortschrittsoptimismus prägte den Zeitgeist. Die Petroleumlampe wurde durch die Gaslampe und diese durch die elektrische Beleuchtung abgelöst. Strassen- und Untergrundbahnen begannen, die Stadtbewohner zu befördern. Die Droschke wurde durch die Motordroschke ersetzt, die man bald Automobil nannte. Mobilität und Beschleunigung wurden zu Merkmalen der Moderne. Um 1900 entdeckte der Italiener Marconi die drahtlose Telegrafie, und zur selben Zeit eröffneten in Frankreich die Gebrüder Lumière das erste Kino. Bisher unheilbare Krankheiten konnten dank der Erkenntnisse von Louis Pasteur, Robert Koch und Wilhelm Röntgen wirksam bekämpft werden. Die Hygiene verbesserte sich, Pest und Cholera verschwanden aus den Städten, die Lebenserwartung stieg.
Ein ausserordentliches Bevölkerungswachstum unterstützte diese stupende Entwicklung, den tief greifendsten Wandel, den der Mensch seit der Jungsteinzeit, als er sesshaft wurde, erlebte. Um 1800 zählte Europa 187Millionen Einwohner; hundert Jahre später waren es über 400Millionen. Aus Städten wurden Grossstädte. Trotz diesem Wachstum wuchs das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung, und fast überall in Europa verbesserte sich die Lebensqualität.
Das Bürgertum war der Träger dieses Industrialisierungs- und Wachstumsprozesses. Es engagierte sich in den aufstrebenden Sektoren von Handel, Industrie und Bankwesen, es stellte Kaufleute, Unternehmer und Banker sowie das administrativ und juristisch geschulte Führungspersonal. Von den Bauern und den Lohnarbeitern grenzten sich die Bürger dadurch ab, dass sie keine körperliche Arbeit verrichteten und ein überdurchschnittlich hohes Einkommen bezogen. Im 19. Jahrhundert entwickelte das gehobene Bürgertum einen eigenen Lebensstil. Man war stolz auf seinen Besitz, der individuelle Sicherheit und Unabhängigkeit des Urteils verbürgte. Man kleidete sich elegant, wohnte an bevorzugter Lage und umgab sich mit kostbarem Mobiliar und wertvollen Bildern. Der weniger privilegierten Bevölkerung führte man eine geordnete und erfolgreiche Existenz vor. Um die Wende zum 20. Jahrhundert hatte sich der Lebensstil des europäischen Bürgertums so charakteristisch ausgebildet, dass sich die Zugehörigen an ihrer Kleidung, am Benehmen, an den Gewohnheiten und an der Konversation sofort erkannten. Wer den gutbürgerlichen Stil nicht respektierte, wurde zum Aussenseiter und machte, indem er sich zum Dandy oder Bohemien hochstilisierte, aus seiner Not eine Tugend. Wenige europäische Schriftsteller haben Dasein und Lebensstil der gehobenen bürgerlichen Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg so anschaulich und glaubwürdig geschildert wie der Engländer John Galsworthy (1867–1933) in seiner Forsyte Saga (1). Das Tausendseitenwerk, durch Verfilmung weltweit bekannt geworden, ist keineswegs unkritisch; aber es schildert doch die Sonnenseite bürgerlicher Existenz zur Zeit des Fin de Siècle.
Das Bürgertum, so überlegen es in Erscheinung trat, hatte auch seine Schattenseiten. Hinter dem Anschein von Ordnung, Rechtschaffenheit und Vorbildlichkeit lauerten Besitzgier, Opportunismus und Doppelmoral. Es fehlte denn auch nicht an Schriftstellern, die der bürgerlichen Gesellschaft misstrauten. Gegenstand ihrer Kritik war häufig das höhere Bildungswesen. Dieses stand nur Kindern aus zahlungskräftigen Familien offen, was einem bürgerlichen Bildungsmonopol gleichkam. In Deutschland wurde der Lübecker Kaufmannssohn Heinrich Mann (1871–1950), der wie Galsworthy dem gehobenen Bürgertum entstammte, zum schärfsten Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft. In seinem Roman Professor Unrat (2) geisselte er mit zynischer Schonungslosigkeit den sittlichen Zerfall eines Repräsentanten des Bildungsbürgertums. In einem späteren Werk, dem Untertan, weitete er seine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft zur Zeit Wilhelms II. aus.
Das Bürgertum war keine homogene Klasse. Es gab beträchtliche Unterschiede, etwa zwischen dem alteingesessenen städtischen Bürgertum, das seinen Besitz über Generationen geduldig vermehrte, und den Neureichen, die rasch von der Gunst der Stunde profitierten. Es gab das Bildungsbürgertum der Professoren und Wissenschaftler, deren Einkommen vergleichsweise gering war, die jedoch als Träger des geistigen Fortschritts in hohem Ansehen standen. Und es gab die Unterschiede der christlichen Konfessionen und eine in ganz Europa verbreitete Abneigung gegen die Juden, die ihre gesellschaftliche Stellung mehr und mehr verbesserten und in Konkurrenz zur bürgerlichen Elite traten.
Auch in seiner politischen Haltung lässt sich das Bürgertum nicht auf einen Nenner bringen. In der Regel war man konservativ gesinnt; denn Reformen oder gar Revolutionen konnten den eigenen Besitzstand gefährden. Im Bildungsbürgertum der Professoren, Wissenschaftler und Künstler aber fanden sich zahlreiche liberale Persönlichkeiten, die man heute als Linksintellektuelle bezeichnen würde. Dies zeigte sich im Frankreich der Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der «Dreyfus-Affäre», der Verurteilung eines unschuldigen jüdischen Offiziers unter dem Verdacht der Spionage für Deutschland. Es war der Schriftsteller Émile Zola (1840–1902), der mit seinem Leitartikel «Ich klage an» (3) das Intrigenspiel reaktionärer Militärs und konservativer Politiker publik machte und Dreyfus zu seinem Recht verhalf. Der Vorfall hatte für ganz Europa Signalwirkung: Das Recht hatte sich gegenüber der Macht zu behaupten vermocht. Dass sich Schriftsteller für jene Mitmenschen einsetzten, denen Unrecht widerfahren war, hatte es seit Voltaire immer wieder gegeben. Dass die Schriftsteller aber ein solches Engagement als ihren Auftrag zu empfinden begannen, war neu.
Im Zuge der Industrialisierung entstand in allen europäischen Ländern eine neue Bevölkerungsschicht, jene der Industriearbeiter. Sie rekrutierte sich vor allem aus dem Handwerker- und Bauernstand. Von Adel und Besitzbürgertum wurde dieser eingreifende gesellschaftliche Wandel lange Zeit nicht wahrgenommen. Bestrebungen, diese Bevölkerungsschicht sozial und politisch in die Gesellschaft zu integrieren, kamen nur langsam voran oder unterblieben ganz. Dies war besonders ausgeprägt in Russland der Fall. Im Zeitraum von 1840 bis 1914 wuchs hier die Gesamtbevölkerung von 94 auf 175Millionen Menschen. Die vorwiegend konservative Haltung der schmalen bürgerlichen Schicht verhinderte die Umsetzung sich aufdrängender gesellschaftlicher Reformen. Dasselbe galt für die zaristische Aristokratie, von der keine fortschrittlichen Initiativen zu erwarten waren. Der Bauernstand, mit etwa 100Millionen die breiteste Bevölkerungsschicht, war arm, ungebildet und in Lethargie versunken. Die Schicht der Industriearbeiter, gegen Ende des Jahrhunderts erst etwa 3Millionen, vergrösserte sich mit dem industriellen Wachstum und wurde, weil Reformen ausblieben, zu einem wichtigen politischen Faktor. Zu den ersten, die den Industriearbeiter ins Zentrum ihres Schaffens stellten, gehört der Schriftsteller Maxim Gorki (1868–1936). Sein Roman Die Mutter (4) ist ein Pionierwerk des sogenannten Sozialistischen Realismus, der die schöpferische Leistung einer allgemein verbindlichen politischen Doktrin unterwarf.
Das Voranschreiten der Industrialisierung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil der Landwirtschaft an der volkswirtschaftlichen Produktion in den meisten europäischen Ländern hoch blieb. Bodengestalt und Klima ermöglichten eine grosse Vielfalt landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Auch die Besitzverhältnisse waren sehr unterschiedlich beschaffen: Das Spektrum reichte vom adligen Grossgrundbesitzer in der Normandie, in Ostpreussen oder in Böhmen zum Bergbauern in der Innerschweiz oder im Tirol. Die Industrialisierung erfasste auch die Landwirtschaft, wobei eher von einer Evolution als von einer Revolution zu sprechen ist. Die Einführung des Kunstdüngers, der Einsatz von Maschinen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Pflanzen- und Tierzucht ermöglichten eine allmähliche Steigerung der Erträge. Allerdings profitierten davon vor allem Grossbauern in sehr fruchtbaren Regionen. In vielen europäischen Ländern, selbst in der Kornkammer Frankreich, gab es eine verarmte Schicht von Bauern, die man als ländliches Proletariat bezeichnen könnte. In Deutschland, in der Schweiz und anderswo sahen sich viele Bauern gezwungen, Haus und Herd zu verlassen und ihr Glück in der Stadt oder in der Auswanderung nach Übersee zu suchen.
Obwohl Stadt und Land durch den Strassen- und den Eisenbahnbau einander näherrückten, blieb doch das Dorf mit seinen überblickbaren sozialen Strukturen, Traditionen und Wertvorstellungen der Mittelpunkt bäuerlicher Existenz. Man dachte, auch wenn man von technischen Neuerungen profitierte, konservativ. Für die Städter, auch wenn sie die Modernisierung begrüssten, wurde das Land zu einer heilen Welt. Man fuhr am Wochenende, wie sich bei Theodor Fontane nachlesen lässt, vor die Stadt, um die reine Luft zu atmen und die Stille zu geniessen. Die Heimatliteratur erfuhr, nicht zuletzt dank städtischen Lesern, nach der Jahrhundertwende eine erstaunliche Blüte. Der Österreicher Peter Rosegger (1843–1918) wurde mit seinen gesammelten Erzählungen unter dem Titel Als ich noch der Waldbauernbub war (5) zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller der Jahrhundertwende.
Die Menschen dieser Zeit blickten mit neugieriger Zuversicht in die Zukunft. Die Industrialisierung wurde im Allgemeinen mit Enthusiasmus begrüsst. Stefan Zweig hat in seinen Erinnerungen Die Welt von Gestern die Periode vor dem Ersten Weltkrieg als «das goldene Zeitalter der Sicherheit» bezeichnet. «Mit Verachtung blickte man», schreibt er, «auf die früheren Epochen mit ihren Kriegen, Hungersnöten und Revolten herab als auf eine Zeit, da die Menschen eben unmündig und noch nicht genug aufgeklärt gewesen. Jetzt aber war es doch nur eine Angelegenheit von Jahrzehnten, bis das letzte Böse und Gewalttätige endgültig überwunden sein würde, und dieser Glaube an den ununterbrochenen, unaufhaltsamen ‹Fortschritt› hatte für jenes Zeitalter wahrhaftig die Kraft einer Religion; man glaubte an diesen ‹Fortschritt› schon mehr als an die Bibel, und sein Evangelium schien unumstösslich bewiesen durch die täglich neuen Wunder der Wissenschaft und der Technik.»
Kritik am Industrialisierungsprozess gab es zwar früh, aber sie war eher selten und verhallte meist ungehört. Schon in Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahren kann man nachlesen: «Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich.» Die Schriftsteller der Romantik empfanden den technischen Fortschritt in aller Regel als Bedrohung. «Diese Dampfmaschinen», schrieb Joseph von Eichendorff, «rütteln die Welt, die eigentlich nur noch aus Bahnhöfen besteht, unermüdlich durcheinander wie ein Kaleidoskop, wo die vorüberjagenden Landschaften, ohne dass man noch irgendeine Physiognomie gefasst, immer neue Gesichter schneiden, der fliegende Salon immer neue Sozietäten bildet, bevor man noch die alten recht überwunden.» Während des 19. Jahrhunderts kam es in England und mancherorts auf dem Kontinent zur Erstürmung von Fabriken und zur Zerstörung von Maschinen. Doch solche Auflehnung entsprang weniger weltanschaulichen Überzeugungen als der Existenzangst vor dem Verschwinden häuslicher Werktätigkeit.
Ein scharfer Kritiker der Industrialisierung war der konservative Basler Historiker Jacob Burckhardt (1818–1897). Dampfmaschinen und Eisenbahnen, welche die Luft verpesteten und Lärm und Hektik erzeugten, waren Burckhardt ein Greuel. In seinen Weltgeschichtlichen Betrachtungen (6) stellte er sich dem Fortschrittsoptimismus seiner Zeit mit Entschiedenheit entgegen. Burckhardt erkannte als einer der Ersten, dass die voranschreitende Technik dem Menschen ein gefährliches Machtpotenzial in die Hand gab, das sich in künftigen Auseinandersetzungen als verheerend erweisen konnte.
1. John Galsworthy, The Forsyte Saga (1906–1921)
Deutsch: Die Forsyte Saga (1925)
Wer Romane nicht nur aus literarischem, sondern auch aus historischem Interesse liest, kennt die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert besonders beliebte Gattung des Familienromans. Breiter angelegt als Bildungsromane wie Goethes Wilhelm Meister oder Gottfried Kellers Grüner Heinrich, setzten sich die Familienromane das Ziel, die Geschichte einer Familie oder einer Sippe über den Zeitraum von mehreren Generationen hinweg zu verfolgen. Nicht nur der individuelle Entwicklungsgang, sondern auch der gesellschaftliche Wandel, wie er sich in den Individuen widerspiegelt, wurde zum Thema. Familienromane waren meist umfangreiche Werke, die in mehreren Bänden nach und nach erschienen. Sie richteten sich an ein Publikum, das Zeit zum Lesen oder zum Vorlesen hatte, nämlich an das Bürgertum. Den wichtigsten Familienroman deutscher Sprache verfasste ein junger Mensch von 25Jahren aus gutbürgerlichen Verhältnissen und mit ungesicherter beruflicher Zukunft: Thomas Mann. In den Buddenbrooks schilderte er Blüte und Niedergang eines Lübecker Kaufmannsgeschlechts im Verlauf von vier Jahrzehnten, von 1835 bis 1877.
Besonderer Beliebtheit erfreute sich der Familienroman, den man seiner Länge wegen als «roman fleuve» bezeichnet hat, in Frankreich. Émile Zola schuf im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einen ganzen Romanzyklus von nicht weniger als zwanzig Bänden, Les Rougon-Macquart, die «Natur- und Sozialgeschichte», wie er sagte, einer Familie des Second Empire. Noch immer lesenswert sind La Chronique des Pasquier von Georges Duhamel und Les Thibault von Roger Martin du Gard. Beide Romane spielen im Milieu des Pariser Bürgertums; der erste erfasst den Zeitraum von 1889 bis 1931 und der zweite die Zeit unmittelbar vor und während des Ersten Weltkriegs.
Der bekannteste englische Familienroman aus der Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert ist John Galsworthys Forsyte Saga. Das Werk überspannt den Zeitraum von 1886 bis zum Ersten Weltkrieg, also die Regierungszeit der Königin Viktoria bis zu Georg V. England war damals die unbestrittene wirtschaftliche Führungsmacht der Erde. Das Land besass die grösste Flotte und hatte sich seit dem 17. Jahrhundert in Asien und Afrika ein riesiges Kolonialreich geschaffen. «Empire» und «industrielle Revolution» waren die Grundpfeiler dieser wirtschaftlichen Vormachtstellung. England war zwar keine Demokratie im heutigen Sinne, und das allgemeine Wahlrecht wurde erst 1918 eingeführt. Aber Bürgerfreiheit und Selbstverwaltung hatten hier eine geschichtliche Tradition, die den anderen europäischen Grossmächten fehlte. Der Demokratisierungsprozess schritt im England des 19. Jahrhunderts denn auch ruhiger voran als in den meisten anderen europäischen Ländern. In aussenpolitischer Hinsicht war die Machtstellung Englands nie gefährdet. Man war auf niemanden angewiesen und erfreute sich einer «splendid isolation», die den Neid anderer Mächte erweckte. Die englische Diplomatie verfolgte die traditionelle «Politik des Gleichgewichts». Man achtete darauf, dass keine der kontinentalen Nationen eine Vormachtstellung erreichte, die dem eigenen Land gefährlich werden konnte. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war diese Aussenpolitik erfolgreich.
Die Einkünfte, die Kolonialreich und Industrialisierung abwarfen, waren freilich sehr einseitig und ungerecht verteilt. In wenigen anderen europäischen Ländern traten die sozialen Unterschiede so deutlich zutage wie in England. Am meisten profitierte die schmale Schicht der Aristokratie, die ihre Einkünfte aus dem Grundbesitz in den Überseehandel investierte. Hinzu traten die Kaufmannsfamilien von London und den anderen grossen Hafenstädten. Im Laufe der Zeit bildete sich dort ein Besitzbürgertum heraus, das seine Lebensform nach derjenigen des Adels ausrichtete und sich gegenüber dem Kleinbürgertum der Handwerker und Kleinhändler abgrenzte. Die Arbeiterschaft, die sich als Folge der Industrialisierung rapide vermehrte, wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts politisch aktiv und trat lange nicht in den Gesichtskreis des Besitzbürgertums.
In dieser Welt spielt die Forsyte Saga. Die Haupthandlung der ersten Bände des Romans sei hier in Kürze nacherzählt. Der Rechtsanwalt Soames Forsyte heiratet die bildschöne Professorentochter Irene Heron, die er liebt und als seinen Besitz betrachtet. Doch Irene hat Soames nie geliebt und verlässt ihn. Während vielen Jahren versucht Soames mit allen Mitteln, seine angetraute Frau zurückzugewinnen, doch sie entzieht sich ihm und heiratet schliesslich Soames’ Cousin. Soames nimmt sich, ein sozialer Abstieg sondergleichen, die Französin Annette, Kassiererin eines Restaurants in Soho, zur Frau. Er liebt sie zwar nicht, erhofft sich von ihr aber einen Sohn. Sie bringt eine Tochter zur Welt und verlässt Soames. Diese Handlung wird eingebettet in einen dichten und weit gefächerten gesellschaftlichen Mikrokosmos von Verwandten und Bekannten, die den Hintergrund der Szene beleben. Ihre Charaktere und Lebensschicksale werden treffsicher skizziert, und es entsteht ein vielstimmiges und glaubwürdiges Sittengemälde des Besitzbürgertums der «upper-middle class» im spätviktorianischen England.
Der Roman beginnt mit einem Familienfest in den 1880er-Jahren. Gastgeber ist der alte Jolyon Forsyte, der es im Teehandel zu Reichtum gebracht hat. Das Fest gibt dem Autor Gelegenheit, die wichtigsten Mitglieder der Familie vorzustellen. Es sind dies Geschäftsleute, Börsen- und Immobilienmakler, Anwälte. Persönlichkeiten sehr unterschiedlichen Charakters alles in allem, die aber alle vermögend und sich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung bewusst sind. «Die Forsytes», schreibt Galsworthy, «hatten es alle so weit gebracht, dass sie nun als ‹gutsituierte Leute›, wie man es nennt, eine gewisse Stellung einnahmen.» Die Familienmitglieder empfinden wenig Sympathie füreinander, belauern und bespitzeln sich gegenseitig und lieben den Klatsch. Aber ihre Loyalität zur Familie steht ausser Frage, und sie tun alles, um zu vermeiden, dass ihr Vermögen schwindet und ihr guter Ruf Schaden leidet. Das Hauptbestreben der Forsytes ist darauf gerichtet, ihren Besitz zu vergrössern und ihr Kapital gewinnbringend einzusetzen. In diesem Bestreben fühlen sie sich im Einklang mit einer prosperierenden Nation. Auf welche Weise dieser Profit erwirtschaftet wird und wie viele indische Zwangsarbeiter in den Minen der Kolonialherren umkommen, kümmert die Forsytes wenig, solange dies zum eigenen und zum nationalen Nutzen geschieht. «Ein Forsyte weiss», schreibt Galsworthy, «was sicher ist, und sein Festhalten am Besitz – ganz gleich, ob es sich um Frauen, Häuser, Geld oder Ruf handelt – ist seine Zunftmarke.»
Im Lebensstil, den die Forsytes pflegen, widerspiegelt sich die Wohlhabenheit des gehobenen Bürgertums. Körperliche Arbeit ist verpönt. Man trifft sich im Büro in der City, im Club, beim Lunch oder Dinner zu geschäftlichen Gesprächen. Man besitzt Häuser am Hyde Park und in Mayfair, fährt aus in komfortabler Equipage, geht ins Theater und in die Oper, macht Bildungsreisen und Urlaub in Spanien und Italien. Auf die Kleidung wird grösste Sorgfalt verwendet, um der Erscheinung ein Höchstmass an Respektabilität zu verschaffen. Wer gegen die herrschende Mode verstösst, riskiert, zum Aussenseiter zu werden. Man speist an erlesener Tafel, trinkt Champagner und Portwein, ertüchtigt sich beim Reiten, beim Cricket oder Tennis. Man sammelt Gemälde, Porzellan, Nippsachen, nicht immer mit Kennerschaft, aber im Bewusstsein des Marktwerts. «Wie jeder Forsyte weiss», schreibt Galsworthy, «ist Schund, der sich verkauft, durchaus kein Schund – keineswegs.»
Der Widerspruch zwischen Sein und Schein geht wie ein Riss durch diese Gesellschaft. Ihre Mitglieder empfinden zwar Gefühle und Leidenschaften, aber sie zeigen diese nicht. Man verstösst zwar gegen die geltende Moral, aber der Verstoss darf keinesfalls bekannt werden. Die Angst vor dem Skandal ist allgegenwärtig. Man geht in die Gottesdienste der anglikanischen Kirche, ist aber nicht gläubig. Man liest die Times und ist konservativ, zeigt sich aber an Politik nur insofern interessiert, als sie den Status quo sichert. Der soziale Wandel wird von diesem Bürgertum kaum wahrgenommen. Zwar zeigen sich gegen die Jahrhundertwende Anzeichen, dass die zwei Hauptsäulen des britischen Reichtums, Kolonialbesitz und industrielle Überlegenheit, nicht unerschütterlich sind. So macht der Krieg gegen die Buren in Südafrika (1899–1902) deutlich, dass der Unterhalt des Empires dem Mutterland schwerere Opfer abverlangt als vorhergesehen. Auch hat die Industrialisierung ein Proletariat erzeugt, was innenpolitische und soziale Reformen unumgänglich macht. Von all dem merken die Gestalten der Forsyte Saga wenig. Als Soames eines Abends im Londoner West End auf eine jubelnde Volksmenge trifft, die einen Erfolg im Burenkrieg feiert, ist er entsetzt. «Er war verblüfft», schreibt Galsworthy, «erschöpft, beleidigt. Dieser Volksstrom kam von überall her, als hätten sich Schleusen geöffnet und Wasser fliessen lassen, von deren Existenz er wohl gehört, aber an die er nie geglaubt hatte. Dies also war die Bevölkerung, die unübersehbar lebendige Negation von Lebensart und Forsyteismus. Dies also war – Demokratie! Sie stank, gellte, war scheusslich!»
Der Verfasser der Forsyte Saga kannte sich im spätviktorianischen Besitzbürgertum aus, denn er gehörte selbst dazu. Er wurde 1867 als Sohn eines vermögenden Grossgrundbesitzers und Anwalts in der Grafschaft Surrey, im Südwesten Londons, geboren. Er studierte an den Eliteschulen von Harrow und Oxford, wurde seinerseits Anwalt, übte aber diesen Beruf nicht aus. Für die väterlichen Geschäfte und um sich kulturell zu bilden, unternahm er weite Reisen. Auf einer dieser Reisen begegnete er dem Schriftsteller Joseph Conrad, der auf einem Segelschiff als Erster Maat diente – es wurde eine Freundschaft fürs Leben. Galsworthy unterhielt während zehn Jahren ein heimliches Verhältnis mit der Frau eines Cousins, die er nach ihrer Scheidung heiratete – diese Affäre hat in der Forsyte Saga ihren Niederschlag gefunden. Im Jahr 1932, ein Jahr vor seinem Tod, erhielt Galsworthy, der auch als gesellschaftskritischer Theaterautor erfolgreich war, den Nobelpreis.
Die Forsyte Saga ist ein kritisches, aber auch zutiefst menschliches Buch. Der Autor erkennt die Schwächen der bürgerlichen Oberschicht, ihren Materialismus, ihren Snobismus und ihre politische Ahnungslosigkeit. Zugleich nimmt er am Leiden und Versagen seiner Figuren in einer Weise Anteil, wie dies in der modernen Belletristik selten geworden ist. Seinen grössten Erfolg hatte das Werk 1967 in einer Verfilmung durch das britische Fernsehen, die in den USA und in der Sowjetunion sowie in vierzig weiteren Ländern gezeigt wurde. Man schätzt, dass sich eine rekordverdächtige Zahl von über 100Millionen Menschen den Film angesehen hat. Auf heutige Leser, falls es sie noch gibt, mag das Werk altväterisch und etwas verstaubt wirken. Aber die Personenbeschreibungen, die Dialoge und die inneren Monologe verraten noch immer die subtile Hand des Meisters.
2. Heinrich Mann, Professor Unrat (1905)
Zu dem Zeitpunkt, da Heinrich Manns Professor Unrat erschien, 1905, stand das deutsche humanistische Gymnasium in hohem Ansehen. Es war eine Staatsschule, welche die Bildung der Jugend einheitlichen Lernzielen unterwarf und damit zum geistigen Zusammenhalt des 1871 gegründeten Reichs beitrug. Ihre Lehrer, die Studienräte, genossen hohes gesellschaftliches Ansehen. Viele von ihnen trugen durch ihre wissenschaftlichen Leistungen zum internationalen Ansehen deutscher Bildung bei. Im Gymnasium wurde nicht nur auf die Universität vorbereitet; hier wurde auch die bürgerliche Elite herangezogen, und Tugenden wie Vaterlandsliebe, Pflichtbewusstsein, Disziplin und Loyalität wurden eingeübt. Besondere Bedeutung kam dem humanistischen Gymnasium zu, weil in dessen Lehrprogramm die alten Sprachen Latein und Griechisch einen wichtigen Platz einnahmen. In diesen Fächern wurde das antike Geisteserbe gepflegt; zugleich dienten sie einer strengen Selektion. Ursprünglich dem Gedankengut des Liberalismus verpflichtet, verengte sich der Bildungsauftrag des deutschen Gymnasiums immer mehr auf die Vermittlung literarisch-historischen Wissens. Die Ausbildung war insofern unpolitisch, als die Schüler nicht zu mündigen demokratischen Staatsbürgern, sondern zu zuverlässigen Gliedern der wilhelminischen Klassengesellschaft herangebildet wurden. Unpolitisch waren oft auch die Lehrer, die sich gern mit der Aura einer Geistesaristokratie umgaben, welche über den gesellschaftlichen Realitäten stand. Das Fehlen einer liberalen staatsbürgerlichen Ausbildung sollte sich als erhebliche Erschwerung für den Demokratisierungsprozess nach dem Ersten Weltkrieg erweisen. In deutschen Autobiografien und in persönlichen Aufzeichnungen ist oft auf diesen Mangel hingewiesen worden. So schreibt noch der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt: «Was Demokratie ist und wie Demokratie funktioniert, habe ich erst im Kriegsgefangenenlager gelernt, und sogar von der Geschichte der Weimarer Demokratie habe ich erst nach Kriegsende gehört und gelesen.»
Diesen geschichtlichen Sachverhalt muss man kennen, um die Wirkung zu ermessen, die Heinrich Manns Buch bei seinem Erscheinen ausübte. Hauptgestalt des Romans ist Professor Raat, Gymnasiallehrer für alte Sprachen und Deutsch in einer norddeutschen Stadt, die unschwer als Lübeck zu erkennen ist. Raat hasst die Schüler, die Schüler hassen ihn und rufen ihm den Spottnamen Unrat nach. Heinrich Mann zeichnet ein vernichtendes Bild dieser Persönlichkeit. «Unrats Kinn», lesen wir etwa, «in dessen oberem Rand mehrere gelbe Gräten staken, rollte, während er sprach, zwischen den hölzernen Mundfalten wie auf Geleisen, und sein Speichel spritzte bis in die vorderste Bank.» Gegen sechzig Jahre alt und verwitwet, führt Unrat ein Leben am Rande der herrschenden bürgerlichen Gesellschaft, überträgt aber deren Zwang zur Disziplinierung auf den Umgang mit seinen Schülern. Die konservative Haltung des Bürgertums hat er vollkommen verinnerlicht. «Kein Bankier und kein Monarch», schreibt Mann, «war an der Macht stärker beteiligt, an der Erhaltung des Bestehenden mehr interessiert als Unrat. Er ereiferte sich für alle Autoritäten, wütete in der Heimlichkeit seines Studierzimmers gegen die Arbeiter – die, wenn sie ihre Ziele erreicht hätten, wahrscheinlich bewirkt haben würden, dass auch Unrat etwas reichlicher entlohnt wäre.»
Professor Unrats autoritäre Art kontrastiert merkwürdig mit einer ängstlichen Lebensuntüchtigkeit. Als Lehrer stellt er den Typus des Tyrannen, des gefürchteten Paukers und Pedanten dar. Mit besonderem Grimm verfolgt er eine Gruppe von drei renitenten Schülern, deren beruflichen Aufstieg er, wie er immer wieder versichert, verhindern will. Um ihnen zu schaden, spioniert er ihrem Privatleben nach. Dabei gerät er in eine Welt, die ihm ganz unvertraut ist und in der er sich ungeschickt und linkisch bewegt. Er gelangt in die zwielichtige Spelunke «Zum Blauen Engel», wo die «Barfusstänzerin» und «Chanteuse» Rosa Fröhlich ein leicht zu befriedigendes Publikum von Matrosen und Hafenarbeitern unterhält. Diese weibliche Hauptfigur des Romans wirkt in Sprache und Benehmen glaubwürdiger als Unrat. Heinrich Mann, der zeitlebens ein Faible für frivole Sentimentalitäten und leichte Mädchen hatte, schildert einen Auftritt der Tingeltangelsängerin so: «Das Klavier hatte angefangen, Tränen zu vergiessen. Im Diskant war es feucht vom Schluchzen, im Bass schnupfte es sich aus. Unrat hörte die Künstlerin Fröhlich anstimmen: ‹Der Mond ist rund, und alle Sterne scheinen, / Und wenn du lauschest an dem Silbersee / Steht deine Liebe, und du hörst sie weinen …› Die Töne tauchten, gleich matten Perlen auf schwarzer Flut, aus der schwermütigen Seele der Sängerin.»
Es trifft das ein, was zu erwarten war und befürchtet werden musste. Unrat, der eigentlich den sittlichen Verfehlungen seiner Schüler nachspüren wollte, gerät selbst in den Bannkreis der fatalen Fröhlich und verfällt dieser mehr und mehr. Er erscheint allabendlich in ihrer Garderobe, ist ihr beim Anziehen und Schminken behilflich, tritt als ihr Beschützer auf. Je mehr sein Lebenswandel Anstoss erregt und zum Stadtgespräch wird, umso mehr wendet sich Unrat gegen jene bürgerliche Gesellschaft, deren politische und moralische Grundsätze er als Lehrer verteidigt hat. Seine frühere Autoritätsgläubigkeit schlägt in entfesselten Anarchismus um. In seiner Klasse herrschen inzwischen chaotische Verhältnisse. Unrat muss aus dem Schuldienst entlassen werden. Er heiratet die Rosa Fröhlich, die auch noch ein uneheliches Kind mit in die Ehe bringt. Man vergnügt sich im Seebad, und Unrats Vermögen schwindet dahin. In einem Haus vor den Toren, wo sich der Professor mit Rosa Fröhlich niederlässt, treffen sich die Halbwelt und die Prominenz der Stadt zu Glücksspiel, Trinkgelagen und allen wüsten Ausschweifungen. Professor Unrat, als Lehrer der Vertreter klassischer Bildung und unbedingter Sittenstrenge, ist zu seinem eigenen Gegensatz geworden und demonstriert damit die Fragwürdigkeit der Werte, die er einst vertrat. Am Schluss des Romans wird der Professor, der seine Frau fast erwürgt und einen seiner Schüler bestohlen hat, verhaftet und zusammen mit Rosa Fröhlich im Polizeiwagen abgeführt. Die Bevölkerung kann aufatmen: «Die Stadt war in Jubel, weil Unrats Verhaftung beschlossen war. Endlich! Der Druck ihres eigenen Lasters ward von ihr genommen, da die Gelegenheit dazu entfernt ward. Man warf, zu sich kommend, einen Blick auf die Leichen ringsumher und entdeckte, dass es höchste Zeit sei. Warum man eigentlich so lange gewartet hatte?»
Professor Unrat, von seinem Autor in wenigen Wochen niedergeschrieben, ist kein grosser Roman. Seine Figuren, die in ihrem karikierenden Expressionismus an die Zeichnungen von George Grosz und Otto Dix in der Weimarer Republik erinnern, sind Marionetten, nicht Menschen aus Fleisch und Blut. Man hat zwar in den 1970er-Jahren, als die Reformpädagogen die Klassiker verdammten und die Trivialliteratur zum Schulstoff erklärten, versucht, Heinrich Mann über seinen Bruder Thomas zu stellen. Aber richtig bleibt eben doch, dass der Professor Unrat bei Weitem nicht an die Buddenbrooks heranreicht. Was Thomas Mann übrigens klar erkannte, wenn er über das Buch seines Bruders urteilte: «Das alles ist das amüsanteste und leichtfertigste Zeug, das seit langem in Deutschland geschrieben wurde.» Und in Thomas Manns Tagebuch steht der böse, auf den Bruder gemünzte Satz zu lesen: «Ich halte es für unmoralisch, aus Furcht vor den Leiden des Müssigganges ein schlechtes Buch nach dem andern zu schreiben.»
In Thomas Manns Urteil zu Professor Unrat schwang unterschwellig schon eine grundsätzliche Ablehnung mit, die sich während des Ersten Weltkriegs zum eigentlichen Bruderzwist vertiefte. Heinrich Manns Buch übte eine beissende Kritik am wilhelminischen Staat und seinem Bürgertum, die der Bruder nicht teilte. Der Meinungsunterschied verdeutlichte sich, als Heinrich Mann im Jahr 1915 seine Position in einem Essay über den französischen Schriftsteller Émile Zola verdeutlichte. Unmissverständlich, wenn auch wegen der Zensur leicht verhüllt, bekannte sich Heinrich Mann zur westlichen Demokratie und zur friedlichen Konfliktlösung und schrieb: «Ein Land, das einzig auf Gewalt bestanden hat und nicht auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, ein Reich, in dem nur befohlen und gehorcht, verdient und ausgebeutet, des Menschen aber nie geachtet wird, kann nicht siegen, und zöge es aus mit übermenschlicher Macht.» In gewissen Passagen seines Essays griff Heinrich Mann zudem seinen Bruder persönlich an, wobei sich der Neid auf den Autor der Buddenbrooks nicht immer unterdrücken liess, so etwa, wenn er schrieb: «Sache derer, die früh vertrocknen sollen, ist es, schon zu Anfang ihrer zwanzig Jahre bewusst und weltgerecht hinzutreten. Ein Schöpfer wird spät Mann.»
Der Zola-Essay erregte den Zorn Thomas Manns, der im wilhelminischen Reich einen freiheitlichen Staat sah und den Krieg als Chance zur geistigen Erneuerung begriff. Diesem Zorn ist es zu danken, wenn Thomas Mann 1918 in einer umfangreichen Schrift unter dem Titel Betrachtungen eines Unpolitischen seine eigenen Auffassungen begründete und gleichzeitig seinem Bruder, den er verächtlich einen «Zivilisationsliteraten» nannte, entgegentrat. Von Thomas Manns Betrachtungen, einem der wichtigsten deutschsprachigen Texte zum Ersten Weltkrieg, wird noch die Rede sein.
Dem Professor Unrat war ein merkwürdiges Schicksal beschieden. Im Jahr 1929 wurde der Roman vom amerikanischen Regisseur Josef von Sternberg unter dem Titel Der blaue Engel verfilmt. Der Professor wurde vom Charakterdarsteller Emil Jannings gespielt; die Rolle der Rosa Fröhlich übernahm die noch kaum bekannte Marlene Dietrich. In Sternbergs Inszenierung wurde Unrat zur skurrilen Nebenfigur, und die «Chanteuse» ging als dämonische Verführerin in die Filmgeschichte ein. Aus dem «Mondlied» der Rosa Fröhlich wurde nun Friedrich Hollaenders weltberühmte Melodie: «Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt». Der Film war weltweit erfolgreich. Heinrich Mann war mit der Inszenierung jedoch nicht einverstanden: «Professor Unrat war die gestürzte Autorität», schrieb er. «Jetzt ist er das bedauernswerte Opfer des Vamps.»
Zehn Jahre nach dem Erscheinen des Professor Unrat setzte Heinrich Mann seine Kritik am wilhelminischen Staat im Roman Der Untertan fort. Erzählt wird hier die Lebensgeschichte des Diederich Hessling, eines Menschen von einfacher Geistesbeschaffenheit und erbärmlichem Charakter, der sich in der wilhelminischen Klassengesellschaft skrupellos und mit Erfolg emporarbeitet. Diese Gesellschaft funktioniert in Heinrich Manns Darstellung nach dem Gesetz von Befehl und Gehorsam und ist zutiefst undemokratisch, unliberal und militaristisch. Sie begünstigt die Ungerechtigkeit, die Verachtung Andersdenkender und den Antisemitismus. Heinrich Manns Kritik wird mit einer stilistischen Drastik und eifernden Radikalität vorgetragen, die Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen lassen. Es wundert nicht, wenn Der Untertan zum umstrittensten Buch Heinrich Manns geworden ist. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler kam nach der Lektüre zu der Erkenntnis: «Kein Historiker könnte das je so eindringlich beschreiben, wie dies Heinrich Mann im Untertan getan hat.» Sein Kollege Thomas Nipperdey stellt dagegen fest: «Der Roman ist ein engagierter, aggressiver, kritischer Tendenzroman, er will nicht zeigen, wie es – sine ira et studio – eigentlich gewesen ist, sondern anklagen und verändern, nicht ein abgewogenes Ganzes bieten, sondern die eigentliche Gefahr benennen.»
Das Gymnasium, wie Heinrich Mann es im Professor Unrat geschildert hat, ist übrigens an der Schwelle zum 20. Jahrhundert auffallend häufig zum Gegenstand literarischer Darstellung geworden. Fast gleichzeitig mit diesem Buch, 1906, erschienen zwei weitere Werke zur selben Thematik: Hermann Hesses Unterm Rad und Robert Musils Verwirrungen des Zöglings Törless. Beide Romane spielen in Internatsschulen auf dem Land und sind von den Jugenderfahrungen ihrer Autoren geprägt. Im Unterschied zu Professor Unrat steht jedoch nicht ein Lehrer, sondern stehen die Schüler im Vordergrund. Hesse und Musil zeigen, wie abweisend oder indifferent die Lehrerschaft den psychischen Problemen der heranwachsenden Menschen begegnet. Oder, in Hesses Worten: «Vor nichts graut Lehrern so sehr wie vor den seltsamen Erscheinungen, die am Wesen früh entwickelter Knaben in dem ohnehin gefährlichen Alter der beginnenden Jünglingsgärung hervortreten.» Und weiter: «Ein Schulmeister hat lieber einige Esel als ein Genie in seiner Klasse, und genau betrachtet hat er ja recht, denn seine Aufgabe ist es nicht, extravagante Geister heranzubilden, sondern gute Lateiner, Rechner und Biedermänner.»
3. Émile Zola, «J’accuse» (1898)
Deutsch: «Ich klage an» (1898)
Eigentlich handelt es sich bloss um einen Brief, einen Leitartikel, der als schmale Broschüre im Druck herauskam – und dennoch hat selten ein Text so Geschichte gemacht wie dieser. Am 13. Januar 1898 erschien in der französischen Tageszeitung L’Aurore ein offener Brief an den Präsidenten der Republik, Félix Faure. Der provozierende Titel hiess «Ich klage an» und war vom damaligen Chefredaktor dieser Zeitung, dem späteren Politiker Georges Clemenceau, gewählt worden. Der Verfasser war Émile Zola, damals der bekannteste Schriftsteller Frankreichs. In seinem Brief trat Zola für die Unschuld eines Hauptmanns Alfred Dreyfus ein, der wegen Spionage für das Deutsche Reich zu lebenslänglicher Haft auf der berüchtigten Île du Diable in Französisch-Guayana verurteilt worden war. Der Brief enthielt schwere Vorwürfe an die Spitzen der französischen Armee, die der Schriftsteller beschuldigte, Dreyfus ohne stichhaltige Beweise verurteilt zu haben.
Doch alles schön der Reihe nach. Die ganze Angelegenheit, die als Dreyfus-Affäre in die Geschichte eingegangen ist, beginnt damit, dass die Putzfrau der deutschen Botschaft in Paris im September 1894 einen Zettel aus dem Papierkorb des deutschen Militärattachés Schwartzkoppen fischt. Die Putzfrau steht im Dienst des französischen Nachrichtendienstes, und der Zettel, als «bordereau» in die Geschichte eingegangen, enthält geheime Angaben zur artilleristischen Bewaffnung der französischen Armee. Der Chef des Nachrichtendienstes und das Kriegsministerium werden informiert, ebenso der Staatspräsident. Die Abklärungen lenken den Verdacht auf den Hauptmann Dreyfus, einen Juden, der dem Generalstab zugeteilt worden ist. Im Januar 1895 wird der Offizier, obwohl Zweifel an der Sorgfalt der gerichtlichen Untersuchung laut geworden sind, wegen Spionage zu lebenslänglicher Haft verurteilt, degradiert und auf die Île du Diable verschickt.
Doch Dreyfus ist nicht ohne Freunde und einflussreiche Persönlichkeiten, die sich seiner Sache annehmen und eine Revision des Prozesses anstreben. Zu diesen gehören sein Bruder Mathieu, der Schriftsteller Bernard Lazare und der einflussreiche Senator Scheurer-Kestner. Auch der neu ernannte Chef des Nachrichtendienstes, Oberst Picquart, misstraut der Beweiskraft der gegen Dreyfus erhobenen Vorwürfe. Doch die Spitzen der Armeeführung, traditionell antisemitisch gesinnt und aus Furcht, sich eine Blösse zu geben, verschliessen sich jeder Kritik. Die Nachforschungen von Picquart werden als störend empfunden, und er wird zu den Kolonialtruppen nach Tunesien strafversetzt. Ein parlamentarischer Vorstoss bleibt ohne Erfolg. In der Presse und in der Bevölkerung wird die Dreyfus-Affäre zum leidenschaftlich diskutierten Gesprächsgegenstand. Es kommt zu einer Polarisierung der öffentlichen Meinung, die, vereinfacht ausgedrückt, die fortschrittliche Linke der «dreyfusards» mit der konservativen Rechten, den «antidreyfusards» konfrontiert.
Im Januar 1898 zündet Émile Zola die Bombe seines offenen Briefes an den Staatspräsidenten. Mit allen Mitteln überzeugender Rhetorik, die der französischen Literatur von den Kanzelpredigten Bossuets bis zu den Reden des Generals de Gaulle zu Gebote steht, tritt Zola für die Unschuld des Hauptmanns Dreyfus ein. Zu Beginn seines Schreibens bezeichnet er das Urteil des Militärgerichts als ein Schandmal, welches das Ansehen des Staatspräsidenten und die Ehre der Nation beflecke. Dann fährt er fort: «Meine Pflicht ist es zu sprechen; ich will nicht Komplize sein. Meine Nächte würden heimgesucht vom Geist des unschuldig Verurteilten, der dort drüben die schlimmsten Folterqualen erleidet für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Ihnen, Herr Präsident, rufe ich die Wahrheit zu, mit aller Widerstandskraft, deren ein ehrenwerter Mann fähig ist.»
In der Folge schildert Zola eingehend den Verlauf der Untersuchung gegen Dreyfus, weist auf Unklarheiten, Unstimmigkeiten und Vertuschungen hin und lenkt das Interesse auf einen Offizier namens Esterhazy, einen schlecht beleumdeten, aber von seinen Vorgesetzten gedeckten Lebemann, den schon Picquart als Verfasser des «bordereau» ausgemacht hatte. Seine Analyse schliesst Zola mit den Worten: «Das ist die simple Wahrheit, Herr Präsident, und sie ist erschreckend, sie wird der Schandfleck ihrer Präsidentschaft sein. Ich weiss wohl, dass Sie in dieser Angelegenheit machtlos, dass Sie ein Gefangener der Verfassung und Ihrer Umgebung sind. Und dennoch haben Sie eine Menschenpflicht, die Sie bedenken und die Sie erfüllen müssen. Nicht dass ich im Geringsten an meinem Triumph zweifelte. Denn die Wahrheit ist im Vormarsch und nichts wird sie aufhalten.»
Dann nennt Zola die Hauptverantwortlichen für den Justizirrtum beim Namen. Eine ganze Reihe von Generälen wird mit einer Deutlichkeit, welche die damaligen Leser als unerhört empfinden mussten, der Mittäter- und Komplizenschaft beschuldigt. Und der Schriftsteller schliesst seinen Brief mit den Worten: «Mein flammender Protest ist nur der Schrei meiner Seele. Wage man es doch, mich vor das Schwurgericht zu zitieren. Sollen doch die Untersuchungen im Licht der Öffentlichkeit geführt werden. Ich warte.»
Émile Zolas «Ich klage an» erregte unerhörtes Aufsehen. Man riss sich die Zeitung aus den Händen, vervielfältigte den Text, klebte ihn an alle Mauern von Paris. Der Verfasser wurde wegen «Beleidigung der Armee» zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und flüchtete ins Exil nach England. «Was auch immer die Folgen sein mögen», schrieb er seiner Frau, «ich bin stark genug, allem die Stirn zu bieten. Ich gestehe, dass dieses Drama mich leidenschaftlich bewegt, ich kenne nichts Schöneres.» Zwar irrte sich Zola in manchen Punkten seines offenen Briefes und urteilte mit einer Empörung, die nicht überall gerechtfertigt war. Aber nach dieser Publikation war die Frage nach der Rechtmässigkeit des Urteils gegen Dreyfus nicht mehr zu unterdrücken. Im August 1898 gestand einer der schlimmsten Gegner des Hauptmanns, der Nachrichtenoffizier Henry, ein falsches Dokument angefertigt zu haben. Er wurde inhaftiert und schnitt sich mit einem Rasiermesser, das man ihm vorsorglich in die Zelle mitgegeben hatte, die Kehle durch.
Nun kam die Position der Gegner von Dreyfus ins Wanken. Doch der Weg zu einer Revision des Prozesses und zur völligen Rehabilitierung von Dreyfus war noch weit. Das Ringen zwischen «dreyfusards» und «antidreyfusards» setzte sich in Presse und Öffentlichkeit fort, und bald gewann die eine, dann wieder die andere Seite die Oberhand. Politiker, Schriftsteller und Künstler unterschrieben Artikel und Manifeste für und gegen den jüdischen Hauptmann. Bald ging es nicht mehr nur um die Person des Angeklagten, sondern, wie der Schriftsteller und «dreyfusard» Charles Péguy es formulierte, um das «ewige Heil Frankreichs». Und Péguys Kollege, der nationalistische «antidreyfusard» Maurice Barrès, schrieb: «Bedenken wir, dass unsere Worte nicht nur unter dem Aspekt der ‹Affaire Dreyfus› verstanden werden dürfen. Wir stehen über der Affaire und werden sie überleben … Dreyfus ist nur ein Zwischenfall. Letztlich ist es nicht Dreyfus, sondern es sind die ‹dreyfusards›, die es niederzuschlagen gilt.»
Im Jahr 1899 schien eine Rehabilitation von Dreyfus möglich; doch ein Militärgericht, das in Rennes tagte, begnügte sich damit, die Strafe des Hauptmanns Dreyfus auf zehn Jahre Zwangsarbeit herabzusetzen und mildernde Umstände geltend zu machen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die «dreyfusards» die Oberhand gewonnen, und die Mehrheit der Bevölkerung stand hinter dem Hauptmann und hatte für das Urteil des Militärgerichts kein Verständnis. Für Regierung und Armee ging es darum, die peinliche Angelegenheit, die Frankreich polarisiert und im Innersten aufgewühlt hatte, möglichst rasch abzuschliessen. Der Staatspräsident bot Dreyfus die Begnadigung an, und dieser nahm das Angebot zur Enttäuschung seines engsten Freundeskreises an. Erleichterung sprach aus den Worten des Kriegsministers, der den Armeeangehörigen das Ende der peinlichen Angelegenheit verkünden konnte: «Ich wiederhole es: Dieser Zwischenfall ist abgeschlossen. Ich verlange von Euch, und falls nötig befehle ich Euch, die Vergangenheit zu vergessen und an die Zukunft zu denken. Mit allen meinen Kameraden rufe ich aus ganzem Herzen: Es lebe die Armee, welche keiner Partei, sondern allein Frankreich angehört.»
Es dauerte freilich noch bis zum Juli 1906, bis das Urteil von Rennes aufgehoben und die völlige Unschuld des Hauptmanns Dreyfus festgestellt wurde. In der «Ecole militaire», in der Dreyfus vor über zehn Jahren degradiert worden war, wurde er zum «Ritter der Ehrenlegion» ernannt. Oberst Picquart, eine Figur von seltener Integrität im üblen Intrigenspiel der Militärs, wurde zum General befördert. Die Frage, wer in Wahrheit der Spion war, der dem Militärattaché Schwartzkoppen die geheimen Informationen zugespielt hatte, ist noch heute nicht völlig geklärt. Der stärkste Verdacht fällt auf Esterhazy. Aber es könnte sein, dass dieser Esterhazy nur eine Marionette in den Händen von rechtsradikalen Dunkelmännern war, welche den Juden schaden wollten. Fest steht freilich dies: Der Hauptmann Alfred Dreyfus war unschuldig, und seine Rehabilitation erfolgte völlig zu Recht.
Émile Zolas offener Brief wird heute in vielen französischen Lycées gelesen als ein Text, in dem Inhalt und Form, Leidenschaft und Vernunft sich in vollkommener Balance halten. Die Dreyfus-Affäre ist aber auch ein Lehrstück, an dem die vielfältigsten Formen menschlicher Wesensart, Bösartigkeit und Herzensgüte, Dummheit und Perfidie, Niedertracht und Edelmut, Feigheit und Zivilcourage, zu studieren sind. Wer die Geschichte des Hauptmanns Dreyfus kennt, möchte man meinen, dem ist nichts Menschliches mehr fremd. Aber auch in geschichtlicher Hinsicht ist die Dreyfus-Affäre von grosser Bedeutung. Mit ihr und durch sie wurde der Blick auf das 20. Jahrhundert frei. Die Dominanz der Militärs, die in Frankreichs Geschichte immer wieder zu politischen Interventionen führte, wurde in Schranken gewiesen. Die republikanische Auseinandersetzung zwischen sozialistischer Linken und konservativer Rechten wurde zum Grundmuster des politischen Diskurses im 20. Jahrhundert. Die Presse wurde zu dem wichtigen Medium politischer Meinungsbildung, das sie bis heute geblieben ist. Im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre wurde erstmals der Begriff des «Intellektuellen» geprägt, des Schriftstellers, dem in der modernen Gesellschaft der Auftrag zugewiesen ist, den Standpunkt des Moralisten in die Politik einzubringen.