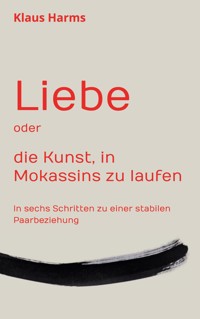
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dr. Klaus Harms, Studium der Ev. Theologie, Pädagogik und Psychologie betreibt eine Praxis für Psychologische Beratung in Wuppertal - Einzelberatung, Paarberatung und Supervision. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen verfasste er drei Kinderbücher und zwei Romane. Er lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Frau in einem ehemaligen Bahnstellwerk an der Nordbahntrasse, das Wohnhaus, Praxis, Atelier und Kulturort in einem ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe oder die Kunst, in Mokassins zu laufen …
ist kein Ratgeberbuch im herkömmlichen Sinne. Es vermittelt nicht einfach Rezepte, deren praktische Anwendung Erfolg verspricht.
Es will vielmehr eine Haltung vermitteln, eine grundlegende Gestimmtheit und Offenheit, die den Raum weitet für Wohlwollen und Unterstützung in Ihrer Partnerschaft.
Die alte Indianerweisheit, man könne einen Menschen nur verstehen, wenn man hundert Meilen in dessen Mokassins gewandert sei, gab dem Skript seinen Namen.
Liebe heißt Verstehen, so lautet ein koreanisches Sprichwort. Und einer der bedeutensten Hermeneutiker des 20. Jahrhunderts, Ernst Fuchs, schrieb einmal: Verstehen gründet im Einverständnis. Darum geht es.
Dieses Büchlein beschäftigt sich mit der Vermittlung einer Grundhaltung des liebenden Interesses, des Einverständnisses mit dem So- und Anderssein des Partners.
Es nimmt den Leser / die Leserin mit auf eine Gedankenreise in sechs Etappen, die genau da beginnt, wo Sie sich jetzt gerade befinden, bei Ihnen!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Schritt I
Verstehen, was
Stabilität
bedeutet
Schritt II
Selbstfürsorge lernen – Balance finden
Schritt III
Dem Glück Raum geben
Schritt IV
Selbstreflektion – Entdecken, was ich mitbringe in die Partnerschaft
Schritt V
100 Meilen in den Mokassins des anderen – Aktives Zuhören
Schritt VI
Lernen, Auseinandersetzungen zu führen
Liebe oder die Kunst,
in Mokassins zu laufen
In sechs Schritten zu einer stabilen Paarbeziehung
Vorab:
Warum haben Sie zu diesem Buch gegriffen? Hat der Titel Sie angesprochen? Haben Sie das wie ein Versprechen gelesen:
In sechs Schritten zu einer stabilen Paarbeziehung?
Dann muss ich Sie enttäuschen.
Dieses Buch enthält keine Rezepte mit Erfolgsgarantie. Es ist auch keine wissenschaftliche Abhandlung. Es gibt Erfahrungen weiter, Erfahrungen, die ich in vielen Jahren mit Paaren gesammelt habe, die in meiner Beratungspraxis Klarheit und Wachstum gesucht haben. Und es gibt Impulse, hier und da auch praktische Anleitungen zB zu vertiefender Selbstreflexion oder zur Verbesserung der Kommunikation. Der Ton liegt dabei weniger auf Techniken, die man durch Nachahmung zur Anwendung bringen kann. Es geht vielmehr um die Vermittlung einer Haltung mir selbst und dem Partner / der Partnerin gegenüber. Dieses Buch schöpft ebenso aus den Erkenntnissen der humanistischen Psychologie, wie aus buddhistischen Erfahrungen. Beide Geisteshaltungen gehen gut zusammen und ergänzen sich. Sie haben gemeinsam, dass sie an den eigenen Erfahrungen überprüfbar sind.
Es gibt eine Flut von Literatur über Paardynamik, Paarphasen, Paarkonfigurationen und -typologien und vieles mehr. Hier finden Sie kurz und knapp auf den Punkt gebracht, was sich in meiner Praxis bewährt hat, und wovon ausgehend ich arbeite. Die Zeilen, die Sie jetzt lesen werden, sind nicht nur Stoff zum Nachdenken, sondern vor allem Anreiz zur Veränderung. Gedanken bereiten das Handeln vor, aber erst das Handeln schafft reale Veränderung.
Es wird also darauf ankommen, dass Sie dieses Buch nicht nur lesen, sondern ausprobieren, was Sie gelesen haben, schauen, was sich für Sie bewährt und was nicht – auf dem Weg zu einer stabilen Paarbeziehung. Aber wer weiß? Vielleicht leben Sie ja auch in einer stabilen Beziehung und entdecken es beim Stöbern auf den folgenden Seiten!
Vielleicht erstaunt Sie, dass über weite Strecken nur von Ihnen die Rede ist, der oder die Sie dieses Buch lesen. Eine stabile Paarbeziehung besteht doch aus zwei Menschen, und Sie erwarten möglicherweise, dass Sie von Anfang an Impulse für die Gestaltung des gemeinsamen Lebens bekommen. Dieses Buch beginnt aber aus gutem Grund bei Ihnen, der Leserin, dem Leser, und lässt sich Zeit damit, Ihre Balance, Ihre Selbstfürsorge, Ihr Glück und Ihre Selbstreflexion zu thematisieren. Wenn Sie sich eine stabile Zweierbeziehung wünschen, ist es gut, bei sich selbst anzufangen, nach eigener Stabilität zu suchen, sich zu fragen: Was bringe ich eigentlich mit in unser Leben als Paar? Einer ist ja schon mal die Hälfte eines Paares. Und wenn die Hälfte stabil, ausbalanciert und glücklich ist, wird die anderen Hälfte davon profitieren. Wer in der Beziehung zu einem anderen Menschen etwas ändern, verbessern möchte, sollte bei sich selbst anfangen.
Also: Lesen Sie der Reihe nach und halten Sie durch! Ihre Geduld wird belohnt. Versprochen!
Noch ein Hinweis: Zugunsten der Lesbarkeit habe ich überwiegend auf die vielgeschlechtliche Sprachform verzichtet, schließe aber in allen Fällen die jeweils anderen Geschlechtszugehörigkeiten mit ein.
Schritt I:
Verstehen, was Stabilität bedeutet
Denken wir einen Moment darüber nach, was stabil bedeutet. Im Allgemeinen versteht man etwas als stabil, das fest ist, und fest ist etwas, das nicht weich ist. Wir denken eher an hart, unnachgiebig, dauerhaft. Aber bei dauerhaft werde ich nachdenklich. Während ich diese Zeilen schreibe, sind Spürhunde und Rettungsmannschaften im Nahen Osten im Grenzgebiet von Syrien und der Türkei damit beschäftigt, in den Trümmern eingestürzter Häuser nach Überlebenden zu suchen. Ein Erdbeben hat zahlreiche Opfer gefordert. Warum? Warum hat man nach den letzten Katastrophen die Häuser nicht erdbebensicher gebaut? Die Menschen in der Region machen ihren Regierungen heftige Vorwürfe. Man hätte in stabile Häuser investieren müssen! Aber was bedeutet das – dickere Mauern, festere, unnachgiebige Baustoffe?
Ein Blick auf die Fachwerkhäuser meiner bergischen Heimat gibt Antwort: Das Gegenteil ist richtig! Das Balkenwerk eines Fachwerkhauses ist nicht unnachgiebig. Es ist ein bestens durchdachtes, elastisches Geflecht aus Holz, das Erdbewegungen nachgibt, ohne die Bindung zu verlieren. Wer diese hunderte von Jahren alten Häuser da stehen sieht – krumm und schief, aber offensichtlich stabil, der versteht, dass Dauerhaftigkeit nur durch Beweglichkeit zu erreichen ist. Flexible Baustoffe, intelligente, elastische Verbindungen zwischen Bauelementen halten Verwerfungen und Erschütterungen stand. Nur der biegsame Ast hält dem Sturm stand, Todholz bricht.
Was ist dann eine stabile Paarbeziehung? Eine intelligente, elastische Verbindung zweier Menschen?
Ja! – Fügen wir noch liebevoll hinzu, dann wird es vollständig: Eine stabile Paarbeziehung ist eine liebevolle, intelligente, bewegliche Beziehung zwischen zwei Menschen.
In diesem Buch liegt ein besonderer Akzent auf der Beweglichkeit, der Veränderbarkeit von Beziehungen. Viele Partnerschaften zerbrechen an dem unbeugsamen Glauben an die Starrheit der Verhältnisse. Gedankenkonstrukte schnüren Ver-änderungsimpulse ein, bis unumstößlich festzustehen scheint, dass ich dies nicht tun kann, weil das der Fall ist, und dass ich das nicht tun kann, weil dies dagegen spricht. Festgehalten von Grübeleien verlieren wir, was uns einmal auszeichnete: unsere Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit, selbst etwas zu bewirken, sich handelnd und verändernd mit der Welt auseinanderzusetzen. Nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Und nur die Partnerschaft bleibt stabil, die nicht, von der Angst vor Veränderung eingeschnürt, in bleibenden Verhältnissen erstarrt.
Sie brauchen also ein wenig Mut, wenn Sie dieses Buch weiterlesen wollen. Und vielleicht hilft Ihnen Ihre Neugier, vielleicht auch eine Prise Risikobereitschaft. Jede Veränderung birgt Risiken. Aber das größte Risiko scheint mir das unnachgiebige Festhalten an den bestehenden Verhältnissen zu sein.
Eine Kollegin sagte mir einmal, Therapie und Beratung würden im Wesentlichen die Überzeugung und den Glauben vermitteln, dass alles veränderbar ist. Wer das verinnerlicht habe, werde den Weg aus der Krise mit eigener Intuition und Kraft finden.
Vielleicht befremdet Sie das Wort Glaube an dieser Stelle. Gewöhnlich denken wir, dass Glaube da anfängt, wo Wissen aufhört. Wer nichts weiß, muss alles glauben, lesen wir gelegentlich auf Aktionskarten. Was dann so viel bedeutet wie: Bildung und Wissen sind Aufklärung, sind Garanten für selbständiges Denken – Glaube dagegen ist unmündiges Fürwahrhalten.
Als Theologe, der ich unter anderem bin, und unter psychologischen Gesichtspunkten kann Glaube aber eine völlig andere Bedeutung haben. Glaube kann auch verstanden werden als eine gefühlte Tendenz, die dem Wissen wortlos vorausgeht. Es gibt innere Impulse und Tendenzen, für die wir keine Sprache haben, die wir darum nicht logisch überprüfen können, die aber eine leitende Kraft entwickeln. Vorsprachliche, intuitive Impulse, die dem kritischen Bewusstsein entzogen sind. Aus ihnen können Überzeugungen entstehen, der feste Glaube an Möglichkeiten, die sich weder aus dem Wissen noch aus dem Denken ableiten lassen.
Nennen Sie es Intuition, nennen Sie es Bauchgefühl, für mich ist es eine Art innerer Kompass, ein verlässlicher Richtungsweiser, zusammen mit meiner bewussten Wahrnehmung ein vertrauenswürdiger Navigator. Und der zeigt an, wann Veränderungen notwendig sind.
Denn nur die Partnerschaft ist dauerhaft, die Spielräume für Wandel und Wachstum schafft. Nur die Partnerschaft ist stabil, die den Mut zur Veränderung hat.
Noch einmal: Nichts muss bleiben, wie es ist! Das ist die Voraussetzung für Stabilität.
Schritt II:
Selbstfürsorge lernen – Balance finden
Nach einem bewährten buddhistischen Grundsatz sollte ich, wenn ich die Welt verändern will, bei mir selbst anfangen. Übersetzen wir das in die Sphäre der Paarbeziehung, dann bedeutet das: Wenn ich in meiner Beziehung etwas verändern möchte, muss ich zuerst mich selbst verändern. Was ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, erreichen und erleben möchte, muss zunächst bei mir angebahnt und möglich werden. Wenn ich also eine glückliche, in der Balance befindliche Beziehung wünsche, muss ich zuerst mich selbst in die Balance bringen und für mein eigenes Glück sorgen.
Wohlgemerkt: Zuerst! Deshalb beschäftigt sich dieses Buch über weite Strecken mit mir selbst – dem Leser, der Leserin, bevor es dezidiert auf das Paargeschehen eingeht.
Vor einiger Zeit hatte ich ein Paar in der Beratung, das über Heirat diskutierte. Der Wunsch nach einem höheren Grad an Verbindlichkeit und Etablierung ging vor allem vom Mann aus. Seine Partnerin dagegen hatte einen gravierenden Einwand: Wenn sie sich jetzt entschließen würde, seinem Wunsch zu entsprechen, bekäme er eine unausgeglichene Frau, die mit zwei Kindern (aus einer vorangegangenen Ehe), Beruf und Haushalt bis an die Grenzen gefordert sei. Temporäre Treffen könne sie sich weiterhin vorstellen, auch sei ihr der Gedanke an eine dauerhafte Bindung gar nicht fern. Aber sie brauche noch Zeit, um ihr Leben so weit zu ordnen, dass sie sich erst einmal selbst darin wohlfühlen könne.
Ein lebenskluger Gedanke, klar und entschlossen vorgetragen.
Wie oft erlebe ich das Gegenteil! Man fühlt sich im eigenen, augenblicklichen Leben nicht wohl, hofft, durch eine Partnerschaft, durch gemeinsames Wohnen, durch Heirat, durch die Geburt von Kindern auf Besserung und macht dann die schmerzliche Erfahrung: Es wird nicht besser, es wird stattdessen schwieriger! Die alte Geschichte, die von der armen Braut erzählt, die einen armen Bräutigam heiratet – in der Hoffnung, dass beide reich werden. »Zwei sind mehr denn einer«, heißt es in der Bibel. Ja, aber nicht, wenn sich Defizite addieren. Zwei sind mehr, und eine Partnerschaft ist ein Gewinn für beide, wenn beide sich grundsätzlich wohl fühlen in ihrem Leben und sich jeder für sich in der Balance befinden. Grundsätzlich. Dass man sich in Krisen unterstützt und hilft, ist selbstverständlich, aber die Partnerschaft ist kein Therapeutikum und die Hoffnung, an einer Partnerschaft zu genesen, führt auf einen Irrweg. Ich muss schon eigene Stabilität und Balance mitbringen, wenn ich mich einem anderen Menschen als Partner, als Partnerin an die Seite stelle.
Halten wir auch hier einen Moment inne und überlegen, was Balance bedeutet, und wie ich zu einem ausbalancierten Leben finde, in dem ich mich wohl fühlen kann. Fangen wir bei der Dysbalance, der Unausgeglichenheit an, um dies besser zu verstehen:
Beim letzten Sturmtief sind nicht nur viele Bäume gefallen, auch Autos wurden umgeworfen und Flugzeuge torkelten der Landebahn entgegen. In der Tagesschau konnte man solch eine missglückte Landung miterleben.
Die Maschine schwebt heran, wird vom Sturm gepackt und in Schräglage gebracht. Es gelingt dem Piloten nicht, sie rechtzeitig in die Balance zu bringen. So kann er keinen Touchdown wagen, so kann er nicht landen.
Also gibt er Vollgas und startet durch, um es erneut zu versuchen.
Nur eine unwichtige Begebenheit? Schnell vergessen? Oder können wir dieses Video auch als Sinnbild für unser Leben verstehen?
Das kennen wir nur zu gut: Dass das Leben uns packt und in Schräglage bringt, dass wir aus der Balance geraten und dann keinen Kontakt mehr zur Erde finden. Touchdown – Erdberührung, Landen, Ankommen – das geht nicht ohne Balance. Und was tun wir gewöhnlich, wenn wir nicht ankommen können, uns nicht erden können?
Wir tun, was der Pilot in der schlingernden Maschine tat: Wir geben Vollgas und starten durch, um es erneut zu versuchen. Und manch einer und manch eine starten durch und starten durch – und kommen niemals an.
Ein aus der Balance geratenes Leben – das ist nichts ungewöhnliches.
Das begegnet uns auf Schritt und Tritt. Nehmen wir das Beispiel überzogener Leistungsanforderungen: Sportler, die die Leistung nicht erbringen können, die man von ihnen oder die sie von sich erwarten, was tun sie? Sie dopen sich, sie nehmen Medikamente, die ihnen dieses Quäntchen mehr ermöglichen, dass sie von der Konkurrenz abheben soll. Und sie zahlen einen hohen Preis dafür, sie zahlen mit ihrer Gesundheit.
Oder Manager, von deren wirklichem Leben wir so wenig wissen. In den vergangenen Jahren ist der Kokainverbrauch oder besser: -missbrauch in unserem Land auf einen Rekordwert gestiegen. Viele Spitzenkräfte in der Industrie dopen sich. Viele Politiker und Künstler auch. Alkohol ist das gängigste Mittel, um »runter« zu kommen, wie wir sagen. Touchdown mit Hilfsmitteln.
Und Aufputschmittel braucht man dann, um wieder hoch zu kommen, um durchzustarten.
Selbst in Klassenzimmern und schon lange in Seminarräumen in den Universitäten warten solche Mittel und Mittelchen unter dem Pult auf ihren Einsatz. Es scheint, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, die sich selbst nicht mehr aushält, jedenfalls nicht ohne Dope.
Schauen wir uns die letzten Jahrzehnte an, müssen wir nicht lange grübeln, was uns so nachhaltig aus der Balance gebracht hat.
Die Nachkriegsjahre waren noch von einer Art gemütlichem Optimismus erfüllt. Krieg und Not waren Vergangenheit. Die Wirtschaft zog wieder an, Existenzgründungen waren möglich, Frieden und Wohlstand gaben den Menschen das Gefühl, endlich wieder sorglos leben und bleiben zu können. Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt durch die Jugendrevolte, die Hippie-Bewegung, die kritische Auseinandersetzung mit dem Muff der Nazizeit und der Adenauer – Ära. Ein Gefühl von geistiger Befreiung machte sich breit, die Frauenbewegung erkämpfte längst fällige Rechte und Respekt.





























