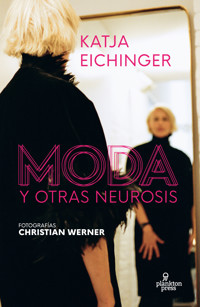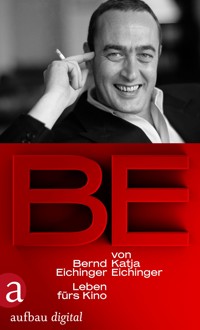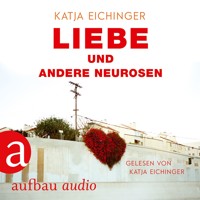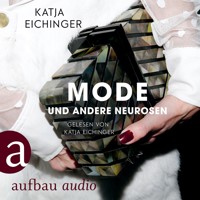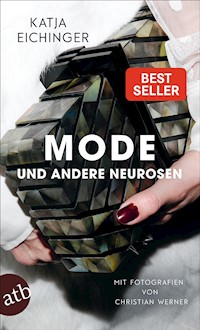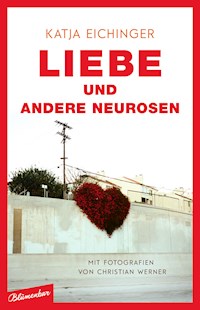
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Wer hätte gedacht, dass man sich lesend so gut über die Liebe unterhalten kann?« Johanna Adorján
»Katja Eichinger räumt auf. Mit viel Schrott, der in unseren Köpfen über die Themen Leben, Liebe, Tod vor sich hingammelt. Lesen Sie dieses Buch, es könnte Sie etwas intelligenter und lustiger machen.« Inga Humpe
»Katja Eichinger schreibt in ihrem sehr amüsanten Buch Dinge auf, die uns beide weit über das Lesen hinaus beschäftigen – morgens, mittags und abends.« Frauke Finsterwalder & Christian Kracht
Das neue Buch der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Katja Eichinger
Furiose Essays über die Liebe von einer der originellsten Stimmen der Gegenwart
Wen begehren wir? Und was erzählt unser Begehren über uns? Wie hängen Lust, Leidenschaft und Liebe zusammen? In ihrem neuen Band »Liebe und andere Neurosen« schreibt Katja Eichinger in zehn elektrisierenden Essays über das Wechselspiel zwischen Verlangen und Verunsicherung. Sie erzählt Familiengeschichten wie die ihrer Urgroßmutter, die ihre Leben lang unter dem Apfelbaum stand und von dem armen Handwerker träumte, den sie nicht heiraten durfte. Und sie erzählt von eigenen Begegnungen, in denen sich ihr das Wesen der Liebe offenbarte. Ein radikal vergnügliches Buch, geschrieben mit wachem Blick für die Magie und Macht von Liebe heute. Mit Fotografien von Christian Werner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Wen begehren wir? Und was erzählt unser Begehren über uns? Wie hängen Lust, Leidenschaft und Liebe zusammen? In ihrem neuen Band »Liebe und andere Neurosen« schreibt Katja Eichinger in zehn elektrisierenden Essays über das Wechselspiel zwischen Verlangen und Verunsicherung. Sie erzählt Familiengeschichten wie die ihrer Urgroßmutter, die ihre Leben lang unter dem Apfelbaum stand und von dem armen Handwerker träumte, den sie nicht heiraten durfte. Und sie erzählt von eigenen Begegnungen, in denen sich ihr das Wesen der Liebe offenbarte. Ein radikal vergnügliches Buch, geschrieben mit wachem Blick für die Magie und Macht von Liebe heute.
Mit Fotografien von Christian Werner.
Über Katja Eichinger
Katja Eichinger studierte am British Film Institute und arbeitete als Journalistin in London, u. a. für »Vogue«, »Dazed & Confused« und die »Financial Times«. Nach ihrem Bestseller »BE«, der Biographie ihres verstorbenen Mannes Bernd Eichinger, erschien bei Blumenbar 2020 der Essayband »Mode und andere Neurosen«, der ebenfalls ein Bestseller wurde. Neben ihrer Arbeit als Autorin produziert Katja Eichinger Musik. Sie lebt in München und Berlin.
Der Fotograf Christian Werner, geboren 1977, arbeitet für nationale und internationale Zeitschriften wie das ZEITMagazin, 032c, SSENSE und Numéro. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und lebt in Berlin.
www.christianwerner.org
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Katja Eichinger
Liebe und andere Neurosen
Essays
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Intro
Begehren oder Was dir auch gefallen könnte
Leidenschaft oder Der Mann muss ins Haus, und wenn das Klavier raus muss
Lust
Verlieben oder Warum ich demnächst Dave Grohl heiraten werde
Über die Ehe oder Reich mir die Hand, mein Leben
In the Temple of Love – Zweisamkeit
Wo die wilden Tiere leben – Familie
I Sing The Body Electric – Selbstliebe
Jenseits von Eden – Freundschaft
Surrender to the void – Tod und Trennung
Danke
Impressum
Wer von diesem E-Book begeistert ist, liest auch ...
Für alle meine Freunde, die in diesem Buch vorkommen. (Sorry)
But I believe in love. And I know that you do, too.
Nick Cave, Into My Arms
Intro
Vor ein paar Tagen war meine Freundin Lena zu Besuch. Wir hatten zuletzt vor einem Jahr länger geredet. Damals, im Herbst 2020, existierte dieses Buch nur als vage Idee, eine Art »Die Liebe in den Zeiten von Corona« zu schreiben – eine Sammlung von Geschichten über zwischenmenschliche Extremsituationen, bedingt durch eine globale Pandemie. Lena hatte mir in dem langen Video-Telefonat das Buch »Figuren des Begehrens« von René Girard empfohlen. Dieses Buch habe Peter Thiel dazu inspiriert, als erster Finanzier in ein zu diesem Zeitpunkt winziges Start-up-Unternehmen namens Facebook zu investieren. Beim Lesen von Girards Buch kamen mir so viele Assoziationen, Querverbindungen und Erinnerungen, dass mir wieder bewusst wurde, die Liebesdramen in Corona-Zeiten finden nicht in einem Vakuum statt. Ähnlich wie in Gabriel García Márquez’ Roman »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« oder in Thomas Manns »Der Tod in Venedig« eine Epidemie als Katalysator für die psychischen Prozesse der Protagonisten dient, hat auch Corona ein Vergrößerungsglas auf menschliche Gefühle und Verhaltensmuster gehalten. So entstand schließlich das Konzept für das Buch, das Sie in Händen halten: zehn Essays über diese wunderbare, aber oft so schmerzhafte und immer wieder zutiefst rätselhafte Kraft, die unsere Welt in Bewegung hält: die Liebe.
Zwölf Monate später war ich fertig mit dem Schreiben und teilte Lena mit, ich hätte ein Buch mit dem Titel »Liebe und andere Neurosen« verfasst. Lena sah mich verdutzt an: »Neurosen?« Da sie kein Deutsch spricht, hatte sie mein vorheriges Buch »Mode und andere Neurosen« nicht gelesen. Sie wusste nicht, dass ich da eine gewisse Vorliebe habe. »Ja!«, nickte ich eifrig. »Neurosen im Sinne der anhaltenden Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen.« Lena zog die Augenbrauen hoch. »Ich denke, Liebe ist das Gegenteil von einer Neurose. Liebe ist immer eine Entscheidung.« Lena ist mittlerweile schon 27 Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Als ich später mit den beiden essen ging, konnte ich wieder einmal miterleben, wie nah sich die beiden stehen. Keine Frage, was immer auch Lena und ihr Mann unter Liebe verstehen, es funktioniert. Vielleicht ist die Liebe ja wirklich so einfach. Ich entscheide mich und bleibe bei dieser Entscheidung. Dann ist alles gut. Happy End für immer. Jedem Herz – sei es als Goldkettchen am Hals, als Emoji in der Textnachricht oder als Luftballon zum Geburtstag – wohnt eben genau dieses Versprechen inne: dass Liebe einfach ist. Dass es sich hier um ein klares Gefühl handelt, das alle Widersprüche und Zweifel, alle Ängste, Wünsche und heimliche Begehren ausradiert.
In einer Zeit, in der menschliche Kontakte staatlich reguliert werden, ein Buch über die Liebe zu schreiben, hat sich oft so angefühlt, als würde ich von einer einsamen Sternwarte das Leben auf einem fernen Planeten beobachten. Ein schillernder, faszinierend schöner Planet, wo das verträumte Idyll genauso seinen Platz hat wie der dunkle Abgrund. Diese vermeintlich unvereinbaren Gegensätze sind es, die die Liebe zum zentralen Thema der Menschheit machen. Liebe inspiriert uns eben nicht deswegen zu Musik, Poesie, Malerei, provoziert nicht deswegen Kriege, lässt uns nie gekanntes Glück oder Todesverzweiflung erleben, weil sie so einfach ist. Liebe in all ihren Facetten konfrontiert uns immer mit Widersprüchen. Sei es dem Widerspruch zwischen Nähe und Distanz, zwischen Angst und Begehren oder zwischen Spiegelung und Gegensatz. Es ist das ewig Wechselnde, das Schillernde, das Komplizierte, ja, das Neurotische, durch das wir Liebe und damit uns selbst und andere erfahren.
Als ich mich von Lena verabschiedete, bemerkte ich im Bücherregal neben der Wohnungstür die deutsche Erstausgabe von »Die Liebe in den Zeiten der Cholera«. Auf dem Cover war das Bild von einem Dschungel, über das ich in den Monaten zuvor viel nachgedacht hatte und über das auch Sie einiges in diesem Buch erfahren werden. Der Kreis hatte sich geschlossen. Ich war am Ende angelangt. Ich lächelte Lena an und war in diesem Augenblick so glücklich, dass sie meine Freundin ist. Denn sie erinnert mich immer daran, dass Liebe auch einfach sein kann. Dass dieser einfache Glücksmoment, wenn wir einander in aller Aufrichtigkeit schwören »Ich liebe dich«, dass eben dieser Herzensmoment das ist, wonach wir uns alle sehnen. Doch der Weg zum Einfachen läuft eben meist über das Komplizierte. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber genau deswegen ist die Liebe so schön.
Berlin, im Dezember 2021
Begehren oder Was dir auch gefallen könnte
Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier.
Nina Hagen, TV Glotzer (white punks on dope)
Im Frühsommer 2020 fuhr ich mit einem Mietwagen die Autobahn von München in Richtung Norden. Der erste Lockdown war gerade zu Ende gegangen. Es war früh am Morgen. Außer mir kaum Autos auf der Fahrbahn. Der Mietwagen war so schön neu, und ich war ganz begeistert, wie problemlos er die hessischen Berge hinauffuhr. Das war doch mal was anderes als mein behäbiger alter Mercedes, mit dem ich jetzt schon so lange verheiratet bin und in dem ich die schönsten, aber auch die schwersten Autofahrten meines Lebens verbracht habe. In diesem Moment war ich so euphorisiert von meiner neu gewonnenen Freiheit und den schadstoffarmen Errungenschaften der Technik, ich spielte mit dem Gedanken einer automotiven Scheidung. Zu all den unbegrenzten Möglichkeiten, die hinter dem Autobahnhorizont auf mich warteten, könnte doch auch ein neuer Wagen gehören. Und damit auch ein neues Ich. Hochpoliert, ohne den ganzen schweren emotionalen Ballast im Kofferraum. Die Erinnerungen einfach ausradiert. Ich könnte dann einfach die Autobahn langfahren und wie Arnold Schwarzenegger in »Total Recall« sagen: »I zink I just had a labotomy.« In diesem Augenblick schien mir das wirklich toll.
Mein Zukunfts-High fand ein jähes Ende, als ich das Straßenschild für die Autobahnausfahrt Niederaula sah. Erinnerungen kochten hoch. Und damit auch nervige 80er-Jahre-Ohrwürmer wie Nenas »99 Luftballons« (jetzt nicht so schlimm) oder Stings »Russians«, dessen Refrain »I hope the Russians love their children too« für immer in mein Hirn implantiert zu sein scheint (wirklich schlimm). Niederaula. Allein durch das Wort wurde mir klar, wie ultimativ lächerlich der Gedanke war, dass ich meine Erinnerungen einfach mit einem neuen Auto ausmerzen könnte. Waren sie doch auf einem tiefen zellulären, ja buchstäblich genetischen Level ein Teil von mir. Es ist nämlich so, Niederaula ist das nordhessische Dorf, aus dem meine Familie stammt. Die einzige Ausnahme war meine Großmutter, die an der deutsch-polnischen Grenze geboren wurde. Ansonsten kommt meine gesamte Verwandtschaft aus der näheren Umgebung von Niederaula. Der Hof, von dem meine Mutter stammt, wurde kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert gebaut. Über hunderte von Jahren hat sich hier niemand wirklich vom Fleck bewegt und auch niemanden von einem anderen Fleck geheiratet. Erst mein Großvater erweiterte – gegen den Willen seines Vaters, wohlgemerkt – den Genpool, indem er in einer deutschlandweiten Zeitung eine Heiratsannonce aufgab und so meine Großmutter kennenlernte. Hat aber auch nicht viel genützt. Ich habe mal so einen Gen-Test für ethnische Abstammung gemacht. Ich habe wahrscheinlich die langweiligste DNA Deutschlands.
Dass ich bei der Autobahnausfahrt Niederaula an Stings Russen und sentimental-politische Popsongs der 80er denken musste, lag daran, dass sich Niederaula und das dortige Fulda-Tal während des Kalten Krieges am Point Alpha befanden, einem zentralen Beobachtungsstützpunkt der US-Armee. Niederaula lag zwar in der BRD, aber die Grenze zur DDR war nur wenige Kilometer entfernt. Es war der westlichste Punkt des ehemaligen Sowjetblocks beziehungsweise der Staatengemeinschaft des Warschauer Pakts. Mit anderen Worten, Niederaula befand sich in unmittelbarer Nähe des westlichsten Abschnitts des antifaschistischen Schutzwalls, der die DDR gegen den kapitalistischen Imperialismus schützen und ihre Bewohner davon abhalten sollte, sich von der westlichen Konsumgesellschaft ausbeuten zu lassen. Und klar, weglaufen, also sich aus freiem Willen zwischen den unterschiedlichen politischen Systemen entscheiden, konnten sie so natürlich auch nicht. Am Point Alpha standen sich 40 Jahre lang Warschauer Pakt und NATO gegenüber und starrten sich feindselig an wie zwei Leute, die am Abend zuvor während einer Büroparty im Fotokopierraum betrunken Sex gehabt hatten. Mehr als 150 000 Soldaten und 4000 Panzer waren hier insgesamt stationiert gewesen. Die große Panzerschlacht im Fulda-Tal war eins der Szenarien, für das hier ständig geprobt wurde. Auch Düsenflieger, die jenseits der Schallgrenze über die Dörfer bretterten, gehörten zum Alltag. Ich kann mich erinnern, ich muss etwa vier Jahre alt gewesen sein, dass ich mit meinem Teddybären Brummi (der aber nicht brummen konnte) vorm Kindergarten stand und wieder so ein Düsenjäger über mich hinwegflog. Weil ich wusste, dass da wenige Sekunden später ein Höllendonner losbrechen würde, hielt ich Brummi die Ohren zu und wartete auf das Krachen im Himmel. Immer wenn das Krachen kam, tat das nicht nur in den Ohren, sondern im ganzen Körper weh. Kein Wunder, dass ich, als ich Jahre später als Austauschschülerin in den USA »Top Gun« mit Tom Cruise sah, den Film völlig abstoßend fand. War ich doch, im Gegensatz zu meinen amerikanischen Schulfreunden, mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Krieg keine sonnenuntergangsgetränkte Heldenphantasie, sondern eine reale und permanente Bedrohung darstellte. Es war irgendeine meiner Cousinen während einer Familienfeier bei meinem Onkel, die mir kaugummikauend und erfasst von ihrer eigenen Wichtigkeit erklärte – es war wahrscheinlich Weihnachten 1983, kurz nach der Bestätigung des NATO-Doppelbeschlusses durch den deutschen Bundestag, bei der die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenwaffen besiegelt worden war –, dass, wenn es zu einem Krieg kommen würde, wir die Ersten wären, auf die die Atombombe fällt. Wir standen im Wohnzimmer meines Onkels, das nach seinem süßen Pfeifentabak roch. Ich war die Kleinste von allen Cousinen und Cousins und so dankbar, dass dieses Mädchen, das zum Schock aller Verwandten einen »Atomkraft? Nein danke« Button trug, überhaupt mit mir redete. Aber dass wir alle bald sterben würden, und zwar wir als Allererste, dass es so gar keine Hoffnung gab, das hat mich danach noch lange beschäftigt. Damals starb auch mein Cousin Reiner bei einem Motorradunfall. Ich hatte als Kind große Angst vor der Atombombe. Und dann bald auch vor dem Sauren Regen, Tschernobyl und dem Ende der Welt. Vor allem in Niederaula, dem heißesten Punkt des Kalten Krieges.
Heute befindet sich ein wenig außerhalb von Niederaula das erste deutsche Logistikzentrum des US-amerikanischen Onlinehändlers Amazon. Das FRA1. Es wurde 1999 eröffnet. 2000 kam Amazon-Gründer und zweite reichste Person der Welt Jeff Bezos zu Besuch und hinterließ einen Handabdruck. Das FRA1 steht am Eichhof, und diese Adresse steht auch oft als Absender auf Amazon-Paketen. Ich freue mich dann immer, denn eine der wenigen Dinge, die ich über meinen 1943 verstorbenen Großvater weiß, ist, dass er in der Schule neben dem Sohn vom Eichhof gesessen hat. Ich weiß auch nicht, wer mir das erzählt hat und warum. Ganz in der Nähe vom Eichhof betreibt Amazon ein weiteres Logistikzentrum, das FRA3, das auf Mode spezialisiert ist. Insgesamt sollen 3500 Menschen in diesen beiden Zentren arbeiten. Fast so viele Menschen wie früher Panzer im Fulda-Tal stationiert waren. Mit Amazon kamen Logistikunternehmen nach Niederaula. Und mit ihnen viele, viele LKW. Im Mai, damals nach dem Lockdown, bin ich kurzerhand von der Autobahn abgefahren und wollte mir wieder einmal alles ansehen. Einfach mal durchfahren und schauen, wie es sich anfühlt. Seit der Beerdigung meines anderen Cousins – er hieß Bernd, war fast zwei Meter groß und fuhr ein riesiges Moto-Guzzi-Motorrad, verstarb dann aber an einem Gehirntumor – war ich nicht mehr da gewesen. Fast 16 Jahre war das her. Das Dorf war kaum wiederzuerkennen. Gleich hinter der neuen Autobahnabfahrt, in deren Nähe sich ein riesiger Parkplatz mit einem Meer aus LKW befand, war ein großer Gewerbegebiet mit verschiedenen Logistikunternehmen gebaut worden. Und auf diesem Gelände stand in mehrfacher Ausführung diese seltsame architektonische Erfindung des digitalen Zeitalters, die da heißt: Erfüllungszentrum.
Ein Erfüllungszentrum haben Sie sicherlich schon einmal gesehen. Es sind diese riesigen, meist grauen, fensterlosen Kästen – anonyme Nicht-Gebäude, die meistens außerhalb von Städten oder mitten auf dem Land in der Gegend herumstehen. In den Erfüllungszentren werden Produkte gelagert, verpackt und verschickt. Sie sind mit einer Armee von LKW verbunden, die zur Erfüllung unabdingbar sind. Diese LKW stellen die Armeen der neuen, digitalen Weltordnung dar, welche 1989 mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges begann. Denn 1989, das war auch das Jahr, in dem der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee das World Wide Web erfand. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Gegend um Niederaula vom logistischen Brennpunkt des Kalten Krieges in ein Logistikzentrum des neuen Zeitalters verwandelt. Erst stand da diese ultimative Frustration, nämlich die deutsch-deutsche Grenze mit ihren Todesstreifen und Wachtürmen, und heute ist man hier für die Erfüllung zuständig. Hier hat also das stattgefunden, was uns die Konsumgesellschaft tagtäglich neu verspricht: die Überwindung aller Frustration und die Erfüllung aller Begehren.
Die Erfüllung braucht das Begehren. Ohne Begehren keine Erfüllung. Ohne Begehren kein Konsum, keine Online-Bestellungen, kein Amazon, keine Erfüllungszentren. Nur, was ist das eigentlich, Begehren? Wissen Sie, was Sie begehren? Das Paar Schuhe oder das Elektrogerät, die Sie sich gerade online bestellt haben, begehren Sie die wirklich? Werden diese Gegenstände die Frustration oder das Bedürfnis beseitigen, die Sie dazu bewegt haben, sie zu bestellen? Werden diese Gegenstände Sie erfüllen? Bedürfnis führt zu Begehren, führt im Idealfall zu Erfüllung – ist das Leben wirklich so einfach, die Abfolge unserer Gefühle so logisch? Noch komplizierter wird es beim Zwischenmenschlichen, das ja oft auch das Zwischenkörperliche betrifft. Also bei der Erotik. Wissen Sie, warum Sie eine ganz bestimmte Person begehren? Können Sie Ihr Begehren konkret in Worte fassen, ohne dabei auf Klischee-Sätze wie »Er bringt mich zum Lachen« oder »Sie ist so sexy« auszuweichen? Können Sie Ihr Begehren erklären? Oder ist es nicht vielmehr so, dass unser Begehren sich verflüchtigt, sobald man versucht, es zu benennen oder zu rationalisieren?
Was ist so schlimm am Rationalisieren, werden jetzt einige sagen. Begehren ist doch einfach eine biologische Tatsache. Ein Trick der Evolution, um uns dazu zu bringen, Sex miteinander zu haben. Wir begehren, damit wir uns fortpflanzen. Deswegen sind auch junge Menschen so viel begehrenswerter, denn die sind eben nun mal fruchtbarer. Und ebenmäßige, gesunde Gesichter versprechen angeblich ein gutes Erbgut, weswegen sie attraktivere Geschlechtspartner darstellen als Menschen mit asymmetrischen Gesichtern. Außerdem gibt es genügend Pop-Wissenschaftler, die einem erklären wollen, dass Männer auf junge Frauen mit großem Busen, enger Taille und weiten Hüften stehen, weil ihre Silhouette etwas über ihren Hormonspiegel und damit über ihre Fruchtbarkeit aussagt. So eine biologische Simplifizierung erklärt aber weder homoerotisches Begehren noch Begehren jenseits der Sexualität, oder warum wir vielleicht eher den schmächtigen Typen mit der dicken Brille dem Unterhosenmodel mit Waschbrettbauch vorziehen. Oder warum David Bowie mit seinen unterschiedlich farbigen Augen so unwiderstehlich war. Sie adressiert in keiner Weise all die seltsamen Entscheidungen, die wir im Namen des Begehrens treffen. Wer wen begehrt, findet so oft jenseits der Fruchtbarkeitsschallmauer statt, dass biologische Faktoren wahrscheinlich nur einen winzigen und zweifelsohne auch den uninteressanten Anteil menschlichen Begehrens beeinflussen. Von Justin Bieber als Sexsymbol ganz zu schweigen.
Begehren fällt in der griechischen Mythologie in das Aufgabengebiet des Gottes Eros, dem römischen Äquivalent von Amor oder Cupido. Eros, der Sohn von Aphrodite (die Göttin der Liebe und Schönheit) und dem Kriegsgott Ares (römisch Mars) ist ein verspielter, übermütiger kleiner Junge mit Flügeln, der durch die Welt flattert und goldene Pfeile verschießt. Wer von seinen Pfeilspitzen ins Herz getroffen wird, in dem entfacht sich Begehren. Eros ist demnach unberechenbar wie ein Kleinkind und dabei genauso anarchisch und unbeeindruckt von den Regeln der Erwachsenenwelt. Ein Gott, der harmlos und niedlich daherkommt und dabei doch das gedankenlose Zerstörungspotenzial eines Zweijährigen besitzt. Begehren, die erotische Liebe, laut der griechischen Mythologie ist sie unkalkulierbar, launenhaft und so entzückend wie auch potenziell ruinös. Vor allem aber lässt sie sich nicht erklären.
Was aber den altgriechischen Philosophen Platon nicht davon abgehalten hat, es trotzdem zu versuchen. In Platons »Gastmahl«, dem wohl wichtigsten philosophischen Text der westlichen Kultur zum Thema Begehren und erotische Liebe, beschreibt Platon die Unterhaltung verschiedener Teilnehmer eines Gastmahls, die über das Wirken des Gottes Eros nachdenken. Unter den Rednern befindet sich auch der Philosoph Sokrates, der betont, dass alles, was er über erotische Liebe weiß, von einer Frau namens Diotima stammt. Sokrates nimmt in seinem Vortrag Bezug auf die Gedanken des Gastgebers des Abends, eines jungen Mannes namens Agathon. Agathon sieht die Dinge eher unkompliziert, ja, fast könnte man sagen biologisch-simplizistisch, indem er argumentiert, dass sich Begehren auf Jugend und zarte Schönheit reduzieren ließe. Für Sokrates dagegen ist das Begehren mit dem Göttlichen verbunden. Für ihn ist die Auseinandersetzung mit dem Eros ein lebenslanger Prozess, der mit dem Ausleben der eigenen Sexualität beginnt. Wenn der Sex-Drive dann etwas nachgelassen hat, erkennt man, dass alle Körper schön sind und nicht nur die, die man zuvor begehrt hat. So erreicht man einen Zustand, in dem man vor allem den schönen Verstand und Wissen begehrt. Der höchste Zustand der Erotik ist dann erreicht, wenn man sich innerlich völlig von allen physischen Manifestationen der Schönheit trennt und das abstrakte Konzept der wahren Schönheit begehrt und so dem Göttlichen näherkommt. Das ist es, was wir heute als »platonische Liebe« bezeichnen. Begehren als Transzendenz.
Doch die platonische Liebe ist es wohl kaum, was in den Erfüllungszentren von Niederaula und anderswo bedient wird. Ganz am Anfang der digitalen Revolution, als wir noch dachten, dass das World Wide Web die Welt retten und zu einem höheren Bewusstsein führen könnte, spielte sie vielleicht noch eine Rolle. Die digitale Konsumgesellschaft mit all ihrem materiellen und emotionalen Exzess ist allerdings weit vom platonischen Idealzustand entfernt. Begehren – nach Menschen wie auch nach Dingen – ist das Fundament des digitalen wie auch analogen Konsums und der globalen Ökonomie. Begehren ist das, was jede Werbung, jedes Modefoto, jeder Kinofilm, jede TV-Serie, jede Smartphone-App zu generieren sucht. Medial werden wir, oft durch Prominente, in einen Zustand ständigen Begehrens versetzt, damit wir bloß nicht aufhören zu kaufen, uns auch noch die nächste Folge der Netflix-Serie anzuschauen oder weiter im sozialen Netzwerk zu scrollen. Von maximal vielen Menschen begehrt werden, also berühmt sein, wird immer noch als ein ultimatives Karriereziel gehandelt. Die Konsumgesellschaft suggeriert uns jeden Tag, wie einfach es ist, sein Begehren zu definieren, und dass es für jedes Begehren eine simple Lösung gibt. Mit anderen Worten, das Gegenteil von Transzendenz.
Doch egal, ob mit oder ohne Transzendenz, laut dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan handelt es sich beim Begehren um einen Grundzustand. Um den Kern der menschlichen Existenz. Von ihm stammt der Satz »Ich begehre, also bin ich«, abgeleitet vom Grundsatz des französischen Philosophen René Descartes »Ich denke, also bin ich«. Laut Lacan definiert sich der Mensch durch sein Begehren, das – und genau darin liegen der Zauber wie auch die Tragik der menschlichen Existenz – genauso wenig benennbar ist wie der Sinn des Lebens selbst. Es geht nicht um das Erreichen eines Ziels oder um das Objekt unserer Begierde, sondern um den Akt des Begehrens selbst. Solange ich begehre, weiß ich, dass ich am Leben bin und am großen, ultimativ rätselhaften Experiment der menschlichen Existenz teilhabe. Pornographie und romantische Phantasien in all ihren kulturellen Derivaten liefern, so der britische Psychoanalytiker Adam Phillips, Bilder davon, wie die Erfüllung unserer Begehren aussehen könnte. Genau wie andere Konsumprodukte schützen sie uns davor, in die verwirrenden Tiefen unseres wirklichen Begehrens abzustürzen und uns mit dem Enigma auseinanderzusetzen, was uns eigentlich antreibt. Der Leinwandkuss im Schnulzenfilm liefert uns ebenso ein einfaches Ziel für unser diffuses Begehren wie die Designerhandtasche oder das schicke neue Auto. Oder für manche ist es eben die weiße Traumhochzeit mit den Flitterwochen auf den Malediven. Wie der Esel hinter der Karotte laufen wir diesen Zielen nach, damit wir uns nicht mit dem eigentlichen Grund für dieses seltsame Ziehen in unserer Brust beschäftigen müssen. Den Ursprung für diese Sehnsucht, deren Namen wir nicht kennen, können wir so ignorieren. Nur eins lässt sich mit relativer Eindeutigkeit feststellen: Begehren ist das, was Sex interessant macht beziehungsweise wodurch Sex interessant bleibt.
Die große Ratlosigkeit, was unser Begehren betrifft, scheint angesichts der Rolle, die Begehren in unserem Wirtschaftssystem spielt, fast schon fahrlässig. Und so ist es keine Überraschung, dass einer der Architekten des digitalen Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Peter Thiel ist einer der zentralen Oligarchen der globalen Digitalwirtschaft. 1999 war er Mitbegründer des digitalen Bezahlsystems PayPal und verkaufte seinen Anteil 2002 für $ 1,5 Milliarden. 2004 war Thiel der erste externe Investor, der in Marc Zuckerbergs damals noch winziges Start-up Facebook investierte und einen Firmenanteil von 10,2% erwarb. 2004 gründete Thiel außerdem das Software-Unternehmen Palantir Technologies, das sich auf die Verarbeitung und Auswertung großer Datenmengen (Big Data) spezialisierte und dabei anfangs hauptsächlich für die Nachrichtendienste der USA (FBI, CIA, NSA etc.) arbeitete, seinen Kundenstamm aber auf Pharmakonzerne und den Finanzsektor erweiterte. Palantir liefert die Algorithmen, um genau das zu entschlüsseln, was das digitale Universum bisher so undurchdringlich gemacht hat: die Unermesslichkeit seiner Datenmengen. Im Chaos wird dadurch die Ordnung gefunden. Wem diese Ordnung zugänglich ist und wem nicht, entscheidet über Macht und Ohnmacht. Peter Thiel gilt so als einer der erfolgreichsten Technologie-Investoren der Welt. Wie wir die digitale Realität heute erleben, ist zum großen Teil sein Werk. Dass er sich 2016 beim Parteitag der Republikaner öffentlich für die Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps aussprach, sei hier zu beachten. Denn wenn wir über die Natur und Funktion von Begehren nachdenken, dürfen wir nicht vergessen, dass Begehren immer auch missbraucht werden kann. Dass es bei der Aneignung von Macht so viel effektiver ist, wenn Menschen ihren Unterdrücker freiwillig begehren, als dass man sie mit Gewalt unterwirft.
Peter Thiel studierte an der Stanford University bei dem französischen Philosophen und Literaturkritiker René Girard. Thiel hat an mehreren Stellen betont, dass Girard, zu dessen Hauptwerk das Buch »Figuren des Begehrens« gehört, ihm die Inspiration gab, seine Karriere als Jurist an den Nagel zu hängen und in digitale Technologien, darunter eben auch Facebook, zu investieren. In »Figuren des Begehrens« stellt Girard anhand einer literarischen Analyse von fünf Autoren – Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust und Dostojewski – die Theorie auf, dass Begehren immer mittelbar ist. Also, dass es zwischen einem Menschen und seinem Objekt der Begierde immer noch eine dritte Person oder einen dritten Faktor gibt, die in uns überhaupt erst das Begehren schüren. Simpel gesagt, wir begehren etwas oder jemanden, weil andere es auch tun. Laut Girard ist Begehren etwas, das wir nachahmen, uns von anderen Menschen abschauen. »Menschen sind Kreaturen, die nicht wissen, was sie begehren sollen und die sich an andere wenden, um sich zu entscheiden, ob etwas oder jemand tatsächlich begehrenswert ist. Wir begehren, was andere begehren, denn wir imitieren ihr Begehren«, so Girard. So hat Begehren, laut Girard, immer eine Dreiecksstruktur. Die Tatsache, dass eine weitere Person das Objekt der Begierde begehrt, macht dieses Objekt erst begehrenswert. Laut Girard will sich der Romantiker immer davon überzeugen, »dass seine Begehren einem natürlichen Gesetz folgen oder – was so ziemlich das Gleiche ist – (…) aus dem Nichts von einem quasi-göttlichen Ego geschaffen wurden«. Für Girard ist das die große Illusion des modernen Zeitalters: die Lüge vom spontanen Begehren. Der Idee des geflügelten Eros, der willkürlich seine Pfeile in unsere Herzen schießt, wird durch Girard ein Ende bereitet.
Laut Girards Nachahmungstheorie ist Begehren also ein kulturell-soziales Konstrukt. Ein Beiwerk des menschlichen Miteinanders. Ich begehre, weil du begehrst. Soziale Netzwerke sind genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Marc Zuckerberg hatte die Idee für Facebook, nachdem seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hatte und er in seiner Wut eine Website baute, auf der männliche Studenten seiner Universität Fotos von Studentinnen nach ihrer Attraktivität bewerten konnten. Mit Facebook erweiterte er das Konzept, aber die Idee der Bewertung und damit der Schaffung von Begehrlichkeiten ist immer noch die gleiche. Instagram und andere soziale Netzwerke funktionieren ähnlich. Ebenso Amazon mit seinen »You may also like«-Vorschlägen und Produktempfehlungen, die uns zeigen, was andere Benutzer gekauft haben. Wir geben Bewertungen ab oder klicken den »Like Button« bei einem Eintrag in einem sozialen Netzwerk und machen uns so zur dritten Person in der Dynamik zwischen einer weiteren Person und deren Beziehung zu demselben Eintrag. Wir werden Teil des von Girard beschriebenen Begehrensdreiecks. So kann ein Foto oder Video eine solche Eigendynamik des Begehrens aufbauen, dass es »viral« geht. René Girard wird denn auch als »Pate des Like-Buttons« bezeichnet. Denn durch Girard verstand Thiel sofort, welche Macht einer Algorithmus-Maschine wie Facebook innewohnte. Einer Algorithmus-Maschine, die Begehren generieren kann. Wenn wir Begehren als Essenz der menschlichen Existenz begreifen, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass einem Menschen, der eine solche Maschine besitzt, die Welt gehört.
In Niederaula fuhr ich auch an dem Hof vorbei, auf dem meine Mutter aufgewachsen ist. Ich hielt an und schaute auf die gepflasterte Einfahrt, die zum Hof hinaufführt. Um diesen Ort winden sich so viele Geschichten und Erinnerungen, so viel Streit und so viel Leid. Eine dieser Geschichten scheint Girards Nachahmungstheorie zu bestätigen. Mein Ururgroßvater Philipp war reich gewesen. Eine Heldentat im preußisch-französischen Krieg 1870/71 hatte ihm einen dicken Orden und eine noch dickere Kriegsrente eingebracht. Bei großen Familienfesten musste sogar irgendein weitläufiges Mitglied der kaiserlichen Familie vorbeischauen. In dieser tiefen Provinz zweifellos das ultimative Statussymbol. Sein Sohn Jakob, sein einziges Kind, war mit der narzisstischen Überzeugung aufgewachsen, dass ihm die Welt gehört und er alles haben kann – einschließlich jeder Frau. Er war schon Anfang 30 und immer noch ledig, als er meine Urgroßmutter Elisabeth sah. Sie kam aus einem Nachbardorf und war mit einem armen Schreiner verlobt. Amor schlug zu. Die und keine andere wollte Jakob haben. Elisabeth wollte ihn nicht heiraten, sie liebte ja den Schreiner, der immer noch daran arbeitete, genügend Geld für die Heirat zusammenzusparen. Also marschierte Jakob zu Elisabeths Eltern und machte denen klar, dass er ihre Tochter freien wollte. Die Eltern waren von der guten Partie so begeistert, dass sie Elisabeth drohten, ihr die Mitgift zu entziehen, falls sie darauf bestand, den Schreiner zu heiraten. Elisabeth gab dem Druck nach. Sie heiratete Jakob. Mit ihm hatte sie fünf Kinder. Zwei davon starben kurz nach der Geburt, zwei weitere im Krieg, darunter auch mein Großvater. Jakob war ihr kein guter Ehemann. Seine Untreue war notorisch und allgemein bekannt. Der Hof meiner Familie liegt auf einem Hang. Hinter dem Hof befindet sich eine Wiese, die noch weiter den Hang hinaufführt. Ganz oben am Hang steht ein Apfelbaum. Von dort aus kann man das Dorf sehen, wo der Schreiner lebte. Elisabeth stand oft unter dem Apfelbaum, sehnsuchtsvoll blickte sie von dort zum Dorf des Schreiners und weinte. Was nützt alles Geld der Welt, seufzte sie, wenn du keine Liebe im Leben hast?
Hätte Jakob Elisabeth auch begehrt, wenn sie nicht mit dem Schreiner verlobt gewesen wäre? Er, der sonst freie Wahl hatte, warum musste er sich unbedingt eine Frau aussuchen, die schon vergeben war? Fand er sie nur deswegen begehrenswert, weil sie schon von einem anderen begehrt wurde? Dass es ein Apfelbaum war, unter dem Elisabeth nach ihrer großen Liebe weinte und ihr Leben infrage stellte, hätte natürlich symbolischer nicht sein können. Ist es doch der Apfelbaum, der in der europäischen Malerei als der Baum der Erkenntnis dargestellt wird. Im Alten Testament leben Adam und Eva sorglos und nackt im Garten Eden, kennen keine Scham, keine Angst, keine Erotik und kein Begehren. Es gibt nur eine Regel im Paradies: Sie dürfen nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Aber eine Schlange überredet Eva, doch einen Apfel zu essen, denn er würde sie klug machen. Eva kann nicht widerstehen. Pflückt sich einen Apfel und überredet auch Adam, davon zu essen. Damit ist die erste Sünde begangen. Gott ist zornig, verbannt sie aus dem Paradies und verdonnert sie zu den Qualen der menschlichen Existenz. Scham, Angst, Schmerz – die heilige Dreieinigkeit des menschlichen Miteinanders, Adam und Eva lernen sie nun kennen. Die Geschichte vom ersten Sündenfall ist damit eine Geschichte von Begehren. Wieder ist da ein Dritter im Bunde zwischen Mensch und Objekt der Begierde, nämlich die Schlange. Doch das wirklich Interessante ist, dass es Wissen ist, was Eva begehrt. Dass der erste Akt des Begehrens nicht einer der Liebe oder der Sexualität ist, sondern der Erkenntnis.
Eine weitere zentrale Figur der westlichen Kultur, für die Wissen und Begehren auf fatale Weise identisch sind, ist Goethes Faust. Der Gelehrte Dr. Faust ist überwältigt von dem Begehren zu erfahren, »was die Welt zusammenhält«, und bereit, dafür seine Seele an den Teufel zu verkaufen. Stört sich nicht daran, dass Höllenqualen auf ihn warten, solange nur sein Begehren gestillt ist. Die Welt und damit auch sich selbst zu verstehen ist das Objekt der faustischen sowie der alttestamentarischen Begierde. Denn wenn man die Welt versteht, erkennt man auch, was die eigene Rolle in dieser Welt ist, erfährt sich neu als Mensch. Fausts Unersättlichkeit ist wie die des Kindes – die, wie Sigmund Freud in »Über die weibliche Sexualität« (1931) betonte, »maßlos« ist: »(Sie) verlangt Ausschließlichkeit, gibt sich nicht mit Anteilen zufrieden.« Das erste Objekt der Begierde eines Kindes ist die Mutter bzw. die Mutterfiguren (die jedes Geschlecht haben können). Doch während Freud annahm, dass diese erste Begehrensphase auf dem oralen Trieb beruht und das erste Begehren des Kindes darin besteht, seinen Hunger zu stillen – dass die Mutterfigur eben nur dazu da ist, ein physisches Bedürfnis des Kindes zu erfüllen – sieht die feministische Psychoanalytikerin Jessica Benjamin das anders. Laut Benjamin ist diese allererste Beziehung, die wir als Menschen erleben, geprägt von dem Begehren, erkannt zu werden. Die ersten schönen Momente zwischen Mutter und Kind sind die des gegenseitigen Erkennens. Dies geht allerdings nur, wenn die Mutter mehr ist als nur ein Fortsatz des Kindes, sondern eine eigenständige Person. »Eine echte Mutter ist nicht einfach nur ein Objekt der Forderungen ihres Kindes; vielmehr ist sie eine eigene Person, deren unabhängiges Zentrum sich außerhalb ihres Kindes befinden muss, wenn sie ihr Kind so erkennen und wahrnehmen will, wie es das Kind begehrt«, so Benjamin. Mit anderen Worten, wir können einander nicht erkennen, wenn wir völlig miteinander verschmelzen. Begehren braucht das Andere, beziehungsweise jemanden, der nicht man selbst ist. Das gilt für Mutter und Kind ebenso wie für Beziehungen zwischen Erwachsenen. Die Verbindung aus ultimativer Nähe und gleichzeitiger Andersartigkeit, die in der Mutter-Kind-Beziehung zum ersten Mal erfahren werden kann, ist eben auch die Grundlage für die intensive Erfahrung der Erotik unter Erwachsenen. Benjamin drückt das so aus: »In einer erotischen Verbindung können wir genau diese Form von gegenseitigem Erkennen erfahren, bei dem sich beide Partner ineinander verlieren, ohne dabei den Verlust ihres Selbst zu erleiden.« Was genau Begehren und damit auch Erotik bedeuten, lernen wir als Babys. Und dazu gehört eben auch das Erkennen der Grenzen des anderen.
Unser Begehren nach Wissen zu erfüllen, ist das Versprechen eines der größten Apfelbäume der Neuzeit: Apple. Der angebissene Apfel als Logo des amerikanischen Technologie-Giganten ist gleichbedeutend mit der Hyperbeschleunigung der digitalen Revolution. Mit dem Erscheinen des ersten iPhone 2007 revolutionierte sich die Art, wie wir unsere Realität erfahren und mit ihr umgehen. Ja, auch wie wir Begehren, Sexualität und Liebe erleben. Ob sich der Apfel als Logo auf den alttestamentarischen Apfel vom Baum der Erkenntnis bezieht oder ob damit der Apfel gemeint ist, der dem Physiker Isaac Newton im 17. Jahrhundert angeblich auf den Kopf fiel und ihn so das Prinzip der Schwerkraft erfassen ließ, wurde niemals offiziell von Apple bestätigt. Eine weitere Theorie ist die, dass es sich bei dem angebissenen Apfel um eine Hommage an den britischen Mathematiker Alan Turing handelt, der als einer der einflussreichsten Informatiker der frühen Computerentwicklung gilt und während des Zweiten Weltkriegs maßgeblich dazu beitrug, die Verschlüsselungscodes der deutschen Wehrmacht zu knacken. Trotz seiner Leistung während des Krieges wurde Turing wegen seiner Homosexualität verfolgt und vom britischen Staat mit Östrogenbehandlungen zwangskastriert. Seine Leistungen für den Erhalt der englischen Krone waren dem Staat in diesem Moment egal. Er hatte für die Freiheit gekämpft und dabei maßgeblich zum Sieg über den Faschismus beigetragen, aber die Freiheit seines Begehrens wurde ihm nicht gewährt. 1954 beging Turing mutmaßlich Selbstmord mit Cyanid. Neben seinem Leichnam wurde ein angebissener Apfel gefunden, möglicherweise eine Referenz auf den Märchenfilm »Schneewittchen und die sieben Zwerge«, aus dem Turing immer wieder den Satz »Apfel färbt sich strahlend rot, lockt Schneewittchen in den Tod« zitierte.
Das iPhone vermittelt uns die Illusion, dass die Welt mit all ihrem Chaos, Leid und ihrer Frustration mit einem Klick oder Wisch nicht nur erfahrbar, sondern auch kontrollierbar ist. Nie mehr müssen wir uns verirren, nie mehr überfordert, nie mehr ignorant sein. Sogar die Erfüllungszentren in Niederaula können mit einem iPhone in Aktion versetzt werden. Das iPhone liefert uns das Wissen der Welt in unsere Handfläche. Damit wird das iPhone zum vermeintlichen Zepter, das uns das Gefühl unserer Allmacht zurückschenkt, dass wir irgendwann in unserer Kindheit verloren hatten. Das iPhone und all die anderen Smartphones, die nach ihm kamen, erheben uns zu Quasi-Imperatoren unserer Realität. Wir stehen gebeugt über die kaltblau leuchtenden Bildschirme in unseren Händen und können uns sagen »Le monde, c’est moi« – denn wir mögen zwar keine Sonnenkönige wie Ludwig XIV. sein, aber mit einem Smartphone können wir uns die Welt zum vermeintlichen Untertan machen, für jedes Problem eine Sofortlösung finden. Frustration gibt es nicht mehr. Jedes Begehren wird erfüllt. Dating Apps wie Tinder und Grindr haben Sexualität zu einer schnelllebigen Verbrauchsware gemacht. Wir wischen uns durch die Gesichter der, wenn nicht Sex- dann zumindest vermeintlich Intimitätswilligen so, wie wir unseren Einkaufswagen durch die Gänge eines Supermarkts schieben. Seitdem 2010 das radikal erweiterte iPhone 4 auf den Markt kam, sind uns die sozialen Netzwerke – inklusive Facebook – mobil zugänglich. Unsere Mobiltelefone sind zu Maschinen des Begehrens geworden, die wir ständig und immer bei uns tragen. Es sind Erweiterungen unseres Selbst, wie ein magisches Körperteil, das uns ins Zentrum des Universums katapultiert. Der Körperteil, dem bisher genau diese Magie zugesprochen worden war – der Phallus –, versagt dagegen kläglich.
Doch genau in der scheinbaren Allwissenheit, die einem das iPhone ermöglicht, liegt die Krux des Ganzen. Diese mobilen Begehrensmaschinen lassen die Welt zu einer Erweiterung unseres Selbst werden. Um zu begehren, brauchen wir – nach Jessica Benjamin – das Andere. Denn nur das Andere kann uns erkennen, kann uns wahrnehmen. Ohne das Andere fühlen wir uns leer, verlassen, ungeliebt. Das schale Gefühl, das unweigerlich nach dem kurzen High einsetzt, wenn ein Foto, Video oder Zitat von uns auf einem der sozialen Netzwerke viele Likes erhalten hat – es ist nichts anderes als die Einsamkeit des Narzissten. Eine Spiegelung unseres Selbst, in der unsere Mitmenschen in ihrer Andersartigkeit nicht wirklich vorkommen. Vielleicht ist das mit ein Grund für all die Wut und Tobsucht, die in den letzten zehn Jahren, seit die digitale Realität die eigentliche Realität weitgehend an Bedeutung überholt hat, so maßgeblich den öffentlichen Diskurs und in weiten Teilen auch die Politik bestimmt hat. Wir fühlen uns verlassen, weil wir nichts mehr haben, was wir wirklich begehren könnten. Begehren braucht genau das, was Amazon und der Rest der digitalen Erfüllungsökonomie beseitigen will, die Frustration. Die ultimative Frustration ist der Tod. In der ewigen Konsumgegenwart der Onlinewelten gibt es aber keinen Tod. Alles existiert gleichzeitig, nichts wird vergessen. Eros und Thanatos, das Begehren und der Tod, dieses sich im ewigen Spannungsverhältnis befindliche Duo wie Sigmund Freud es in »Jenseits des Lustprinzips« beschrieb, es existiert hier nicht. Durch die Perfektionierung der Begehrensmaschinerie wird das Begehren selbst lahmgelegt. Die Heilung ist die eigentliche Krankheit.
Die sozialen Netzwerke haben die Dynamiken unseres Begehrens entschlüsselt. Sie haben unser Begehren in Algorithmen übersetzt und vermögen, es für ihre kommerziellen Interessen nutzbar zu machen. Die eigentlichen Begehrensmaschinen sind damit wir. Wir beliefern die Algorithmen mit Daten. Wir sind die Erfüllungszentren für eine Maschinerie, die sich um uns herum aufgebaut hat. Doch auch wenn sich manchmal unser Dasein als Homo Digitalis mit dem von Keanu Reeves in »The Matrix« vergleichen lässt, der als Biomasse in einem Pod von Maschinen ausgesaugt wird, sind wir doch mehr als die Summe der von uns generierten Algorithmen. Die OnlineKonsumwirtschaft mag unsere Reflexe und Begehrensdynamiken für sich zu nutzen wissen. Das heißt jedoch nicht, dass wir einen antifaschistischen Schutzwall um uns errichten müssen, um uns dem zu entziehen. Der Schutz liegt einfach darin, zu akzeptieren, dass es manchmal eben keine Lösung, keine Erklärung, kein Ziel, keine Schuld für unsere Sehnsucht gibt. Dass der eigentliche Zauber eines jeden Menschen dadurch entsteht, dass der Ursprung unseres Begehrens unergründlich ist.
Ich kann nicht behaupten, dass ich über all das nachgedacht habe, als ich nach längerer Fahrt in Berlin ankam, meinen Mietwagen zum Autoverleih brachte und mich auf einen längeren Fußmarsch zu meiner Wohnung machte. Der Mietwagen war schon sehr bequem gewesen, und so eine Sitzheizung ist eine ganz außergewöhnliche Erfindung. Und überhaupt war es doch morbide, dass ich immer noch mit demselben Auto herumfuhr, in dem ich mit meinem Mann zu dem Restaurant gefahren war, in dem er kurz nach unserer Ankunft verstarb. Wie sollte ich denn je über diesen Abend hinwegkommen, wenn mich mein Auto ständig daran erinnerte? Während ich das alles begrübelte und mich fragte, wie sich wohl ein Leben ohne meinen Mercedes anfühlen würde, ob die Erinnerungen dann immer noch genauso stark wären, war ich zu Hause angekommen. Gerade wollte ich die Tür aufschließen, da fuhr ein alter Mercedes an mir vorbei. Es war genau das gleiche Modell wie meiner. Ich sah ihm hinterher. Cooles Auto, dachte ich. Und dann wünschte ich mir, ich hätte meinen Mercedes mit nach Berlin gebracht.
Leidenschaft oder Der Mann muss ins Haus, und wenn das Klavier raus muss
For each ecstatic instant We must an anguish pay In keen and quivering ratio To the ecstasy
Emily Dickinson
Auf meiner Fahrt von München nach Berlin nach dem ersten Lockdown machte ich ein paar Tage bei meinen Eltern halt. Wie immer übernachtete ich dort in meinem alten Kinderzimmer. Schlief dabei auf derselben Matratze, die schon alt gewesen war, als mir im Alter von vier Jahren dieses Bett ins Zimmer gestellt wurde. Und während ich in die Matratzenkuhle einsank, die vergilbte Blümchentapete anstarrte und nicht schlafen konnte, bemerkte ich eine kleine Blechkiste im Regal. Ich schaute kurz rein: peinliche Fotos aus meiner Teenagerzeit. Musste ich unbedingt sicherstellen. Also packte ich die Fotos zu dem großen Stapel an Dingen, die ich mit nach Berlin nehmen würde. Am nächsten Tag fuhr ich früh los und überquerte zum ersten Mal wieder seit den 90ern mit dem Auto die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Normalerweise fahre ich ja Zug. Ich war fast ganz allein auf der Autobahn. Beim Schild für den ehemaligen Grenzübergang Herleshausen fragte ich mich, ob das überhaupt möglich ist, jemandem, der in den 90ern geboren ist, zu erklären, wie sich das damals angefühlt hat. Die Brutalität des Todesstreifens. Wie final und unüberwindbar der gewirkt hat. Was das mit unseren Familien gemacht hat. Und dass so viele Westdeutsche, darunter viele meiner Verwandten, Flüchtlinge waren. Dass Westdeutschland eben zum großen Teil ein Land der Geflüchteten war. Und zwar alles nur aufgrund von unterschiedlichen philosophischen Auffassungen davon, wem was gehört. In einem Zeitalter, in dem alle politischen Philosophien in Auflösung begriffen sind, ist das schwer vorstellbar. Ich war jedenfalls froh, als ich in Berlin ankam. Die Fahrt war anstrengend gewesen. In meiner Berliner Küche öffnete ich dann die Blechkiste aus meinem Kinderzimmer und schaute mir endlich genauer die darin befindlichen Fotos an. Nur so viel zu den Fotos: Meine 80er-Jahre-Haare waren teilweise grauenhaft, und einige von den Blödmännern, mit denen ich auf dem Gymnasium war, will ich wirklich nie wiedersehen. Soweit also keine Überraschungen. Doch unter den Fotos befand sich auch eine Postkarte, die ich zwar beschrieben, aber nie abgeschickt hatte. Die Tinte war so verblichen, dass sowohl die Nachricht als auch die Adresse nicht mehr lesbar waren. Offensichtlich hatte mir damals das Motiv der Postkarte so gut gefallen, dass ich sie nicht verschicken wollte. Und es war dieses Motiv, das mir 35 Jahre später an meinem Küchentisch den Atem raubte. Es handelte sich um das deutsche Cover des Romans »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« des kolumbianischen Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez aus dem Jahr 1985. Die Postkarte war ein Werbegeschenk des Buchladens gewesen, in dem ich als Schülerin herumstöberte, wenn ich auf meinen nur alle drei Stunden fahrenden Bus warten musste. An das Buch hatte ich in den Zeiten von Corona oft denken müssen. Das Liebesleben vieler meiner Freunde war durch Corona entweder explodiert oder implodiert. Amtlich verordnete Nähe war offensichtlich für viele genauso anstrengend wie die Isolation, die mir auferlegt worden war. Aber das war nur ein nebensächlicher Zufall. Was an der Postkarte so außerordentlich war, war die Tatsache, dass das Motiv fast identisch mit dem Gemälde war, das in meiner Münchner Wohnung über meinem Fernseher hängt. Ein Bild von einem Urwald mit einem Gewässer und einem roten Papagei. Es gab nur zwei Unterschiede: Auf der Postkarte befand sich anstatt der zwei Kraniche, die vorne links auf meinem Gemälde zu sehen sind, ein kleiner Eros mit Pfeil und Bogen. Außerdem fährt auf dem Gewässer des Postkartenmotivs ein Flussdampfer entlang. Das Bild über meinem Fernseher hing schon dort, als ich 2006 zum ersten Mal die Wohnung meines mittlerweile verstorbenen Mannes Bernd betrat. Ich hatte dieses Bild sofort geliebt. Es ist keine echte Kunst, sondern ein dekoratives Bild, unsigniert. Etwas, das man normalerweise auf Flohmärkten oder Trödelläden findet. Früher hatte es in der Lobby eines alten Art-Déco-Hotels in Hollywood gehangen. Später landete es dann in einer Modeboutique auf der Melrose Avenue, wo es Bernd in den 90er Jahren aufgefallen war. Er kaufte es der Boutiquenbesitzerin ab und ließ es nach München bringen. Seitdem hatte es an der Wand über dem Fernseher gehangen. Das Bild hat etwas Romantisch-Betörendes und strahlt dabei eine unaufdringliche, ja naive Freundlichkeit aus, die Bernds düsterer Junggesellenbude sehr guttat. Auch wenn ich nach Bernds Tod viel an der Wohnung verändert habe, war immer klar: Das Urwaldbild bleibt. Wie ich nun herausfand, beruht das Bild auf einem relativ obskuren Stich des britischen Malers Philip Reinagle (1749–1833) mit dem Titel »Cupid Inspiring Plants with Love«. Darunter steht geschrieben »And thou devine Linnaeus!«