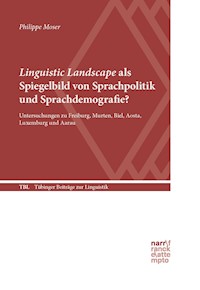
Linguistic Landscape als Spiegelbild von Sprachpolitik und Sprachdemografie? E-Book
Philippe Moser
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Wie äußert sich die Mehrsprachigkeit einer Stadt in ihrem Straßenbild? Lassen sich Rolle und Status der präsenten Sprachen erahnen? Zeigt sich ein Einfluss der lokalen Bevölkerungsstruktur und Sprachpolitik? Mit solchen Fragen befasst sich die vergleichende Untersuchung zur geschriebenen Sprache im öffentlichen Raum (der sogenannten "Linguistic Landscape") der Schweizer Ortschaften Freiburg, Murten und Biel sowie der Städte Aosta und Luxemburg. Anhand von quantitativen und qualitativen Analysen der insgesamt mehr als 5500 erhobenen Einheiten liefert sie einen empirisch fundierten Beitrag zur Soziolinguistik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Moser
Linguistic Landscape als Spiegelbild von Sprachpolitik und Sprachdemografie?
Untersuchungen zu Freiburg, Murten, Biel, Aosta, Luxemburg und Aarau
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8363-5 (Print)
ISBN 978-3-8233-0195-0 (ePub)
Inhalt
A Einführung
A.0Aufbau
Die hier vorgestellten Untersuchungen befassen sich mit der geschriebenen Sprache im öffentlichen Raum von fünf Städten, die als auf unterschiedliche Art und Weise mehrsprachig gelten, sowie von einer als einsprachig geltenden Stadt. Die Arbeit soll gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit den angewendeten Methoden aus dem Forschungsbereich der sogenannten Linguistic Landscape darstellen.
In der Einleitung führen wir die der Untersuchung zu Grunde liegenden Fragen ein. Zunächst wird allerdings der Forschungsgegenstand umrissen: die geschriebene Sprache in den Städten Fribourg/Freiburg, Murten/Morat, Biel/Bienne, Aosta/Aoste, Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg1 und Aarau.
Auf diese beiden Aspekte – geschriebene Sprache und mehrsprachige Städte – gehen wir anschliessend ausführlicher ein. In einem Überblick über die sprachgeschichtlichen Entwicklungen und die aktuelle Situation der Sprachpolitik und Sprachdemografie wird die Mehrsprachigkeit in der Schweiz im Allgemeinen betrachtet, bevor wir uns Kanton und Stadt Freiburg sowie Murten und Biel widmen, um schliesslich das Aostatal und die Stadt Aosta sowie Grossherzogtum und Stadt Luxemburg zu beleuchten, gefolgt von knappen Informationen zur einsprachigen Vergleichsstadt Aarau.
Im dritten Kapitel der Einführung umreissen wir zuerst die Entwicklungen der Forschung zur geschriebenen Sprache im öffentlichen Raum, die als Linguistic-Landscape-Forschung bekannt wurde. Es folgt eine Betrachtung der Probleme dieses Forschungsbereichs, in der wir verschiedene Ansätze zeigen und unseren eigenen entsprechend einordnen. Schliesslich stellen wir die Methode der Untersuchungen unseres Projekts vor, in Bezug auf Erhebung, Verarbeitung und Auswertung der Daten.
Die Resultate der Untersuchungen werden im zweiten Teil vorgestellt und getrennt nach den sechs betrachteten Städten gezeigt. Die Präsentation ist für die sechs Städte in einer identischen Struktur aufgebaut, für die Vergleichsstadt Aarau allerdings weniger umfassend: Die eingangs zusammengefassten Resultate werden jeweils im Anschluss vertieft. Dabei schliessen sich die Untersuchungen der Anteile ein- und mehrsprachiger Einheiten sowie der Situation der jeweils am wenigsten vertretenen berücksichtigten Sprache direkt an, während Untersuchungen zur Präsenz der jeweils berücksichtigten Sprachen und zu den Unterschieden zwischen einem vereinfachend als ‹Altstadt› bezeichneten Territorium und dem gesamten Stadtgebiet in Anhang I im Sinne eines Nachschlageteils vollständig wiedergegeben werden. Es folgt eine Betrachtung von Fragen der Grafik2 und der Übersetzung, bevor die Resultate abschliessend in den Kontext der aktuellen Sprachsituation gestellt werden3. Für Biel, Aosta und Luxemburg werden zuvor zusätzliche Ergebnisse zu spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Orte eingefügt.
Als Schluss werden einige grundlegende Resultate zu den untersuchten Städten verglichen und zur Beantwortung der einführenden Fragen herangezogen.
A.1Einleitung
A.1.1Geschriebene Sprache im öffentlichen Raum
Gegenstand der vorgestellten Untersuchungen ist also zunächst die geschriebene Sprache im öffentlichen Raum, in erster Linie in Form zumindest teilweise standardisierter Sprachen, meist mit offiziellem Status in den jeweiligen Kontexten (konkret Deutsch, Französisch, Italienisch und Luxemburgisch). Wir beziehen uns auf die beiden Bedeutungen von ‹Schrift› zum einen als System zur grafischen und lesbaren Wiedergabe von Elementen einer bestimmten Sprache (hier durch Buchstaben) und zum anderen als konkrete Anwendung dieses Systems, die sich als grafisches Element auf einem materiellen Träger betrachten lässt. Entsprechend untersuchen wir die An- oder Abwesenheit der bestimmten Sprachen ebenso wie – in einem kleineren Teil der Untersuchungen – die vermittelten Inhalte und die Phänomene der konkreten, grafischen Anwendung der Schrift im zweiten Sinn. Berücksichtigt werden im Grundsatz sämtliche Elemente lesbarer Schrift im öffentlichen Raum, den wir in A.3.3.1 ausführlich definieren.
A.1.2 Die Städte Freiburg, Murten, Biel, Aosta, Luxemburg und Aarau
Die Untersuchungen beziehen sich auf den öffentlichen Raum (vgl. A.3.3.1) der Städte Freiburg, Murten, Biel, Aosta, Luxemburg und Aarau. Es handelt sich dabei um fünf auf unterschiedliche Art und Weise mehrsprachige Städte, die untereinander und mit der einsprachigen Stadt Aarau1 verglichen werden sollen.
Es wurden dazu bewusst fünf mehrsprachige Städte ausgewählt, deren sprachliche und allgemeine Situationen sich zuweilen äusserst deutlich unterscheiden, in einigen Punkten bis zur Gegensätzlichkeit. Die im Folgenden kurz umrissenen Punkte werden für den Vergleich der Resultate aus den fünf mehrsprachigen Städten in C.1 herangezogen.
In Bezug auf die Orte der Untersuchung liegt der Schwerpunkt mit Freiburg, Murten und Biel sowie Aarau auf der Schweiz. Dazu wurden zusätzlich zwei Städte ausgewählt, die ausserhalb der Schweiz und somit in Regionen liegen, die von anderen sprachpolitischen Situationen geprägt sind: Aosta in der Autonomen Region Aostatal in Italien und Luxemburg im gleichnamigen Grossherzogtum.
Auch zwischen den drei Schweizer Städten liegen Unterschiede und Gegensätze vor: Biel liegt im Kanton Bern, während Murten und Freiburg im Kanton Freiburg liegen; Biel anerkennt die Zweisprachigkeit auf Gemeindeebene, Freiburg und Murten nicht; Letztere liegen zwar im gleichen Kanton, nicht aber im gleichen Bezirk, wobei der Bezirk nur im Fall von Murten offiziell zweisprachig ist; In allen drei Städten stehen Deutsch und Französisch in Kontakt, in Biel und Murten überwiegt die deutschsprachige Bevölkerung (in Murten weitaus deutlicher als in Biel), in Freiburg die französischsprachige.
Luxemburg unterscheidet sich von den übrigen zweisprachigen Städten durch seine Dreisprachigkeit (wir beziehen uns auf die offiziellen Sprachen).
Für die Schweizer Städte kann von Mehrheits- und Minderheitensprachen gesprochen werden, während im Fall von Aosta die eine der beiden offiziellen Sprachen kaum über eine Sprachgemeinschaft verfügt und ihre heutige Präsenz in erster Linie politisch und symbolisch begründet ist. Im Fall von Luxemburg kommen den drei Sprachen unterschiedliche Funktionen zu, wodurch wir auch hier nicht von eigentlichen Sprachgemeinschaften sprechen können.
Darüber hinaus sind die gewichtigen Unterschiede in der Bevölkerungszahl (von weniger als 10 000 in Murten bis zu mehr als 100 000 in Luxemburg) und Fläche (von unter 10 km2 für Freiburg bis zu mehr als 50 km2 für Luxemburg) hervorzuheben.
Neben den erwähnten Unterschieden besteht – zusätzlich zur in unterschiedlicher Form und Ausprägung vorhandenen Mehrsprachigkeit – die Gemeinsamkeit der Präsenz der französischen Sprache. Auch diese zeigt sich allerdings in verschiedenen Kontexten: als Mehrheitssprache (Freiburg), als Minderheitensprache (Murten und Biel), als politisch gestützte Sprache mit vornehmlich symbolischer Funktion (Aosta) oder als wichtigste Amtssprache aber nicht wichtigste Hauptsprache der Bevölkerung (Luxemburg).
Eine Tabelle mit weiteren Daten zeigen wir in Anhang F.1.
A.1.3Fragestellungen
In den folgenden Untersuchungen zu den fünf mehrsprachigen Städten Freiburg, Murten, Biel, Aosta und Luxemburg sowie zur für Vergleiche herangezogenen einsprachigen Stadt Aarau werden wir uns mit den folgenden grundlegenden Fragestellungen befassen:
Entspricht die Präsenz der berücksichtigten Sprachen (d.h. der offiziellen und/oder traditionellen Sprachen der jeweiligen Städte) respektive mehrsprachiger1 Einheiten in der Linguistic Landscape der tatsächlichen aktuellen Sprachsituation der jeweiligen Stadt in Bezug auf die Anteile der Sprecherinnen und Sprecher der jeweiligen Sprachen?
Entspricht die Präsenz der berücksichtigten Sprachen (d.h. der offiziellen und/oder traditionellen Sprachen der jeweiligen Städte) respektive mehrsprachiger Einheiten in der Linguistic Landscape allfälligen sprachpolitischen und/oder sprachplanerischen Regelungen (falls vorhanden) der jeweiligen Städte und/oder Regionen?
Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Zonen (‹Altstadt› vs. Gesamtgebiet) der Städte? Wo sind mehrsprachige Einheiten und Minderheitensprachen resp. weniger vertretene Sprachen mit grösserer Wahrscheinlichkeit anzutreffen?
Gibt es in Bezug auf Fragen 1-3 Unterschiede zwischen den Kategorien top-down und bottom-up?
Gibt es in Bezug auf Fragen 1-4 Unterschiede zwischen den fünf untersuchten mehrsprachigen Städten und der einsprachigen ‹Vergleichsstadt›?
Welche Rolle spielt die grafische Darstellung der verschiedenen Versionen in mehrsprachigen Einheiten?
Welche Rolle spielt die (vollständige oder partielle) Übersetzung in mehrsprachigen Einheiten? Gibt es typische Übersetzungsstrategien der mehrsprachigen Linguistic Landscape?
Gibt es in Bezug auf die Fragen 6-7 Unterschiede zwischen den Kategorien top-down und bottom-up?
Gibt es in Bezug auf die Fragen 6-8 Unterschiede zwischen den fünf untersuchten mehrsprachigen Städten und der einsprachigen Vergleichsstadt?
Die Fragen 1-5 sind Gegenstand der Untersuchungen zu sämtlichen in den jeweiligen Städten erhobenen Einheiten, während die Fragen 6-9 anhand ausgewählter einzelner Beispiele in einem rein qualitativen Ansatz behandelt werden.
Diese Behandlung der Fragestellungen soll schliesslich auch zur Beantwortung der Frage führen, ob eine Methode, die sich ausschliesslich auf eine Betrachtung der Linguistic Landscape im in A.3.3.1 definierten Sinn beschränkt, Aussagen über Sprachdemografie und Sprachpolitik eines bestimmten Territoriums zulässt.
A.2Sprachgeschichte und Sprachsituation der untersuchten Orte
A.2.0Mehrsprachigkeit in der Schweiz1
Die Schweiz wird als Bundesstaat auf den drei Staatsebenen Bund, Kanton und Gemeinde verwaltet, wobei jede Einheit der drei Ebenen ihre offiziellen Sprachen festlegt. In einigen Kantonen existiert ausserdem eine zusätzliche dezentralisierende Ebene zwischen Gemeinde und Kanton, bestehend aus Bezirken oder Kreisen, welche ebenfalls offizielle Sprachen bestimmen, was in der vorliegenden Untersuchung insbesondere für die Fälle von Freiburg und Murten von Bedeutung ist (vgl. A.2.1 und A.2.2). Auf die gesetzlichen Grundlagen der Sprachpolitik auf Kantons-, Bezirks- (respektive Kreis-) und Gemeindeebene für die betreffenden Städte und Regionen gehen wir in den jeweiligen Kapiteln ein (A.2.1.2, A.2.2.2, A.2.3.2, A.2.6) und befassen uns hier mit den Bestimmungen auf Bundesebene.
Die offiziellen Landes- und Amtssprachen der Schweiz werden in den Artikeln 4 und 70 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft festgelegt:
Art. 4 Landessprachen
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Art. 70 Sprachen
1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2 Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3 Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
4 Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben.
5 Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache.
(BV, Art. 4; Art. 70)
Die Sprachenfreiheit wird in Artikel 18 festgehalten:
Art. 18 Sprachenfreiheit
Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.
(BV, Art. 18)
Vier Sprachen erhalten also gemäss Artikel 4 der Bundesverfassung den Status einer «Landessprache» (Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch), nur drei davon sind jedoch «Amtssprachen des Bundes» gemäss Artikel 70 Absatz 1: Deutsch, Französisch und Italienisch. Rätoromanisch ist lediglich Amtssprache für ausdrücklich an Mitglieder der rätoromanischen Sprachgemeinschaft gerichtete Kommunikation, während die übrige Kommunikation grundsätzlich dreisprachig gewährleistet werden sollte.
Seit 2010 ist zusätzlich das Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (kurz Sprachengesetz, SpG, SR 441.1) in Kraft, das zusammen mit der zugehörigen Verordnung (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11) den Umgang mit der schweizerischen Mehrsprachigkeitssituation auf staatlicher Ebene regelt2. In Artikel 2 wird der Zweck des Sprachengesetzes festgehalten:
a. die Viersprachigkeit als Wesensmerkmal der Schweiz stärken;
b. den inneren Zusammenhalt des Landes festigen;
c. die individuelle und die institutionelle Mehrsprachigkeit in den Landessprachen fördern;
d. das Rätoromanische und das Italienische als Landessprachen erhalten und fördern.
(SpG, Art. 2)
In Artikel 3 Absatz 1 werden die Grundsätze festgelegt, die der Bund «bei der Erfüllung seiner Aufgaben» zu beachten hat:
a. Er achtet darauf, die vier Landessprachen gleich zu behandeln.
b. Er gewährleistet und verwirklicht die Sprachenfreiheit in allen Bereichen seines Handelns.
c. Er trägt der herkömmlichen sprachlichen Zusammensetzung der Gebiete Rechnung.
d. Er fördert die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften.
(SpG, Art. 3)
Die Mehrsprachigkeit des Landes wird also gesetzlich anerkannt und soll sowohl im Sinne von individuellen Kompetenzen der Einwohnerinnen und Einwohner als auch in Bezug auf Sprachgebrauch und Kommunikation der Behörden und Institutionen gefördert werden. Dazu vorgesehen sind namentlich Massnahmen im Bereich der Schule (Art. 14, 15 und 16 SpG; Art. 9 und 10 SpV), finanzielle Unterstützungen für die als mehrsprachig anerkannten Kantone Bern, Freiburg, Wallis und Graubünden (Art. 21 SpG; Art. 17 SpV) sowie für die Kantone Tessin und Graubünden zur Förderung der beiden kleinsten Sprachgemeinschaften Italienisch und Rätoromanisch (Art. 22 SpG; Art. 18-25 SpV). Empfehlungen und Bestimmungen zur Vertretung der Sprachgemeinschaften innerhalb der Bundesverwaltung werden ebenfalls abgegeben (Art. 7 SpV).
Die Schweiz kennt im Grundsatz das Territorialitätsprinzip in Sinne einer abgegrenzten räumlichen Verteilung der offiziellen Sprachen. Dieses Prinzip wird in Artikel 70 der Bundesverfassung und im Sprachengesetz lediglich umschrieben: «Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten» (Art. 70 BV); «Er [Der Bund] trägt der herkömmlichen sprachlichen Zusammensetzung der Gebiete Rechnung» (Art. 3 Abs. 1 Bst. a SpG). Die Umsetzung erfolgt jedoch durch die Entscheide auf Kantons- und Gemeindeebene, namentlich auch in Bezug auf den Sprachenunterricht an den Schulen3. Das Territorialitätsprinzip bedeutet konkret, dass die Schweiz zwar auf Bundesebene viersprachig ist und dass Kantone und Bezirke mehrsprachig sein können, die Gemeinden jedoch in der Regel eine einzige offizielle Sprache anerkennen. Zu den wenigen Ausnahmen zählt – als einzige Stadt – Biel, nicht aber die Gemeinden Freiburg und Murten (vgl. A.1.2, A.2.2, A.3.2). In Abb. A.2.0.1 bilden wir die entsprechende Karte der Kantone und (offiziellen) Sprachregionen der Schweiz ab:
Abb. A.2.0.14
Durch dieses Prinzip der räumlichen Abgrenzung der Landes- und Amtssprachen unterscheidet sich die Schweiz von anderen mehrsprachigen Ländern wie Luxemburg (vgl. A.2.5), dessen Mehrsprachigkeitspolitik als ‹Funktionsprinzip› bezeichnet werden kann.
Die Zahlen zu den Sprachgemeinschaften in den vier Landessprachen werden regelmässig erhoben. Die letzte vollständige Erhebung in Form einer Volkszählung fand jedoch im Jahr 2000 statt, seither werden jährliche Strukturerhebungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Volkszählung von 2000 wurden von Lüdi und Werlen in Bezug auf die Sprache ausgewertet (Lüdi/Werlen 2005). Gemäss diesen Auswertungen ist Deutsch die Hauptsprache5 von 63,7% der Wohnbevölkerung6 (4 640 359 Personen), Französisch von 20,4% (1 485 056 Personen), Italienisch von 6,5% (470 961 Personen) und Rätoromanisch von 0,5% (35 095 Personen). 9% (656 539 Personen) bezeichnen eine Nichtlandessprache als Hauptsprache (vgl. Lüdi/Werlen 2005: 7).
Die folgende Karte (Abb. A.2.0.2) zeigt die Verteilung der vier offiziellen Landessprachen in der Schweiz, indem die dominierende Landessprache nach Gemeinden angegeben wird. Es wird unterschieden zwischen «mittlere», «starke» oder «keine» Dominanz.
Abb. A.2.0.2 7
Die nach dem Jahr 2000 erhobenen Daten lassen sich damit nur bedingt vergleichen, da sie erstens nicht im Rahmen einer umfassenden Volkszählung erhoben wurden, sondern durch eine Strukturerhebung, und da zweitens seit 2010 bei der Frage nach der «Hauptsprache» Mehrfachnennungen möglich sind und das Total von 100% damit überschritten wird. Karten der dominierenden Sprache nach Gemeinden stehen nach 2000 ebenfalls nicht mehr zur Verfügung und wurden ersetzt durch Karten zur Verteilung der Wohnbevölkerung nach Hauptsprachen und Kantonen8.
Eine Auswertung der Erhebungen der Jahre 2010-2012 ergibt für die Wohnbevölkerung folgende Resultate: 65,4% nennen Deutsch als Hauptsprache, 22,6% Französisch, 8,4% Italienisch, 0,6% Rätoromanisch (Pandolfi/Casoni/Bruno 2016: 27)9.
Die Zahlen von 2016 wurden 2018 durch das Bundesamt für Statistik veröffentlicht10: 62,8% nennen Deutsch als Hauptsprache, 22,9% Französisch, 8,2% Italienisch, 0,5% Rätoromanisch11.
Wir konzentrieren uns in unserer Untersuchung auf die in den betreffenden Gebieten auf einer der Staatsebenen anerkannten offiziellen Amts- oder Landessprachen und befassen uns daher auch hier nicht eingehender mit den in der Schweiz präsenten Sprachen ohne offiziellen Status12.
A.2.1Freiburg (Kanton und Stadt)
A.2.1.1Sprachgeschichtlicher Überblick
Der Kontakt zwischen romanischer und germanischer Sprache findet im Gebiet des heutigen Kantons Freiburg sehr früh statt. Bevor die Gebiete im 1. Jahrhundert v.Chr. Teil des Römischen Reiches werden, sind sie durch die keltischen Helvetier bevölkert. Im 3. Jahrhundert führen die eingewanderten Alemannen die germanischen Sprachen ein, während die zur selben Zeit eingewanderten Burgunder rasch romanisiert werden (vgl. Mariano 2010: 290).
Die Gründung der Stadt Freiburg erfolgt 1157 durch den Herzog Berchtold IV von Zähringen. Die Stadt erobert bald neue, sowohl deutsch- als auch französischsprachige Gebiete.
Für die Entwicklungen der Sprachsituation sind schliesslich insbesondere die Ereignisse im 15. Jahrhundert wichtig. Nach den Burgunderkriegen wird die Stadt Freiburg 1477 unabhängig und erhält den Status einer freien Reichsstadt (vgl. HLSa; HLSb). Dies hat eine bedeutende Vergrösserung ihrer zugehörigen Gebiete zur Folge, die sie in mehreren Fällen (dazu zählt auch das Gebiet um Murten, vgl. A.2.2.1) zusammen mit Bern als ‹Gemeine Herrschaften› (vgl. HLSc; HLSd) verwaltet. Auch der offizielle Sprachgebrauch ändert sich zu dieser Zeit: Latein wird aufgegeben, zu Gunsten vor allem des Französischen, das erste Amtssprache wird, aber auch des Deutschen (vgl. Altermatt 2003: 22).
Einige Jahre später, 1481, wird der Kanton Freiburg – als erster nicht ausschliesslich deutschsprachiger Kanton – in die Eidgenossenschaft aufgenommen, wodurch die Bedeutung des Deutschen im Kanton weiter gestärkt wird. Deutsch wird 1483 Verwaltungssprache. Sein Gebrauch ist allerdings auf die Beziehungen nach aussen, die Kanzlei, die Räte und die Beziehungen zu den Gemeinen Herrschaften beschränkt (vgl. Altermatt 2003: 26), in den französischsprachigen Gebieten des Kantons bleibt Französisch einzige Verwaltungssprache.
Als 1798 in der Folge des Zusammenbruchs des Ancien Régime die Helvetische Republik entsteht (vgl. HLSe), ändert sich die sprachliche Situation des Gebietes erneut. Im Zuge einer territorialen Neuaufteilung während der Helvetischen Republik werden nicht nur die Region um Murten, sondern auch mehrere französischsprachige Gebiete vollständig Teil des Kantons Freiburg. Französisch wird Kommunikationssprache der Kantonsverwaltung mit der kurzzeitigen Landesregierung, dem Helvetischen Direktorium (vgl. HLSe). Deutsch bleibt zunächst noch Sprache der Kommunikation mit den übrigen Gebieten der Eidgenossenschaft und verliert seinen offiziellen Status zu Beginn des 19. Jahrhunderts ganz (vgl. Altermatt 2003: 29).
Auch nach dem Ende der Helvetischen Republik 1803 und der darauf folgenden Mediationszeit (vgl. HLSf) verändert sich diese Sprachsituation kaum (vgl. Altermatt 2003: 30). Als 1830 ein liberales Regime eingerichtet wird, bleibt eine gewisse Zweisprachigkeit erhalten, als Regierungssprache gilt allerdings ausschliesslich Französisch (vgl. Altermatt 2003: 33).
Nach dem Schweizerischen Bürgerkrieg (‹Sonderbundskrieg›, vgl. HLSg) wird eine neue kantonale Verfassung geschaffen, durch welche die Bezirksverteilung innerhalb des Kantons Freiburg entsteht (vgl. A.2.1.2), die weitestgehend bis heute gilt.
Als es 1857 erneut zu einem Regierungswechsel und zu einer Änderung der Kantonsverfassung kommt, wird der Versuch unternommen, weder das Französische noch das Deutsche zu bevorzugen: Es wird keine offizielle Sprache mehr festgelegt und Französisch bleibt lediglich Originalsprache der juristischen Dokumente.
Spannungen bleiben dennoch nicht aus. Namentlich während des Ersten Weltkriegs sind die Spannungen zwischen Deutsch- und Französischsprachigen, die in der ganzen Schweiz wahrnehmbar sind und namentlich durch die Propaganda der Kriegsparteien in der Schweiz verstärkt werden (vgl. Elsig 2014), in Kanton und vor allem Stadt Freiburg deutlich zu spüren (vgl. Tétaz 2007: 74-75). In der Zwischenkriegszeit wird die deutschsprachige Gemeinschaft zwar stärker in die Kantonsregierung eingebunden, diese versteht den Kanton jedoch nach wie vor als vornehmlich französischsprachig (vgl. Altermatt 2003: 47). Während dem Zweiten Weltkrieg ist die Situation nicht mehr dieselbe. Kulturelle und sprachliche Vielfalt werden als Teil der Schweizerischen Identität verstanden und auch in Freiburg wird diese Haltung geteilt (vgl. Altermatt 2003: 48).
Von der hier mit Blick auf die Sprachsituation kurz umrissenen Geschichte des Kantons hebt sich diejenige der Stadt Freiburg zuweilen ab, was auch für Murten gilt. Auf die (Sprach)geschichte Murtens werden wir in A.2.2.1 eingehen, auf die aktuelle Sprachsituation in Stadt und Kanton Freiburg in A.2.1.2. Hier beleuchten wir zunächst einige sprachgeschichtlich bedeutende Ereignisse in der Stadt Freiburg. Die Stadt wird 1157 gegründet und ihre Bevölkerung besteht bereits zu diesem Zeitpunkt aus deutschsprachigen und französischsprachigen Einwohnerinnen und Einwohnern (Altermatt 2007: 400). Die schwäbische Herkunft der zähringischen Stadtgründer1 und die Abhängigkeit der damals existierenden zwei Klöster von deutschen Provinzen (Altermatt 2003: 19) tragen zur Bedeutung des Deutschen bei, was sich auch in der Toponymie niederschlägt. Gleichzeitig gewinnt Französisch in der Stadt Freiburg rasch an Bedeutung durch die Einwanderung aus den abhängigen französischsprachigen Gebieten. Der Kontakt der beiden Sprachen ist daher seit der Stadtgründung attestiert (vgl. Guex 2010: 58).
Die Stärkung des Deutschen durch den Eintritt in die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert hat im Kantonshauptort Freiburg jedoch besonders deutliche Auswirkungen, während sie in den umliegenden Gebieten weniger zu spüren ist. Im 18. Jahrhundert werden namentlich durch die in der Stadt wohnhaften Patrizierfamilien wieder intensivere Beziehungen mit Frankreich gepflegt (vgl. Villiger/Bourceraud 2008: 21). Als die französische Sprache zu dieser Zeit im gesamten Kanton wieder an Bedeutung gewinnt, ist daher auch diese Bewegung in der Stadt stärker zu spüren als in anderen Kantonsgebieten. Die Veränderungen der sprachlichen Situation und die wiederholten Wechsel des Status der beiden Sprachen Französisch und Deutsch sind also in der Stadt Freiburg grundsätzlich stärker als anderswo in den heutigen Kantonsgebieten. Dies gilt ebenso für die erwähnten Spannungen während dem Ersten Weltkrieg und für eine positivere Haltung gegenüber dem Sprachkontakt während des Zweiten Weltkriegs und bis heute (vgl. z.B. Wicht-Pierard 2007: 171).
A.2.1.2Aktuelle Sprachsituation
Bevor wir die aktuellen sprachdemografischen und sprachpolitischen Gegebenheiten von Kanton und Stadt Freiburg zusammenstellen, möchten wir auf die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingehen und ziehen dazu im Wesentlichen die Untersuchung von Altermatt (2003) heran, in der Folgendes festgestellt wird:
[L]es deux décennies suivant la Seconde Guerre mondiale furent essentiellement marquées par la continuité d’une situation linguistique inégalitaire et discriminante envers la minorité germanophone. […]
À la fin des années 1950, la situation linguistique et le biculturalisme furent l’objet d’un regain d’intérêt, notamment de la part des milieux culturels […]. Les revendications de plus en plus explicites de la minorité ainsi que leur articulation à travers des organismes privés (DFAG [Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft]) ou publics (Grand Conseil) contribuèrent à la sensibilisation progressive des autorités cantonales. […] La consécration de l’article constitutionnel sur les langues cantonales au tournant des années 1980/90 marqua le point culminant de ce mouvement vers l’égalité linguistique qui, par ailleurs, continue encore au XXIe siècle. (Altermatt 2003: 308-309)
Er nennt im Weiteren ein Ungleichgewicht zwischen sprachlicher Realität und administrativer Praxis:
La situation du canton de Fribourg en général et des districts du Lac et de la Sarine en particulier démontre que des problèmes sont susceptibles d’apparaître dans des régions où on assiste à un déséquilibre trop marqué entre la réalité linguistique (bilinguisme) et la pratique administrative (monolinguisme). (Altermatt 2003: 313)
Dennoch wird eine verstärkte Anerkennung der Zweisprachigkeit auf Kantonsebene eingeräumt:
Malgré ces quelques points ambigus, le bilinguisme fribourgeois s’est fortement développé dans la deuxième moitié du XXe siècle. La politique des langues du canton de Fribourg tend résolument vers un renforcement de la coexistence linguistique et vers une application des avantages du biculturalisme. Le bilinguisme n’a jamais été autant favorisé et valorisé qu’à la fin du XXe et au début du XXIe siècles. (Altermatt 2003: 315)
Trotz der erwähnten verstärkten Massnahmen für eine Unterstützung der Zweisprachigkeit seit Ende des 20. Jahrhunderts scheint im Kanton Freiburg eine stetige Abnahme der Minderheiten auf allen Ebenen stattzufinden. Wie die von Altermatt (2003: 348-350) betrachteten Zahlen aufzeigen, findet von 1990 bis 2000 sowohl auf kantonaler Ebene als auch in den meisten Bezirken und Gemeinden eine Abnahme der Sprechenden der jeweiligen Minderheitensprache statt. Für die Stadt Freiburg stellt Altermatt die folgenden Veränderungen fest (vgl. A.2.2.2 für die entsprechende Auswertung für Murten):
En 100 ans (1888-1990) : diminution importante (-9.41) / en 50 ans (1941-1990) : diminution significative (-7.0) / en 30 ans (1960-1990) / diminution significative (-7.0) (vgl. Altermatt 2003: 348-350).
Die Grundlagen der regionalen Sprachpolitik hängen wiederum von der Aufteilung in verschiedene Staats- und Verwaltungsebenen ab. Der Kanton Freiburg ist einer der vier offiziell mehrsprachigen Kantone der Schweiz (vgl. A.2.0) und wird administrativ in sieben Bezirke unterteilt. Vier davon sind offiziell französischsprachig (Broye, Glâne, Gruyère2, Sarine (Saane)3 und Veveyse), einer deutschsprachig (Sense) und einer zweisprachig (See/Lac). Die in der vorliegenden Untersuchung betrachteten Städte Freiburg und Murten sind Hauptorte der Bezirke Saane respektive See (vgl. A.2.2.2).
In Artikel 6 der Verfassung des Kantons Freiburg werden Deutsch und Französisch als Amtssprachen auf kantonaler Ebene festgelegt. Gleichzeitig wird in Absatz 2 das Territorialitätsprinzip – im Gegensatz zu den schweizerischen Bestimmungen auf Bundesebene, vgl. A.2.0 – explizit als solches bezeichnet:
Art. 6 Sprachen
1 Französisch und Deutsch sind die Amtssprachen des Kantons.
2 Ihr Gebrauch wird in Achtung des Territorialitätsprinzips geregelt: Staat und Gemeinden achten auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
3 Die Amtssprache der Gemeinden ist Französisch oder Deutsch. In Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit können Französisch und Deutsch Amtssprachen sein.
4 Der Staat setzt sich ein für die Verständigung, das gute Einvernehmen und den Austausch zwischen den kantonalen Sprachgemeinschaften. Er fördert die Zweisprachigkeit.
5 Der Kanton fördert die Beziehungen zwischen den Sprachgemeinschaften der Schweiz.
(Verfassung FR, Art. 6)
Die Gemeinden des Kantons Freiburg hätten zwar auch die gesetzliche Grundlage für Ausnahmen zum Territorialitätsprinzip (Art. 6 Abs. 3 Verfassung FR), bisher hat jedoch keine Freiburger Gemeinde davon Gebrauch gemacht. Für die Stadt Freiburg gibt es keine weitergehenden Bestimmungen zur Sprachpolitik (vgl. z.B. Brohy 2011: 110).
Gemäss den Statistiken zu den Hauptsprachen aus der Volkszählung von 2000 war eine Mehrheit der Wohnbevölkerung von 63,2% französischsprachig und eine Minderheit von 29,2% deutschsprachig (Lüdi/Werlen 2005: 23). In den letzten verfügbaren Erhebungen von 20164 (vgl. A.2.0 in Bezug auf die Vergleichbarkeit mit Erhebungen bis und mit 2000) nannten von den 305 603 Einwohnerinnen und Einwohnern5 80 116 Deutsch als Hauptsprache6 und 209 109 Französisch. Im Saanebezirk sind es 2014-2016 (kumuliert) 13 512 mit Deutsch als genannter Hauptsprache zu 80 909 mit Französisch (2000: 14,5% zu 75,3%, vgl. Lüdi/Werlen 2005: 93). Für die Stadt Freiburg stellen Lüdi/Werlen (2005: 93) für das Jahr 2000 Anteile von 63,6% Französischsprachigen zu 21,2% Deutschsprachigen fest.
A.2.2Murten
A.2.2.1Sprachgeschichtlicher Überblick
Die Anfänge der Besiedelung der Region vor der Gründung der Stadt Murten ist mit den Gegebenheiten im übrigen Gebiet des heutigen Kantons Freiburg vergleichbar (vgl. A.2.1.1): Besiedelung durch Helvetier, römische Einflüsse durch die Gründung der Kolonie Aventicum, Einwanderung der Burgunder und Alemannen (vgl. Mariano 2010: 290). Romanische und germanische Sprache stehen auch hier sehr früh in Kontakt.
1034 wird die Stadt Murten in der Folge eines Konflikts im Zuge der Auseinandersetzungen über das Erbe Rudolfs von Burgund zerstört (vgl. Mariano 2010: 294-295). Seit der Gründung der Stadt Freiburg (vgl. A.2.1.1) sind die Zähringer in der Region präsent und Ende des 12. Jahrhunderts gründen sie mutmasslich eine neue Stadt Murten an der Stelle der zerstörten Burgunderstadt (Mariano 2010: 302; HLSh). Wie in Freiburg hat auch in Murten die Ankunft der Zähringer die Bedeutung der deutschen Sprache verstärkt.
Nach dem Ende der Zähringerherrschaft 1218 durch den Tod Herzog Berchtolds V verlaufen die Entwicklungen in Murten jedoch anders als in Freiburg. Murten und Bern werden seither direkt durch Kaiser Friedrich II regiert, während Freiburg zusammen mit anderen Städten an die Dynastie der Kyburger fällt. In der Folge des Konfliktes zwischen den Städten, die sich unter dem Schutz des Kaisers befinden, und denjenigen unter Schutz der Kyburger stellt sich Murten unter den Schutz von Peter von Savoyen, der im Anschluss Herrscher der Stadt Murten wird (vgl. Mariano 2010: 307-309). Die Zeit der Herrschaft Savoyens in Murten dauert bis 1475, anschliessend fällt das Territorium als ‹Gemeine Herrschaft› an Freiburg und Bern.
Während die vorherrschende Sprache in der Savoyerzeit noch Französisch war, wird Murten nun unter dem Einfluss von Bern zunehmend deutschsprachig. 1530 schliesst sich Murten der Reformation an, wie Bern bereits zwei Jahre zuvor. Die Orientierung Murtens in Richtung Bern und weg vom katholischen Freiburg wird dadurch noch verstärkt, was gleichzeitig eine zunehmende Bedeutung der deutschen Sprache zur Folge hat (vgl. Altermatt 2003: 27).
Während der Zeit des Ancien Régime bleibt Murten Gemeine Herrschaft von Freiburg und Bern, bevor es 1803 durch die Mediation (vgl. A.2.1.1) definitiv Teil des Kantons Freiburg wird. Die sprachliche Situation scheint sich dadurch allerdings nicht zu verändern (vgl. HLSh).
Murten bleibt Teil des Kantons Freiburg, behält aber seine Orientierung nach Bern bei, begünstigt durch die Konfession und die deutschsprachige Mehrheit. Im 19. Jahrhundert nimmt auch in Murten die Industrialisierung zu und ein früher Tourismus gewinnt bereits vor dem Ersten Weltkrieg an Bedeutung. Internationale Unternehmen werden sich erst später in Murten niederlassen. Ein entscheidender Faktor für die Bekanntheit der Kleinstadt Murten innerhalb der Schweiz ist die Tatsache, dass die zweite Schlacht der Burgunderkriege 1476 auf dem Stadtgebiet ausgetragen wurde. Die Gedenkfeier von 1876 trägt wesentlich zu den Anfängen des Tourismus in Murten bei. In näherer Vergangenheit erhält Murten durch die Landesausstellung ‹expo.02› im Jahr 2002 erneut nationale Beachtung (vgl. HLSh).
A.2.2.2 Aktuelle Sprachsituation
Die Stadt Murten ist heute Hauptort des zweisprachigen Seebezirks/District du Lac, der als einziger der sieben Bezirke des Kantons Freiburg offiziell zweisprachig ist und Deutsch und Französisch als Amtssprachen auf Bezirksebene anerkennt, während seine einzelnen Gemeinden offiziell wiederum einsprachig sind. Gemäss den Resultaten der Erhebungen des Bundesamtes für Statistik für 2014-2016 (kumuliert) nennen 22 550 Einwohnerinnen und Einwohner des Seebezirks Deutsch und 11 320 Französisch als Hauptsprache, wobei Mehrfachnennungen möglich sind.
Wie für die Stadt Freiburg werden auch für die Gemeinde Murten (vgl. A.2.1.2) keine sprachpolitischen Grundlagen explizit festgehalten, eine Regelung zur Sprachpolitik findet sich in den Gemeindereglementen nicht1. Die Gemeinde ist offiziell deutschsprachig, verfügt aber über eine französischsprachige Minderheit. Gemäss den aktuellsten Zahlen gelten die 8 218 Einwohnerinnen und Einwohner von Murten zu 83% als deutschsprachig und zu 15% als französischsprachig2. Im Unterschied zu den Erhebungen des Bundesamtes für Statistik sind Mehrfachnennungen hier nicht zugelassen. Offiziell ist die Gemeinde deutschsprachig. In A.2.1.2 haben wir mit Altermatt die Entwicklung der Minderheitensprache in Freiburg gezeigt. Die gleiche Untersuchung für Murten bietet das folgende Bild:
En 100 ans (1888-1990) : diminution faible (-0.53))/ en 50 ans (1941-1990) : augmentation faible (+2.0) / en 30 ans (1960-1990) / augmentation faible (+0.8) (Altermatt 2003: 348-350)
Die französischsprachige Minderheit in Murten ist also zwar kleiner als die deutschsprachige Minderheit in Freiburg, jedoch ist die Situation in Murten während dem gesamten 20. Jahrhundert stabiler als jene in Freiburg. Die Zahl der Sprechenden der Minderheitensprache Französisch hat auf die 100 Jahre zwischen 1888 und 1990 gesehen zwar insgesamt leicht ab-, gegen Ende dieser Zeitspanne jedoch wieder etwas zugenommen.
Dieser Unterschied zwischen den Städten Freiburg und Murten entspricht auch der allgemeinen Situation in den jeweiligen Bezirken. Im Saanebezirk mit Hauptort Freiburg ist die Mehrheitssprache in allen 46 Gemeinden Französisch. In 32 dieser Gemeinden hat die deutschsprachige Minderheit von 1990 bis 2000 abgenommen. Im Seebezirk mit Hauptort Murten ist die Abnahme der Sprechenden der jeweiligen Minderheitensprache insgesamt schwächer als im Saanebezirk und betrifft hier hauptsächlich das Französische in den Gemeinden mit deutschsprachiger Mehrheit. Die Abnahme der Minderheiten stärkt also das Französische im Saanebezirk und in etwas schwächerer Form das Deutsche im Seebezirk (vgl. Altermatt 2003: 264-271).
A.2.3Biel
A.2.3.1Sprachgeschichtlicher Überblick
Im Gegensatz zu den Gebieten der heutigen Städte Freiburg und Murten (vgl. A.2.1.1 und A.2.2.1) sind für die Region der heutigen Stadt Biel keine Belege für eine Besiedelung in der vorrömischen Zeit vorhanden (vgl. HLSi). Die erste bekannte Besiedelung ist diejenige durch die Alemannen im 6. oder 7. Jahrhundert. Wie im Gebiet des heutigen Kantons Freiburg (vgl. A.2.1.1) fand zwar auch in dieser Gegend früh ein erster Kontakt zwischen romanischer und germanischer Kultur statt, jedoch nur vorübergehend: «[A]b dem 8. Jh. dominierte das germanische Kulturelement» (HLSi: 1.2.).
Die Stadt Biel kann nicht seit ihrer Gründung als zweisprachig bezeichnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt zwischen 1225 und 1230 durch den Bischof von Basel, Heinrich II von Thun, gegründet wurde (vgl. HLSi) und somit zu einer Zeit, in der die betreffende Gegend längst deutschsprachig war. Seit ihrer Gründung befindet sich die Stadt in einer angespannten Situation zwischen verschiedenen Machthabern und Bündnispartnern. Sie ist gleichzeitig Verwaltungszentrum eines Teils des Basler Fürstbistums, emanzipiert sich aber rasch von der Herrschaft durch den Bischof und schliesst im 13. Jahrhundert eigene Verträge ab, dies unter anderem mit der Stadt Bern, was 1367 zum Krieg zwischen Bern und der bischöflichen Herrschaft in Basel führt. In der Folge fällt Biels Nachbarort Nidau an Bern. Biel wird somit zur Grenzstadt der bischöflichen Gebiete, wodurch der Aufbau eines eigenen Herrschaftsgebietes verhindert wird (vgl. HLSi).
Im 15. Jahrhundert erhält die Stadt den Status eines zugewandten Ortes der Schweizerischen Eidgenossenschaft1, wird somit nicht als vollberechtigter Ort anerkannt und bleibt sogenannte ‹Landstadt› unter fürstbischöflicher Herrschaft.
Die Französische Revolution stellt schliesslich einen entscheidenden Moment der Stadtgeschichte dar, der sich auch auf die Sprachsituation der Stadt auswirken sollte. Nachdem Frankreich 1793 zunächst Teile des Fürstbistums Basel annektiert hatte, wurde 1798 schliesslich auch die Stadt Biel als ‹Canton de Bienne› innerhalb des ‹Département du Mont-Terrible› für kurze Zeit Teil Frankreichs (vgl. HLSi). Innerhalb des Departements, das grösstenteils aus Gebieten des heutigen Kantons Jura bestand, wird Deutsch zur Minderheitensprache. Das Französische gewinnt in Biel zunächst an Präsenz durch die Anwesenheit französischer Funktionäre und Soldaten, die sich von dort aus auf den Angriff auf Bern vorbereiten. Dieser endet mit der Niederlage Berns und führt schliesslich zur Gründung der Helvetischen Republik (vgl. HLSe). Die französische Sprache wird aber auch zur offiziellen Sprache der Administration, anscheinend ohne grossen Widerstand der Bieler Bevölkerung: «Dès le 20 mars 1798, la correspondance administrative fut tenue en français, comme si ce changement avait été la chose la plus naturelle du monde» (Kaegi 2013: 472).
Biel blieb auch nach dem Ende der Helvetischen Republik unter französischer Herrschaft (nun innerhalb des neuen ‹Département du Haut-Rhin›) bis zur Niederlage Napoleons 1814 und wird im Zuge der Entscheidungen des Wiener Kongresses schliesslich Teil des Kantons Bern, obwohl sich grosse Teile der Bevölkerung einen eigenständigen Kanton Biel innerhalb der Schweizerischen Eidgenossenschaft wünschen. Das Verhältnis zum Kanton Bern ist zunächst weiterhin angespannt:
Die Skepsis gegenüber Bern blieb bestehen. Ein Teil der Bieler Bürger schloss sich aus den verschiedensten Motiven der liberalen Opposition gegen das Berner Regime an […]. 1832 wurde Biel Hauptort des gleichnamigen, neu geschaffenen Amtsbezirks. Erst mit der einsetzenden Demokratisierung während der Regenerationszeit begannen die Bieler, sich mit dem Staat Bern zu identifizieren. (HLSi: 3.1.1.)
Bis heute ist die Stadt Teil des Kantons Bern geblieben und seit 2010 Hauptort des Verwaltungskreises Biel/Bienne (vgl. A.2.3.2). Die hier kurz beschriebenen Ereignisse bis zur Aufnahme der Stadt in den Kanton Bern hatten – mit Ausnahme der französischen Periode – kaum Auswirkungen auf die Sprachsituation der bis dahin deutschsprachigen Stadt, in der das Französische lediglich durch den Kontakt mit französischsprachigen Gebieten (vgl. Werlen 2010: 10) und seit dem 18. Jahrhundert als «zweite Umgangs- und Bildungssprache» der Oberschicht (HLSi: 2.7.) gebräuchlich war. Dies ändert sich mit der raschen Stadtentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in deren Folge sich die überbaute Fläche rund verzehnfacht. Die Stadt erlebt namentlich dank dem Uhrmacherhandwerk, das als Ersatz für die gescheiterte Baumwollindustrie eingeführt wird, einen wirtschaftlichen Aufschwung.
Für diesen neu in Biel angesiedelten Zweig werden zahlreiche Arbeitskräfte aus den französischsprachigen Gebieten des nahegelegenen Jura in die Stadt geholt (vgl. Kaestli 2013a: 666). Erst diese Einwanderungen legen den eigentlichen Grundstein für die heutige Zweisprachigkeit der Stadt Biel, die also im Vergleich zu Murten und Freiburg (vgl. A.2.1.1 und A.2.2.1) sehr spät entstanden ist. Die Zweisprachigkeit scheint jedoch sehr schnell in die städtische Realität integriert worden zu sein. Bereits 1845 wird auf eine Forderung der französischsprachigen Gemeinschaft des Uhrmacherhandwerks die erste französische Schule eröffnet, die zunächst als private Einrichtung funktioniert und später von der Gemeinde übernommen wird. Auch ein erstes Projekt für eine zweisprachige Schule existiert bereits zu dieser Zeit: Das Schulreglement von 1857 sieht keine französischsprachigen Schulen, sondern zweisprachigen Unterricht für alle vor. Das Projekt scheitert schliesslich am Mangel an zweisprachig qualifizierten Lehrkräften (vgl. Kästli 2013a: 670). 1893 nimmt die französischsprachige Bevölkerung Biels mit der Umgestaltung der politischen Institutionen der Gemeinde erstmals offizielle Vertretungen in der Stadtpolitik ein (vgl. Kästli 2013b: 756).
Im 19. Jahrhundert findet aber auch eine Einwanderung aus deutschsprachigen Gebieten statt, die ihrerseits Einfluss auf den Sprachgebrauch der deutschsprachigen Stadtbevölkerung hat:
[Es] wirkte sich aber auch die deutschsprachige Einwanderung aus dem benachbarten Seeland aus. Die Einwanderer brachten berndeutsche Dialekte mit und trugen so zur Veränderung des Bieler Dialekts bei. (Werlen 2010: 11)
Das schnelle Wachstum der Stadt führte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schliesslich auch zu einer Verschiebung des Stadtzentrums weg von der Altstadt, «indem der Schüssübergang zwischen Altstadt und dem 1923 eingeweihten neuen […] Bahnhof […] als Zentralplatz gestaltet wurde» (HLSi: 3.2).
Während die Spannungen zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweizer Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs in Freiburg deutlich zu spüren sind (vgl. A.2.1.1), sind die Auswirkungen im nunmehr zweisprachigen Biel geringer. Zwar finden sich auch in Biel Anzeichen für unterschiedliche Sympathien der beiden Sprachgemeinschaften, beispielsweise in der Presse, Konflikte bleiben jedoch aus (vgl. Gaffino 2013a: 779-782).
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die französischsprachige Minderheit stärker in das politische und kulturelle Leben der Stadt eingebunden, wodurch auch die Präsenz der französischen Sprache im öffentlichen Raum zunimmt. 1947 wird erstmals ein französischsprachiger Stadtpräsident gewählt, in dessen Amtszeit 1955 das erste französischsprachige Gymnasium eröffnet wird. Mit dem ‹Capitole› und seinem Gastspieltheaterbetrieb wird Französisch auch zu einer Sprache des Bieler Kulturlebens. Stimmen, die dieser Entwicklung kritisch gegenüberstehen und eine Schwächung der Übermacht der Mehrheitssprache Deutsch ablehnen, existieren zwar, werden aber wenig beachtet, wie das Beispiel der Zeitung Der Bieler zeigt, die mit ihrer antifranzösischen Haltung in Biel keinen Verlag findet und in Zürich erscheinen muss (Gaffino 2013b: 897-903).
A.2.3.2 Aktuelle Sprachsituation
Biel ist heute Hauptort des Verwaltungskreises Biel/Bienne, der zusammen mit dem Verwaltungskreis Seeland zur gleichnamigen Verwaltungsregion Seeland gehört. Sowohl der Kanton Bern als auch der Verwaltungskreis Biel/Bienne sind offiziell zweisprachig, unter grundsätzlicher Einhaltung des Territorialitätsprinzips. Die gesetzliche Grundlage dafür regelt Artikel 6 der Verfassung des Kantons Bern (während Artikel 15 die Sprachfreiheit gewährleistet):
Art. 6 Sprachen
1 Das Deutsche und das Französische sind die bernischen Landes- und Amtssprachen.
2 Die Amtssprachen sind
a das Französische in der Verwaltungsregion Berner Jura,
b das Deutsche und das Französische in der Verwaltungsregion Seeland sowie im Verwaltungskreis Biel/Bienne,
c das Deutsche in den übrigen Verwaltungsregionen sowie im Verwaltungskreis Seeland.
3 Die Amtssprachen der Gemeinden in den Verwaltungskreisen der Verwaltungsregion Seeland sind
a das Deutsche und das Französische für die Gemeinden Biel/Bienne und Leubringen,
b das Deutsche für die übrigen Gemeinden.
4 Kanton und Gemeinden können besonderen Verhältnissen, die sich aus der Zweisprachigkeit des Kantons ergeben, Rechnung tragen.
5 An die für den ganzen Kanton zuständigen Behörden können sich alle in der Amtssprache ihrer Wahl wenden.
(Verfassung BE, Art. 6)
Die Verfassung des Kantons Bern regelt in diesem Artikel auch die offizielle Anerkennung der französischen und deutschen Sprache in der Gemeinde Biel. Diese bildet also – zusammen mit der Gemeinde Leubringen – eine der wenigen Ausnahmen zum Territorialitätsprinzip (sofern dieses als territoriale Aufteilung einsprachiger Gebiete verstanden wird) und ist die einzige Schweizer Stadtgemeinde, die eine solche Ausnahme darstellt. Diese offizielle Anerkennung zweier Sprachen bedeutet einen Unterschied zu den Situationen in Freiburg und Murten (vgl. A.2.1.2 und A.2.2.2). In Artikel 3 der Stadtordnung (Stadt Biel, SGR 101.1) wird die offizielle Zweisprachigkeit Biels auf Gemeindeebene wiederholt1:
Art. 3 – Amtssprachen
1 Deutsch und Französisch sind gleichberechtigte Amtssprachen im Verkehr mit städtischen Behörden und mit der Stadtverwaltung.
2 Städtische Erlasse und amtliche Mitteilungen an die Bevölkerung sind in deutscher und französischer Sprache abzufassen.
(Stadtordnung Biel, Art. 3)
Auch im Bereich der Schule2 oder des kulturellen Angebots wird die Zweisprachigkeit Biels hervorgehoben und soll gefördert werden. Die Stadt betont die Anerkennung und Förderung der Zweisprachigkeit regelmässig in ihrer Kommunikation nach aussen, beispielsweise auf ihrer Website (vgl. auch Brohy 2011: 114)3, durch Slogans wie «Biel/Bienne – la bilingue» (vgl. B.3.6) oder «Willkommen in Biel/Bienne – grösste zweisprachige Stadt der Schweiz und Uhrenweltmetropole»4, und die Zweisprachigkeit wird gerne als prägendes Merkmal dargestellt, oder wie es Werlen (2010: 9) ausdrückt: «Neben Biel gelten verschiedene andere Schweizer Gemeinden als zweisprachig, aber keine ist es so offensichtlich und so programmatisch.» Die Gemeinde untersucht und überwacht den Zustand ihrer Zweisprachigkeit durch Einrichtungen wie das Forum für die Zweisprachigkeit mit dem ‹Barometer der Zweisprachigkeit›5, der beispielsweise für 2008 zu einem äusserst positiven Schluss kommt, zusammengefasst in Conrad/Elmiger 2010:
Die Zweisprachigkeit wird in Biel gelebt und sie ist breit akzeptiert. Sie ist ein Bestandteil der Identität der BewohnerInnen. Diese realisieren auch, dass die Stadt bestrebt ist, diese Besonderheit zu fördern. Die Anstrengungen hierzu werden von der gesamten Bevölkerung vorteilhaft aufgenommen und sie wirken sich positiv auf das Zusammenleben in Biel aus. (Conrad/Elmiger 2010: 106)
Auch die Ausgabe von 2016 kommt weitgehend zu den erhofften Resultaten, wie die Zusammenfassung auf der entsprechenden Website zeigt:
Die Ergebnisse der breit angelegten, von Juni bis Februar 2016 durchgeführten Umfrage unter der Bieler Bevölkerung zeigen, dass die Zweisprachigkeit in der Seelandstadt acht Jahre nach dem letzten «Barometer» weiterhin positiv bewertet wird. Obwohl die Zweisprachigkeit ein fester Bestandteil der Identität der Bieler‑innen ist und in den Augen der Bevölkerung mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt, sind die Französischsprachigen in diesem Jahr unzufriedener als 2008.6
Es gilt jedoch auch festzuhalten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner trotz der Anerkennung der institutionellen Zweisprachigkeit auf Gemeindeebene durch die Stadtverwaltung als jeweils einsprachig verstanden werden.
[Die] Ausgestaltung der amtlichen Zweisprachigkeit enthält einen inneren Widerspruch. Die Stadt selbst versteht sich als zweisprachig – aber sie betrachtet die Bewohnerinnen und Bewohner nur als einsprachig deutsch oder französisch. Zweisprachige Personen werden von der Stadt immer einer der beiden Sprachgruppen zugeteilt. Individuelle Zweisprachigkeit ist gewissermassen nicht vorgesehen – ausser bei den Angestellten der Stadt, von denen verlangt wird, dass sie mit den Bürgerinnen und Bürgern in beiden Sprachen umgehen können. (Werlen 2010: 13)
Dies wiederum entspricht der Fragestellung nach der Hauptsprache in den Schweizer Volkszählungen bis 2000 (vgl. A.2.0). Gemäss den Ergebnissen dieser Volkszählung von 2000 gelten in Biel denn auch 55,4% als deutschsprachig und 28,1% als französischsprachig, als Hauptsprache von 16,4% gelten weder Deutsch noch Französisch (vgl. Werlen 2010: 12). Die Kompetenzen in der jeweils anderen Sprache (Deutsch oder Französisch) scheinen jedoch gemäss den Untersuchungen des ‹Barometers der Zweisprachigkeit› bei einem grossen Teil der Stadtbevölkerung sehr hoch zu sein7.
Die Strukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik lassen seit 2010 Mehrfachnennungen zu (und stehen für Biel als «grosse Stadt» auch nach Jahr zur Verfügung). Im Jahr unserer hauptsächlichen Datenerhebung in Biel, 2015, nennen 23 792 Deutsch und 15 385 Französisch als Hauptsprache8.
Für den Verwaltungskreis Biel/Bienne sind es 2014-2016 (kumuliert) 62 417 für Deutsch und 26 370 für Französisch, welches in der Stadt also im Verhältnis zu Deutsch häufiger als Hauptsprache genannt wird als im umliegenden Gebiet des Verwaltungskreises.
A.2.4 Aosta (Region Aostatal und Stadt Aosta)
A.2.4.1Sprachgeschichtlicher Überblick
Der Schwerpunkt liegt in diesem kurzen Überblick über die Geschichte der heutigen Autonomen Region Aostatal und der Stadt Aosta auf denjenigen Ereignissen, die einen massgeblichen Einfluss hatten auf die aktuelle Sprachsituation, wie wir sie in A.2.4.2 beschreiben werden. Für eine ausführlichere Darstellung der Geschichte des Aostatals verweisen wir auf den historischen Abriss von Bauer 1999 (5-219), der auch als Grundlage dieser Übersicht dient.
Bereits die Fragen nach der ersten Besiedelung des Aostatals sind für spätere (sprach)politische Diskussionen von Bedeutung. Als erste Bewohner des Aostatals gelten die Salasser. Es wird davon ausgegangen, dass sie im 1. Jahrtausend v.Chr. in die Region einwanderten (Bauer 1999: 6). Unklar ist jedoch ihre Zuordnung:
Der in der Fachwelt ausgetragene Disput, ob die Salasser nun den Ligurern […] oder den Kelten […] zuzuordnen seien, ist insofern delikater Natur, als mit den Argumentationsstrategien beider Seiten fallweise auch ideologisch-nationalistische Hintergedanken verbunden sind. Das Prinzip, von dem vielfach ausgegangen wird, ist unschwer zu durchschauen: Wer nachweisen kann, dass die von der Historiographie dokumentierte sogenannte Urbevölkerung der VDA [Valle d’Aosta=Aostatal] der ihm genehmen Ethnie X angehört, fühlt sich im Recht, kultur- bzw. sprachpolitische Argumentationen des Typs X voranzutreiben und zugleich die gegnerische Ansicht des Typs Y abzulehnen. Für Vegezzi-Ruscalla beispielsweise waren die ersten Valdostaner eindeutig südangebundene Ligurer, ein Grund mehr, die VDA als genuin italienisch einzustufen und alles Französische zu bekämpfen. (Bauer 1999: 7)
Die Romanisierung des Aostatals setzt mit der Gründung der römischen Kolonie Augusta Praetoria Salassorum und ihrer strategisch gelegenen und daher rasch wachsenden Hauptstadt Augusta Praetoria (das heutige Aosta) im Jahr 25 v.Chr. ein (Bauer 1999: 13-17). Nach dem Untergang des weströmischen Reichs im Jahr 476 steht die Region in kurzen Abständen unter verschiedenen Herrschaften.
Die Ausrichtung nach Westen beginnt 575, als das Aostatal Teil des franko-burgundischen Reichs wird (dem es anschliessend während fast drei Jahrhunderten angehört, vor einer wahrscheinlichen Zugehörigkeit zum Burgund) und als sich das Bistum Aosta, bis dahin von Mailand abhängig, in den Einfluss des Bistums Vienne stellt. Die neue Ausrichtung hat auch Einfluss auf die sprachliche Situation:
Damit beginnt definitiv die sprachliche Orientierung hin zur Galloromania (speziell zur heutigen Dauphiné, zu Savoyen und zum Wallis). Pont-Saint-Martin ist, durchaus im Sinn einer Sprachgrenze, wieder Grenzort zur Ebene hin, in der weiterhin die Langobarden herrschen, und wird es solange bleiben, bis die Herzöge von Savoyen in die Poebene vorstossen. (Bauer 1999: 18)
Die Einflüsse der geschichtlichen Ereignisse auf die sprachliche Situation sind, gemäss Bauer, für die geschriebene und für die gesprochene Sprache getrennt zu betrachten. Als gesprochene Sprache wird Frankoprovenzalisch bezeichnet (vgl. Bauer 1999: 20), während Latein weiterhin Schriftsprache bleibt.
Das 11. Jahrhundert wird schliesslich als Beginn der jahrhundertelangen Herrschaft Savoyens im Aostatal verstanden (Bauer 1999: 25), die mit der Charte des franchises von 1191, welche zunächst nur für die Stadt Aosta und erst später für weitere Gebiete gilt, offiziell bestätigt wird.
Innerhalb Savoyens erhält das Aostatal im 16. Jahrhundert eine gewisse Autonomie und mit dem ‹Conseil des Commis› eine regionale Regierung. Diese Epoche der Herrschaft von Herzog Emmanuel-Philibert ist auch für die Sprachsituation von besonderer Bedeutung:
Der Herzog betrieb Sprachpolitik im wahrsten Wortsinn, als er, ähnlich der […] 1539 verordneten ordonnance von Villers-Cotterêts, das Lateinische in den Gerichtsakten offiziell ersetzen liess. Im Piemont schrieb er 1560 Italienisch vor, im Aostatal 1561 Französisch. (Bauer 1999: 39)





























