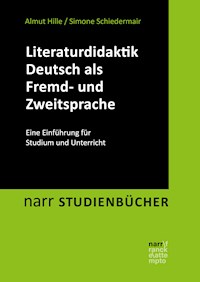
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr Studienbücher LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFT
- Sprache: Deutsch
Die Einführung gibt einen Überblick über die Literaturdidaktik aus der Perspektive des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Sie kann für die universitäre und außeruniversitäre Aus- und Fortbildung sowie zum Selbststudium verwendet werden. Ziel ist es, unterschiedliche Ansätze für die Arbeit mit literarischen Texten auf den Sprachniveaus A1-C2 vorzustellen. Dabei stehen theoretische Grundlagen wie praktische Unterrichtsvorschläge gleichermaßen im Fokus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Almut Hille / Simone Schiedermair
Literaturdidaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Eine Einführung für Studium und Unterricht
© 2021 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2627-0323
ISBN 978-3-8233-8371-0 (Print)
ISBN 978-3-8233-0219-3 (ePub)
Inhalt
Literaturdidaktik in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Konzepte und Perspektiven
„Insofern hat das Poetische den Charakter einer Baustelle. Nicht die geordnete Struktur einer Anstalt, sondern Material, Baugrund, Arbeitskraft in freier Bewegung.“
Alexander Kluge (2020: 44)
In jüngeren Forschungsdebatten zum Fremdsprachenunterricht kommt der Literatur eine zunehmend wichtiger werdende Rolle zu. Nicht zuletzt im neuen Begleitband zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (2020) wird sie als Bereich verstanden, den es in den komplexen Zusammenhängen fremdsprachlichen Lehrens und Lernens zu berücksichtigen gilt.
In den aktuellen Forschungsdebatten von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sind es die literarischen Texte an sich und nicht ihre möglichen Funktionalisierungen für das sprachliche oder kulturelle Lernen, die als Ausgangspunkt dienen. Insofern möchten wir die literarischen Texte – in ihren weiten Fassungen über gedruckte, auditive und audiovisuelle Texte bis hin zu digitalen Texten – in das Zentrum dieses Bandes stellen. Ziel ist es – auf der Grundlage eines weiten Textbegriffs und kulturwissenschaftlich orientierter Forschungen, die Texte in ihrer Verwobenheit in Diskurse lesen, – die Texte in ihrer Spezifik und unterschiedlichen Medialität in das komplexe Bedingungsgefüge unterrichtlichen Geschehens zu integrieren.
Es kristallisiert sich eine Reihe von Aspekten für die Lektüren literarischer Texte in unterrichtlichen Kontexten von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache heraus:
Im Fokus steht die Berücksichtigung von Einzeltexten bei dem gleichzeitigen Bemühen, wo immer möglich, mehrere Texte einzubeziehen, etwa indem man mit Textnetzen arbeitet.
Texte werden verstanden als rezeptiv und produktiv auf gesellschaftliche Diskurse bezogen, und so wären Einblicke in Konstruktionsprozesse und -muster gesellschaftlicher Zusammenhänge und eine fremdsprachliche Diskursfähigkeit als übergreifende Zielsetzungen des Unterrichts zu verstehen.
Es gilt, für (Be-)Deutungsbildungsprozesse und die dazugehörigen Strategien zu sensibilisieren, sprachliche Verfahren wahrzunehmen und in ihren möglichen Wirkungen zu betrachten. Ein solches Vorgehen berücksichtigt die Form literarischer Texte als (be-)deutungsgenerierenden Faktor und macht ihre Literarizität für Verstehensprozesse produktiv.
Die skizzierten Forschungsdiskussionen sind bisher nur in Einzelpublikationen, vor allem in Form von Artikeln in Fachzeitschriften und Sammelbänden nachzuvollziehen. Daneben gibt es Beiträge in allgemeinen Einführungen für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache wie die von Hans-Werner Huneke und Wolfgang Steinig (2013/1997), Heidi Rösch (2011) und Dietmar Rösler (2012) bzw. in Handbüchern und Fachlexika wie den Bänden des Internationalen Handbuchs für Deutsch als Fremdsprache (2001) und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (2010) und dem von Hans Barkowski und Hans-Jürgen Krumm herausgegebenen Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (2010). Als Handbucheinträge sind sie weniger an der Diskussion beteiligt als vielmehr auf die Präsentation von Diskussionspositionen und einzelnen Argumenten gerichtet. Die einzige umfangreichere Einführung zur Lektüre von literarischen Texten in Kontexten von Deutsch als Fremdsprache hat Jürgen Koppensteiner 2001 mit einem Fokus auf kreativen Verfahren vorgelegt; komplett überarbeitet und aktualisiert von Eveline Schwarz ist sie 2012 in einer erweiterten Version erschienen und bietet folglich keinen Einblick in die Diskussionen und das breite Spektrum an literaturdidaktischen Fragestellungen der jüngeren Zeit. Hinweise auf Optionen für das Lesen literarischer Texte in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache finden sich natürlich auch in Lehrwerken und Zusatzmaterialien, die – je nach Ausrichtung an fachwissenschaftlichen Positionen – mehr oder weniger Raum in den Publikationen einnehmen.
Es fehlt jedoch eine konsistente Darstellung literaturdidaktischer Konzeptualisierungen auf der Grundlage neuerer wissenschaftlicher Orientierungen. Diese möchten wir mit diesem Band zur Verfügung stellen und damit auch – durchaus mit einem Blick ‚zurück‘ in Entwicklungen des Faches seit den 1980er Jahren – verschiedene Vorschläge und Ansätze gebündelt präsentieren.
Wir verstehen den Band als Handbuch und Studienbuch für die Aus- und Fortbildung von Studierenden und (zukünftigen) Lehrkräften des Fachs. Bieten möchten wir einen breiten Überblick über
Entwicklungen im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache,
theoretische Ansätze sowie didaktische und methodische Vorgehensweisen,
die Fachgeschichte und die gegenwärtige Forschungsdiskussion.
Daneben werden zahlreiche für den Unterricht geeignete literarische Texte sowie Ideen für ihre Lektüren präsentiert und ausführliche Literaturhinweise gegeben. Textbeispiele sind durch einen grauen Balken am linken Seitenrand hervorgehoben, Unterrichtsideen in graue Kästen eingefasst.
Mit dem Begriff „Literaturdidaktik“ soll keine kanonorientierte Konnotation verbunden sein, die sich auf das Medium des gedruckten belletristischen Buches konzentriert. Wie auch im neuen Begleitband zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (2020: 71f.) empfohlen, spielen neben Romanen – zeitgenössischen und klassischen – auch kurze illustrierte Geschichten, Fotostorys, Comics, Liedtexte und Gedichte, sowohl in analogen wie in digitalen Formaten, in unseren Überlegungen eine Rolle.
Diskutiert werden verschiedene Zugänge zur Literaturdidaktik, die sich jedoch nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen:
Man kann sich der Literaturdidaktik von ihrem Gegenstand her nähern und anhand von literarischen Texten, die im besten Fall begeistern, überlegen, welche Lehr-Lernprozesse sich mit ihnen initiieren lassen.
Man kann Positionen der literaturwissenschaftlichen Diskussion zum Ausgangspunkt nehmen und von dort aus lohnende Texte auswählen und Optionen für Lehr-Lern-Arrangements entwickeln.
Man kann sich von Unterrichtsbeispielen und -modellen inspirieren lassen zu vielfältigen Lektüreoptionen und Vorgehensweisen in unterrichtlichen Kontexten.
Man kann didaktische und methodische Zugänge wählen und an Lehr- und Lernzielen orientiert Texte auswählen, Lektüreprozesse gestalten und auf der Basis von methodischen Prinzipien und Aufgabenformaten literarische Texte in verschiedenen unterrichtlichen Zusammenhängen lesen.
Mit dem Band verbinden wir die folgenden Anliegen:
Wir möchten eine Auseinandersetzung anregen mit grundlegenden Kategorien wie Literatur, Literaturwissenschaft, Literaturdidaktik, Lesedidaktik und Kanon: Teil I mit den Kapiteln 1 bis 4.
Wir möchten einen Überblick geben über die Fachdiskussion zur Literaturdidaktik in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Teil II und III mit den Kapiteln 5 bis 16.
Wir möchten Vorschläge entwickeln zu didaktischen und methodischen Fragen der Unterrichtspraxis, zu Textauswahl, Unterrichtsorganisation, Methoden und Verfahren: Teil IV mit den Kapiteln 17 bis 21.
Wir möchten Literaturhinweise zusammenstellen zu literarischen Texten und einschlägigen wissenschaftlichen Publikationen für die eigene vertiefte Auseinandersetzung.
An diesen Anliegen haben wir uns bei dem Aufbau des Bandes orientiert, sie strukturieren gleichzeitig den Aufbau der einzelnen Kapitel. Den Einstieg in die Kapitel bilden Darstellungen zu jeweils einschlägigen Theorien und Ausführungen dazu, wie diese Theorien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache rezipiert und für die spezifischen Kontexte des Faches adaptiert wurden. Darüber hinaus geben wir Einschätzungen zu ihren Positionen im Fach, zitieren, paraphrasieren oder nennen sowohl affirmative, als auch kritische Stimmen. Es werden Hinweise auf einschlägige Fachliteratur für die weitere Lektüre gegeben; mitunter weisen wir auch in Fußnoten auf zusätzliche Aspekte und Publikationen hin. Im Anschluss werden – in jedem Kapitel mit einem grauen Kasten hevorgehoben bzw. in einen grauen Kasten eingefasst – Beispiele von literarischen Texten und Skizzen möglicher Lektüren gegeben.
Digitalität zieht sich als Querschnittsthema durch die verschiedenen Kapitel des Bandes. Sie ist für veränderte Textformate und sich verändernde Vorstellungen von Medien, von Wissen und Wissensgenerierung wie -speicherung sowie für Lehr- und Lernprozesse in der Gegenwart konstitutiv und wird es in den nächsten Jahren verstärkt sein. Ausführungen zur Digitalität finden sich nicht in einem eigenen Kapitel und auch nicht nur im Kapitel 11 zur Medialität, sondern z. B. mit Blick auf die Vorstellungen von Literatur als solcher (Kap. 1) und auf einen literarischen ‚Kanon‘ (Kap. 3), mit Blick auf die Lesedidaktik (Kap. 4), auf Aspekte von Diskursivität (Kap. 10), auf Unterrichtsgegenstände (Kap. 17), Unterrichtsmethoden (Kap. 19) und Unterrichtsverfahren (Kap. 18, 20, 21).
Konzepte wie Diskursivität (Kap. 10), Medialität und Digitalität (Kap. 11), aber auch Literarizität (Kap. 9) und Performativität (Kap. 12) sind im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in den letzten Jahren zu neuen Leitbegriffen wissenschaftlicher Diskussionen und didaktisch-methodischer Entwicklungen geworden. Sie haben Eingang in erste Unterrichtskonzepte, -modelle und -materialien gefunden. Es gibt aber auch weitere Konzepte und Perspektiven wie Mehrsprachigkeit (Kap. 13), Wissen (Kap. 14), Postkolonialität (Kap. 15) und Gender (Kap. 16), deren Diskussion im Fach erst am Anfang steht. In aller Vorläufigkeit werden sie im vorliegenden Band in einzelnen Kapiteln präsentiert, ergänzt um erste Unterrichtsideen und -materialien.
Wir verstehen die Einführung als einen Zugang zu einem breit gefächerten thematischen Spektrum, die auch darauf ausgerichtet ist, Hinweise zu geben, wie man an verschiedenen Inhalten weiterarbeiten kann.
Insofern haben wir uns entschieden, einen ‚mehrdimensionalen‘ Text zu schreiben, wie er in der Wissenschaft üblich ist, in Einführungen jedoch eher nicht. Er bietet Darstellungen, Kommentare, Originalzitate und Hinweise auf die Fachdiskussion mit bibliografischen Angaben im Fließtext und weiterführenden Informationen in den Fußnoten. So können wir Hinweise geben, woher Argumentationen kommen und wo man Ausführlicheres lesen kann, wenn man über die kurzen Darstellungen hinaus an einem Thema arbeiten möchte. Wir verfolgen mit der Entscheidung für einen ‚mehrdimensionalen‘ Text auch das Anliegen, gerade Studierende von Anfang an mit einer Art von Text vertraut zu machen, die sie in ihrem Studium kennenlernen, verstehen lernen und selbst schreiben lernen sollen. Gleichzeitig ist der Band so gestaltet, dass er auch produktiv zu verwenden ist, wenn man an den wissenschaftlichen Diskussionen weniger interessiert ist und vorrangig Vorschläge zu möglichen Texten und Unterrichtsszenarien sucht.
Theoretische Grundlagen und Konzepte, unterrichtspraktische Vorschläge und literarische Texte sollen Inspirationen geben für die eigenen Arbeitszusammenhänge, seien es Forschungsaktivitäten, akademische Lehre oder Literatur- und Sprachunterricht in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Sicher noch zu klären ist die Verwendung der Bezeichnung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Band. Die Diskussion zu Literatur im Unterricht beginnt Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre in Deutsch als Fremdsprache und ist seit Begründung des Hochschulfaches einer seiner wichtigen Bestandteile mit entsprechenden Publikationen und Lehrangeboten. Wenn wir – besonders in Teil II des Bandes – Konzepte und Publikationen vorstellen, die in diesem Kontext verortet sind, sprechen wir von Deutsch als Fremdsprache. Möchte man aktuell auf diese Konzepte und Vorschläge zurückgreifen, heißt das nicht, dass sie ausschließlich für Deutsch als Fremdsprache geeignet sind. Es ist nur der wissenschaftlichen Präzision geschuldet, frühere Konzepte hier nicht ungenau darzustellen.
Im überwiegend schulischen Kontext von Deutsch als Zweitsprache standen seit den 1990er Jahren vor allem Texte der sogenannten ‚Migrationsliteratur‘ und deren Potenzial für Lehr- und Lernprozesse im Fokus. Die in diesem Forschungs- und Lehrzusammenhang entstandenen Publikationen wurden zunehmend auch in Deutsch als Fremdsprache rezipiert und so lässt sich in der Publikations- und Rezeptionsgeschichte auch der Weg zur inzwischen unstrittigen Fachkonzeption und Fachbezeichnung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache nachvollziehen.
Wenn es also um Publikationen geht, die sich explizit in einem der beiden Bereiche Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache verorten, benutzen wir die jeweilige Bezeichnung Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache. Wenn wir ansonsten über Konzepte sprechen, nutzen wir immer die inzwischen etablierte Fachbezeichnung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Spezifisch für Konzepte und Perspektiven im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist, dass sehr unterschiedliche unterrichtliche Kontexte aufgerufen werden. Der Fokus kann auf dem Literaturunterricht bzw. literaturwissenschaftlichen Seminaren in Studiengängen der internationalen Germanistiken liegen ebenso wie auf dem Lesen von literarischen Texten im Sprachunterricht. Auch im Hinblick auf die institutionellen Kontexte wäre eine große Bandbreite im Blick zu behalten – von vorschulischen Zusammenhängen über Schulen und Universitäten bis hin zur außeruniversitären Erwachsenenbildung in Goethe-Instituten, Sprachschulen und Integrationskursen. Außerdem kann die Zusammensetzung der Lerngruppen sehr unterschiedlich sein. Es können homogene oder heterogene Gruppen von Lernenden sein im Hinblick auf deren L1, auf das Sprachniveau der Einzelnen, deren potenzielle Mehrsprachigkeit sowie deren schulische und ggf. auch universitäre (Lern-)Sozialisation.
Wir danken dem Verlag Narr Francke Attempto für die Initiative zu diesem Band.
Wir danken den vielen Kolleg*innen, mit denen wir seit vielen Jahren über Literatur im Unterricht diskutieren, und die den Bereich der Literaturdidaktik in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache mit ihrer Kenntnis theoretischer Positionen und ihrer Kreativität in der Entwicklung von Lektürevorschlägen und Lehr- und Lernarrangements zu einem – wie wir meinen – überaus faszinierenden und vielfältigen Lehr- und Forschungsbereich entwickelt haben. Wir haben versucht, möglichst viele von ihnen in diesem Band wenigstens zu erwähnen. Vollständigkeit gelingt leider nur selten.
Wichtig ist uns, dass der vorgestellte Lehr- und Forschungsbereich in der Dimension seiner wissenschaftlichen Diskussion wahrgenommen wird, die die eristische Verfasstheit von Wissenschaft, deren diskursive Struktur, Dynamik und Prozesshaftigkeit berücksichtigt. Deshalb kommen verschiedene Positionen zu Wort, ergänzen einander, zustimmend, modifizierend oder durchaus auch kritisch widersprechend.
Wir hoffen, dass wir Wege durch ein weites Terrain vorschlagen können, die es ermöglichen, Konzepte und Perspektiven näher kennenzulernen und für den Unterricht eine begründete Wahl von Texten und Vorgehensweisen zu treffen. Wir möchten zur Arbeit mit literarischen Texten inspirieren, nicht nur in der unterrichtlichen Praxis, sondern auch in Lehre und Forschung.
Wir hoffen, dass damit die Literaturdidaktik in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache als facettenreiches und produktives Feld sichtbar wird – wie wir es in unserer eigenen Arbeit mit Studierenden unserer Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengänge in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, im Rahmen von Fortbildungen, Vorträgen und Gastdozenturen in verschiedenen Ländern mit Lernenden, Studierenden, Lehrenden und Forschenden seit vielen Jahren erleben.
Berlin und Jena, im August 2021 Almut Hille und Simone Schiedermair
ITheoretische Perspektiven
1Was ist Literatur?
„Die geschriebene Literatur hat, historisch gesehen, nur wenige Jahrhunderte lang eine dominierende Rolle gespielt. Die Vorherrschaft des Buches wirkt heute bereits wie eine Episode. Ein unvergleichlich längerer Zeitraum ging ihr voraus, in dem die Literatur mündlich war; nunmehr wird sie vom Zeitalter der elektronischen Medien abgelöst, die ihrer Tendenz nach wiederum einen jeden zum Sprechen bringen.“
Hans Magnus Enzensberger (1970: 125)
Angesichts dieser Einschätzung von geschriebener Literatur als einer „Episode“ der literarischen Kommunikation wäre eingangs zu fragen: Was ist eigentlich Literatur?
Abgeleitet wird der Begriff „Literatur“ von den lateinischen Termini „littera“ (Buchstabe) bzw. „litteratura“ (Buchstabenschrift). Er umfasst zunächst alles, was in geschriebener oder gedruckter Form vorliegt. Man kann dafür auch den Begriff „Text“ verwenden. Texte – auch literarische Texte – können aber nicht nur in geschriebener oder gedruckter, sondern auch in bildlicher oder in mündlicher Form vorliegen bzw. vorgetragen werden. Mit der Digitalisierung haben sich zudem neue Möglichkeiten der Speicherung von geschriebenen, bildlichen wie auch mündlich präsentierten Texten entwickelt.
Im Unterschied zu dieser sehr allgemeinen Bestimmung von „Literatur“ assoziiert man mit dem alltagssprachlichen Begriff der Literatur in der Regel eine Subkategorie von Texten, die sogenannte „schöne Literatur“ oder „Belletristik“. Wie Ralf Klausnitzer in seinem Studienbuch Literaturwissenschaft (2012) darlegt, wird sie besonders in ihrer Differenz zu anderen Texten, etwa Sach- und Informationstexten, fassbar:
Literarische Texte
wollen nicht (primär) informieren, sondern „unterhalten und faszinieren“, indem sie „intensiv und dauerhaft“ die „Einbildungskraft“ ihrer Leser*innen „mobilisieren“.
vermitteln keine „kodifizierten oder formalisierbaren Erkenntnisse“, sondern Einsichten in individuelle oder kollektive Problemlagen und -verarbeitungen.
„geben keine Handlungsanweisungen für reale Situationen“, sondern ermöglichen ihren Leser*innen ein „symbolisches Probehandeln in imaginierten Welten“; gleichzeitig gibt es auch literarische Texte, die keine fiktiven Welten imaginieren, sondern Darstellungen von ‚Wirklichkeit‘ erproben wie etwa Autobiografien, Memoiren, Reiseberichte und Reportagen.
„befreien durch eine irritierende Sprache die Wahrnehmung ihrer Leser*innen von Automatismen“ (vgl. Klausnitzer 2012: 15, Hervorh. i.O.).
In dieser Differenzierung sind Dimensionen eines möglichen Begriffs von Literatur angedeutet, die für die Literaturdidaktik fruchtbar zu machen sind. Sie beziehen sich – bei aller Schwierigkeit, diese tatsächlich klar zu bestimmen – erstens auf Charakteristika und zweitens auf Funktionen als mögliche Kriterien der Bestimmung eines Begriffs von Literatur. Einer möglichen Bestimmung dieses Begriffs kann man sich drittens auch von der Kommunikationssituation und viertens von dem umfassenderen Begriff des Erzählens aus nähern.
Zunächst zu den möglichen Charakteristika von Literatur: Poetizität und Verfremdung, Mehrdeutigkeiten und Unbestimmtheiten, Fiktionalität sowie Diskursivität. Frühe Bestimmungen der Poetizität stammen von Viktor Šklovskij und Roman Jakobson, die ihre Überlegungen im Kontext des russischen Formalismus bzw. des Prager Strukturalismus entwickelt haben. In ihren grundlegenden Aufsätzen Die Kunst als Verfahren (Šklovskij1994/1969/russ.1916) und Linguistik und Poetik (Jakobson 2005/1971/engl. 1960) untersuchen sie die Darstellungsstrategien literarischer Texte. Die fachwissenschaftliche Diskussion zur Rolle von literarischen Texten in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache hat von Anfang an auf diese beiden Konzepte Bezug genommen1 und lässt sich bis heute von ihnen inspirieren.2
Die besondere sprachliche Gestaltung von literarischen Texten wäre nach Roman Jakobson mit dem Begriff der „Poetizität“ zu fassen und steht in engem Zusammenhang mit der poetischen Funktion von Sprache.3 Diese realisiert sich in der besonderen und dadurch auffallenden Verwendung von sprachlichen Zeichen, durch die eine Differenz zur Alltagssprache mit ihren Gewohnheiten und Automatismen des Lesens, Hörens, Schreibens, Sprechens und Sehens entsteht.
Ein wichtiges Prinzip der Realisierung der poetischen Funktion von Sprache ist die Abweichung von sprachlichen Regeln oder Normen. So werden z. B. ungewöhnliche, überraschende Klang- oder Wortfiguren und Tropen in (literarischen) Texten verwendet: Alliterationen, Metaphern oder ironische Rede (→ Kap. 9). Durch ein sprachliches Experimentieren bei der Produktion von Texten können grammatische Regeln verletzt werden oder auch typografische Regeln beim Druck von Texten; man denke etwa an die Visuelle oder Konkrete Poesie. Mit diesen Strategien wird die Aufmerksamkeit der Lesenden auf die konkrete sprachliche Verfasstheit der Texte gelenkt; das Wie, d.h. die Form der Texte und deren Beitrag zur Bedeutungsbildung gerät so in den Fokus. Jakobson spricht davon, dass die poetische Funktion die „Einstellung auf die BOTSCHAFT als solche“ (Jakobson 2005: 92, Hervorh. i.O.) bewirkt. So stellen etwa Äquivalenzen auf der Klangebene wie Reime und Alliterationen sowie Wiederholungen Strategien dar, um Aufmerksamkeit zu erreichen (vgl. ebd.: 93). Aber auch die „grammatische Architektonik“ (Jakobson 2007: 691), die Häufigkeit und Verteilung von Satzarten und Wortarten sowie lexikalische und syntaktische Auffälligkeiten können solche Strategien sein, wie Jakobson an dem Gedicht Wir sind sie (1931) von Bertolt Brecht zeigt. So analysiert er beispielsweise, wie über die Verwendung einer „Kette identischer Diphthonge“ (Jakobson 2007: 707) verschiedene Ausdrücke in dem Gedicht „verbunden“ sind – „ei“ etwa in „Partei“, „in einem“, „geheim“ (ebd., Hervorh. i.O.) u.a. – und so über klangliche Wiederholung eine semantische Netzstruktur geschaffen wird, mit der Entfremdung und Verbindung des Einzelnen zur Partei kommentiert werden.
Mit der poetischen Funktion meint Jakobson die Möglichkeiten der Sprache, auf sich selbst hinzuweisen, bzw. die Möglichkeiten von Texten – und insbesondere literarischen Texten –, ihre eigene sprachliche Verfasstheit auszustellen. Sie fasst den Selbstbezug der Sprache, eine Dominanz der Form über den Inhalt. Mit der poetischen Gestaltung von Sprache wird die Aufmerksamkeit auf die Form, auf die Beschaffenheit der Sprache selbst gelenkt – „und zwar so weit, dass der ‚Inhalt‘ der Mitteilung selbst in den Hintergrund gedrängt wird und wir der Sprache bei der Arbeit der Erzeugung von ‚Wirklichkeit‘ (die ja stets sprachlich vermittelt ist) förmlich zusehen können“ (Klausnitzer 2012: 45f.). Der Selbstbezug der poetischen Sprache stellt eine Differenz zur situations- und zweckgebundenen, zielgerichteten Sprache von Informations- und Sachtexten (z. B. Berichte, Gebrauchsanweisungen u. ä.) her.
Alltagssprache, aber auch eine bereits etablierte literarische Formensprache können auf diese Weise verfremdet werden. Durch die Verfremdung werden die Leser*innen irritiert und ihre Aufmerksamkeit auf gewohnte Wahrnehmungsmuster sowie deren Veränderungen gelenkt. Mit Viktor Šklovskij wäre auch von einer Deautomatisierung der Wahrnehmung zu sprechen. Die Begriffe „Verfremdung“ und „Deautomatisierung“ entwickelt Šklovskij in seinem bereits oben genannten Aufsatz Die Kunst als Verfahren. Er argumentiert, dass Automatisierung Wahrnehmung verhindere: „Automatisierung frißt die Dinge“, das können „die Kleidung, die Möbel“ sein, aber auch der „Schrecken des Krieges“ (Šklovskij 1994: 15). Aufgabe der Kunst sei es, dies zu verhindern und durch Verfremdung die Dinge wieder sichtbar zu machen – „den Stein steinern zu machen“ (Šklovskij 1994: 15). Sowohl das Wahrnehmbare als auch der Akt des Wahrnehmens sollen in den Fokus gerückt werden:
Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen und nicht als Wiedererkennen; das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der ‚Verfremdung‘ der Dinge und das Verfahren der erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge der Wahrnehmung steigert, denn der Wahrnehmungsprozeß ist in der Kunst Selbstzweck und muß verlängert werden; die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben […]. (Šklovskij 1994: 15)
Zu betonen wäre, dass Elemente einer Poetizität (wie es bei Jakobson heißt) oder Literarizität (wie es in der gegenwärtigen fachwissenschaftlichen Diskussion heißt) von Sprache grundsätzlich in allen Texten und allen Formen der Rede auftreten können. Von geradezu konstitutiver Bedeutung sind sie aber für die meisten literarischen Texte.
Die Aufmerksamkeit für die Form bzw. für die Beschaffenheit von Sprache rückt auch die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Zeichen und Bedeutungen in den Blick. In der Terminologie von Ferdinand de Saussure (1967: 76ff., 135–143) ist die materiale Gestalt eines Zeichens als Signifikant zu bezeichnen, dessen Wahrnehmung ein komplexer Prozess ist: Leser*innen (Betrachter*innen oder Hörer*innen)4 identifizieren ein Zeichen – einen Buchstaben, eine Buchstabenfolge, ein grafisches Symbol oder einen Wortklang – und ordnen ihm (mögliche) Bedeutungen zu. Diese Bedeutungen bilden den ideellen Gehalt eines Zeichens, der als Signifikat bezeichnet wird. Prozesse der Zuordnung von Signifikat(en) zu Signifikant(en) erfolgen mental, d.h. im Bewusstsein der Leser*innen und beruhen auf Zuordnungsregeln, die gesellschaftlichen oder kulturellen Konventionen, auch den Konventionen gesellschaftlicher Subsysteme wie verschiedenen Wissenskulturen oder Gruppierungen z. B. von Jugendlichen entsprechen können. Die vielfältigen möglichen Bedeutungen von Signifikanten sind als Konnotationen zu bezeichnen. Das Spiel mit möglichen Konnotationen erzeugt in (literarischen) Texten Unbestimmtheiten und Mehrdeutigkeiten (vgl. Klausnitzer 2012: 20f., 46f.), während Sach- und Informationstexte gerade Eindeutigkeit herzustellen suchen. Mehrdeutigkeiten und Unbestimmtheiten gelten neben Verfremdung und Poetizität als weitere mögliche Charakteristika von literarischen Texten. In der fachwissenschaftlichen Diskussion in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache werden Unbestimmtheiten und Mehrdeutigkeiten auch auf der Ebene der Semantik einzelner sprachlicher Ausdrücke berücksichtigt, wie soeben mit Rückgriff auf die Saussure’sche Unterscheidung von Signifikant und Signifikat dargestellt. Darüber hinaus werden sie auf der Basis rezeptions- und wirkungsästhetischer Theoriebildung (→ Kap. 8, 20) verstanden. Diese geht von der Grundannahme aus, dass das literarische Werk im jeweils individuellen Lektüreprozess als Zusammenspiel zwischen dem Text und seinen Lesenden entsteht. Dabei ist die Beobachtung von zentraler Bedeutung, dass literarische Texte – im Gegensatz zu nicht-literarischen Texten – Unbestimmtheitsstellen aufweisen. Je nach „Füllung“ oder „Normalisierung“ dieser Unbestimmtheitsstellen oder Leerstellen kommt es zu unterschiedlichen Lesarten. So sind „Leerstellen eines literarischen Textes“ nicht als „Manko“ zu verstehen, denn sie „bilden einen elementaren Ansatzpunkt für seine Wirkung“ (Iser 1974/1970: 15). Damit sind die Unbestimmtheitsstellen Beteiligungsangebote für die Lesenden und zugleich Angebote für individuelle Lesarten. Diese Bestimmung wurde und wird in der Literaturdidaktik als Grundlage für verschiedene Konzepte genutzt, etwa für das Konzept eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts, das allerdings in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten ist (→ Kap. 20).
Ein weiteres mögliches Charakteristikum von Literatur ist das der Fiktionalität. In der Alltagsauffassung gelten fiktionale Texte „als solche Texte, die Erfundenes darstellen oder erzählen“ (Jannidis/Lauer/Winko 2009: 19); als eine Variante gilt die Autofiktion, die Autobiografisches und fiktionale Handlungsebenen verbindet und insbesondere in Texten der Gegenwartsliteratur eine wichtige Rolle spielt. In der Literaturwissenschaft wird der fiktionale Status literarischer Texte umfassend und heterogen diskutiert. Im Fokus der Debatten stehen die Fragen nach dem ‚Wesen‘ oder Status von Fiktionalität, nach Fiktionalitätssignalen in Texten sowie nach dem Verhältnis von Fiktionalität und Realität und/oder Wahrheit (vgl. Jannidis/Lauer/Winko 2009: 17).
Weiterhin wird Diskursivität (→ Kap. 10) als ein mögliches Charakteristikum von Literatur verstanden. In aktuellen Diskussionen in der Literaturwissenschaft und im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wird das Verhältnis von literarischen Texten zu gesellschaftlichen Zusammenhängen und kulturellen Mustern im Modus der Diskursivität gedacht. Damit verbindet sich die Vorstellung, dass Literatur Diskurse nicht nur aufnimmt, sondern an ihnen partizipiert, sie mitgestaltet. Literatur ist gekennzeichnet durch „diskursive Mehrfachzugehörigkeiten“ (Hille 2017: 17), nimmt an verschiedenen Diskursen teil, in flexibler und dynamischer, rezeptiver und produktiver Bezogenheit auf diese. Sie nimmt in komplexer Weise Bezug auf vielfältige Diskurszusammenhänge. Aus dieser spezifischen Relation ergibt sich ein kritisches Potenzial für literarische Texte als Orte der Aushandlung und Reflexion von gesellschaftlichen Diskursen.
Als weitere Gruppe von Kriterien zur Bestimmung eines Begriffs von Literatur gelten deren mögliche Funktionen im Kontext literarischer Kommunikation: die Beobachtungsfunktion, Orientierungsfunktion, Simulationsfunktion, Utopiefunktion, Speicherfunktion, Bildungsfunktion und Unterhaltungsfunktion. Funktionen werden hier mit Jannidis/Lauer/Winko (2009: 22) als Relationen zwischen „Gegenständen (mit potenziellen Eigenschaften), ihren Wirkungen (im Falle einer Realisierung dieser Eigenschaften) und einer Bezugsgröße (Individuum, Kollektiv, u.a.)“ aufgefasst. Funktionen sind als Potenziale vorstellbar, in jeweils unterschiedlichen Bedingungszusammenhängen mögliche Wirkungen hervorzubringen (vgl. ebd.).
Als literaturdidaktisch bedeutsam wären die folgenden möglichen Funktionen literarischer Texte zu betrachten:
Beobachtungsfunktion
Sasha Marianna Salzmann verweist darauf, dass in der Literatur, in der Kunst allgemein „sehr wichtige Beobachtungen gemacht werden für eine Welt, die nach uns kommt“.5 Literarische Texte, die seit jeher als „ausgezeichnete Form der Selbstbeobachtung von Gesellschaften“ (Böhme 1998: 482) gelten, speichern Beobachtungen von gesellschaftlicher Komplexität sowie von kollektiven und individuellen Problemlagen und -verarbeitungen. Dabei eröffnen sie auch „abweichende Beobachtungen vertrauter und eingespielter Sachverhalte“, erzeugen auf diese Weise „Dissidenz“ (Hörisch/Klinkert 2006: 10).
Orientierungsfunktion
Durch die poetische Gestaltung können literarische Texte das (gesellschaftlich) Beobachtete in fassbare Symbole, Bilder und Narrationen überführen und es in diesen verdichten. Gerade in unseren heutigen Gesellschaften scheint das Verdeutlichen bzw. das kommentierende und differenzierende Reflektieren von Komplexität, Pluralität und Mehrdeutigkeit zunehmend eine Funktion von Literatur, von Kunst überhaupt zu sein. Sie kann Orientierung bieten und das gerade nicht, indem sie – wie einige Formen der Alltags- und Mediensprache – einfache, die Komplexität der Welt reduzierende ‚Wahrheiten‘ zu propagieren versucht.
Simulationsfunktion
Gerade in der Abweichung und Dissidenz ermöglichen literarische Texte ihren Leser*innen Simulationen anderer möglicher Welten und des Handelns in ihnen. Bei der Lektüre literarischer Texte sind Leser*innen von den pragmatischen Regeln der Wirklichkeit und den Grenzen ihrer eigenen Existenz befreit. Sie können das Mögliche über das Reale hinaus denken und es von literarischen Figuren erproben lassen. Man spricht auch von einem für die Leser*innen möglichen „symbolische[n] Probehandeln in imaginierten Welten“ (Klausnitzer 2012: 15, Hervorh. i.O.).
Utopiefunktion
Zukünftige andere Welten können literarische Texte als Utopien (und natürlich auch Dystopien) inszenieren. Sie können Zukunftsnarrative und -bilder entwerfen, die neben der Zukunft auch die Gegenwart und die Vergangenheit erfahrbar, verständlich und gestaltbar oder auch verstörend und zerstörerisch erscheinen lassen.
Speicherfunktion
Literarische Texte entstehen in gesellschaftlichen Zusammenhängen und beziehen sich in je spezifischen Bedingungsgefügen auf das kollektive Wissen ihrer Zeit, das individuelle Wissen der Autor*innen und der Leser*innen. Sie speichern gesellschaftliche Positionen, verdichten sie und spitzen sie zu. Dieses Wissen findet sich – wenn auch nicht in Form von Abbildung, sondern von „Verhandlungen“ (Heitmann 1999: 10) bzw. „negotiations“ (Greenblatt 1988) – in Texten. Im literaturdidaktischen Kontext ermöglicht es die Perspektive der Speicherfunktion, „sozusagen das Mikroskop auf das aus Diskursfäden gesponnene dichte Gewebe der Kultur bzw. Geschichte zu richten und einzelne Fäden daraus zu verfolgen, um jeweils ein Stück Komplexität, Unordnung, Polyphonie, Alogik und Vitalität der Geschichte zu rekonstruieren“ (Baßler 1995: 15). Jochen Hörisch (2007: 13f.) vertraut darauf, „daß sich das im Medium der schönen Literatur angesiedelte Wissen mit argumentativem Gewinn rekonstruieren lässt.“ Astrid Erll (2011: 2) verweist im Kontext einer kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung u.a. auf literarische Texte als Orte „kultureller Erinnerung“. Auch in dieser Hinsicht ist ihre Speicher- bzw. Archivierungsfunktion von Relevanz.
Bildungsfunktion
Literarische Texte beobachten – das ist bereits ausgeführt worden – gesellschaftliche Komplexität sowie kollektive und individuelle Problemlagen, sie speichern und verdichten gesellschaftliche und individuelle Positionen, sie inszenieren Werte und Normen von Gesellschaften bzw. Gruppen und deren Wirkungen auf Individuen. Die Lektüren literarischer Texte initiieren „Prozesse des Verstehens von Selbst und Welt“, sie gelten als „Sinn-/Bildungsprozesse“ (Decke-Cornill/Gebhard 2007: 10). In den „bildende[n] Begegnungen mit der Welt“ (ebd.: 11) können Lesende Impulse für die eigene Persönlichkeits- und Identitäts- bzw. Zugehörigkeitsentwicklung finden.
Unterhaltungsfunktion
Nicht zu vergessen: Literarische Texte wollen nicht (primär) orientieren oder bilden, sondern unterhalten und unsere Einbildungskraft mobilisieren. Gerade deshalb werden sie – egal in welcher medialen Form – von vielen gelesen, gesehen oder gehört. Literarische Texte können dabei emotionale Wirkungen, spontane Reaktionen, (ästhetische) Urteile und weite Imaginationen der Leser*innen hervorrufen.
Zu betonen wäre hier aber noch einmal, dass Literatur wie auch Kunst an sich keine Funktion(en) hat. Das Konzept der Autonomie der Literatur bzw. Kunst, ihrer Selbstbedeutsamkeit und Selbstwirksamkeit, spricht gegen diese Annahme. Mögliche Funktionen gewinnen Literatur und Kunst erst in der literarischen bzw. ästhetischen Kommunikation.
Rückt man die Pragmatik bzw. Kommunikationssituation in den Fokus, wird eine weitere Annäherung an eine Bestimmung des Begriffs „Literatur“ möglich. So wird auch das Verhältnis von Text und Kontext bedeutsam. Jannidis/Lauer/Winko verweisen in ihrem Band Grenzen der Literatur. Zu Begriff und Phänomen des Literarischen (2009) darauf, dass gerade in der Diskussion um moderne Kunst der Kontext hohe Relevanz erlangt, „wenn etwa beim ready-made Alltagsobjekte in einen Kontext gestellt werden, der diese – ohne Veränderung an den Gegenständen selbst – zu Kunstobjekten macht“ (ebd.: 30, Herv. i. O.). Hier wird deutlich, dass der Begriff der Kunst bzw. der Literatur nicht aus den materialen Eigenschaften von Objekten abgeleitet werden kann. Texte können nur in Kontexten ‚verstanden‘ werden, wobei der Text einerseits als Zeichenkörper, andererseits als das Verstandene – „das mentale Gebilde, das das Ergebnis eines komplexen Verstehensvorgangs ist“ – gefasst wird:
Der Vorgang des Verstehens ist nicht nur von material vorgegebenen Zeichen und etwaigen generellen Codes abhängig […], sondern ebenso vom […] Kontext, zu dem allgemein Weltwissen und […] Wissen über die Textsorte, das Vorwissen über die spezifischen Gebrauchsregeln in diesem Zeichensystem, denen alle an der Kommunikation Beteiligten unterliegen, und allgemeinere Annahmen über die Funktion eines Textes in dem jeweiligen Kontext gehören. (Jannidis/Lauer/Winko 2009: 30)
Textbeispiel
Ein oft zitiertes Beispiel ist das 1969 in dem Band Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt erschienene Gedicht von Peter Handke:
Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg
vom 27.1.1968
WABRA
LEUPOLD POPP
LUDWIG MÜLLER WENAUER BLANKENBURG
STAREK STREHL BRUNGS HEINZ MÜLLER VOLKERT
Spielbeginn:
15 Uhr
Handke arbeitet hier mit einem ready-made. Er übernimmt die Namen der Fußballspieler in der Form, wie sie in Sportzeitschriften abgedruckt werden, in seinen Band, kontextualisiert sie damit neu und weist in dieser Weise darauf hin, dass Texte auch durch Kommunikationszusammenhänge, in denen sie erscheinen, zu literarischen Texten werden.6 Ähnlich funktionieren die Kassenbongedichte von Susann Körner (→ Kap. 6), bei denen ebenfalls die alltagspragmatische Form unverändert in einen Band mit literarischen Texten – hier in einen Gedichtband – aufgenommen wird.
Einer möglichen Bestimmung des Literaturbegriffs kann man sich auch von dem umfassenderen Begriff des Erzählens her nähern. Die Narratologie, die sich mit dem (literarischen) Erzählen beschäftigt, hat in der literaturwissenschaftlichen Diskussion der letzten Jahre sehr an Bedeutung gewonnen. Albrecht Koschorke spricht in seinem Band Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie (2012) vom Menschen als „homo narrans“ und damit vom Erzählen als anthropologischer Grundausstattung (ebd.: 10, Hervorh. i.O.). Was er damit meint, verdeutlicht er mit einem Zitat aus Roland Barthes’ Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen (1988/frz. 1966):
Die Menge der Erzählungen ist unüberschaubar. Da ist zunächst eine erstaunliche Vielfalt von Gattungen, die wieder auf verschiedene Substanzen verteilt sind, als ob dem Menschen jedes Material geeignet erschiene, ihm seine Erzählungen anzuvertrauen: Träger der Erzählung kann die gegliederte, mündliche oder geschriebene Sprache sein, das stehende oder bewegte Bild, die Geste oder das geordnete Zusammenspiel all dieser Substanzen; man findet sie im Mythos, in der Legende, der Fabel, dem Märchen, der Novelle, dem Epos, der Geschichte, der Tragödie, dem Drama, der Komödie, der Pantomime, dem gemalten Bild (man denke an die Heilige Ursula von Carpaccio), der Glasmalerei, dem Film, den Comics, im Lokalteil der Zeitungen und im Gespräch. Außerdem findet man die Erzählung in diesen nahezu unendlichen Formen zu allen Zeiten, an allen Orten und in allen Gesellschaften; die Erzählung beginnt mit der Geschichte der Menschheit; nirgends gibt und gab es jemals ein Volk ohne Erzählung; alle Klassen, alle menschlichen Gruppen besitzen ihre Erzählungen, und häufig werden diese Erzählungen von Menschen unterschiedlicher, ja sogar entgegengesetzter Kultur gemeinsam geschätzt: Die Erzählung schert sich nicht um gute oder schlechte Literatur: sie ist international, transhistorisch, transkulturell, und damit einfach da, so wie das Leben. (Barthes 1988: 102, Hervorh. i.O.)
Hier wird die anthropologische Bedeutung des Erzählens deutlich: Es dient als Medium individueller wie kollektiver Selbstverständigungsprozesse. Vorstellungen von individuellem Leben und sozialem Zusammenleben, Problemlagen und Problembehandlungen, Denkmodelle und Konzeptualisierungen von Welt finden im Erzählen ihre sprachliche Form, werden damit zugänglich und verhandelbar. Auf dieser erzähltheoretischen bzw. narratologischen Basis kann man den literarischen Text als prominentes Medium des Erzählens verstehen. Literarische Texte erhalten einen spezifischen Stellenwert und sind nicht eine Textart unter vielen.
Für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ermöglicht die Arbeit mit literarischen Texten aus der Perspektive des Erzählens eine Auseinandersetzung mit individuellen wie kollektiven Reflexionsprozessen (vgl. Schiedermair 2014b, Riedner 2017). Wie sich in dem obigen Zitat schon andeutet, wird dabei ein weiter Textbegriff zugrunde gelegt, der z. B. auch Hörspiele, Filme, Video- und Werbeclips umfasst (→ Kap. 11). Der so entwickelte Begriff von Literatur ermöglicht es, eine große Vielfalt an medialen Formaten zu berücksichtigen.
In der Gegenwart sind es weitere, neue Textformate, die unsere Vorstellungen von Literatur herausfordern. Diese besteht schon lange nicht (mehr) nur aus gedruckten und gebundenen Werken einzelner Autor*innen, die von einzelnen Leser*innen still rezipiert werden.
Poetry Slams etwa können an einem Abend ein großes Publikum erreichen; die Texte werden nicht nur von Einzelnen, sondern auch von Teams verfasst und performt. Mit dem Erfolg von Poetry Slams sind die Mündlichkeit der Literatur, ihr Ereignischarakter und ihre Offenheit für alle Akteur*innen (wieder) in das Blickfeld gerückt.
Die digitale Literatur steht dafür, dass die Grenzen zwischen Autor- und Leserschaft wie auch zwischen „Fiktion und inszenierter Wirklichkeit“ verschwimmen (Winko 2016: 6). Der Begriff der digitalen Literatur bzw. Netzliteratur, Internetliteratur, New Media Literature oder Hyperfiction ist jedoch zu schärfen. Sie ist zunächst von einer digitalisierten Literatur (E-Books, Bibliotheken wie das Projekt Gutenberg) zu unterscheiden. Deren Lektüre erfolgt am Computer oder einem anderen (mobilen) Endgerät; verändert ist so vor allen Dingen die Rezeption von Texten (→ Kap. 4, 5). Als digitale Literatur hingegen werden Texte bezeichnet, deren Produktion und Rezeption am Computer erfolgt und die im digitalen Format, als zweifacher Text entstehen: dem auf dem Bildschirm sicht- und lesbaren Text und dem ihn bedingenden digitalen Code hinter der Oberfläche (vgl. Winko 2016: 4). Diese Texte sind oder erscheinen in einem weiten Sinn interaktiv: Die Lesenden wählen individuelle Lektürepfade, können z. B. Hyperlinks folgen oder eigene Texte eingeben (vgl. ebd.: 4). Insofern werden z. B. Texte im Hypertextformat (→ Kap. 11) auch als nichtlinear bezeichnet. Auch Netzliteratur ist digitale Literatur, spezifisch aber noch einmal dadurch charakterisiert, dass sie „des Internets bedarf, um produziert und rezipiert zu werden“ (ebd.: 5). Sie wird im Internet publiziert und kann, etwa in Form von Schreibforen, Mitschreibprojekten oder literarischen Blogs konzipiert, nicht nur zur Rezeption, sondern auch zur Produktion von Texten durch die Leser*innen anregen (→ Kap. 5). So entstehen beispielsweise Blogromane, aber auch Texte einer sogenannten Fanfiction.
Fragt man also, was Literatur heute – bei aller Schwierigkeit der Definition – sein kann, so stellt sie sich als „ein extrem vielfältiges, dynamisches Ensemble unterschiedlicher medialer Formate und Kommunikationsformen, eine lebendige Praktik, die weit über gedruckte Einzelwerke und vom Feuilleton wahrgenommene Autoren hinausgeht“, und als Teil wie auch Instrument gesellschaftlicher und kultureller Partizipation (ebd.: 2) dar.
Diese Überlegungen führen zu dem zurück, was schon Friedrich Schlegel 1798 in der Zeitschrift Athenäum über Literatur formulierte:
Eine Definition der Poesie kann nur bestimmen, was sie seyn soll, nicht was sie in der Wirklichkeit war und ist; sonst würde sie am kürzesten so lauten: Poesie ist, was man zu irgend einer Zeit, an irgend einem Orte so genannt hat. (Schlegel 1983: 204)
2Literaturdidaktik – Literaturwissenschaft
Blickt man auf die Publikationen im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, fällt auf, dass sich der Begriff „Literaturdidaktik“ überraschend selten findet. Meist werden andere Formulierungen gewählt. So haben die thematisch einschlägigen Bände, die seit dem Jahr 2000 erschienen sind, Titel wie Literatur im DaF-Unterricht (Koppensteiner 2001), Literatur im DaF/DaZ-Unterricht (Koppensteiner/Schwarz 2012), Deutsch als Fremdsprache und Literaturwissenschaft (Ewert/Riedner/Schiedermair 2011a), Literatur in Deutsch als Fremdsprache und internationaler Germanistik (Altmayer/Dobstadt/Riedner/Schier 2014), Ästhetisches Lernen im DaF/DaZ-Unterricht. Literatur – Theater – Bildende Kunst – Musik – Film (Bernstein/Lerchner 2014), Aktuelle deutschsprachige Literatur für die Internationale Germanistik und das Fach Deutsch als Fremdsprache (Hille/Jambon/Meyer 2015) und Literaturvermittlung (Schiedermair 2017a). Ähnliche Titel wurden für die Themenhefte der Fachzeitschriften zu diesem Schwerpunkt gewählt, etwa Literatur im Anfängerunterricht (Fremdsprache Deutsch 2/1994), Fremdsprache Literatur (Fremdsprache Deutsch 44/2011), Literatur in sprach- und kulturbezogenen Lehr- und Lernprozessen im Kontext von DaF/DaZ (Deutsch als Fremdsprache 2014/ Heft 1–4, 2015/ Heft 1–3). Auch die zentralen Artikel im internationalen Handbuch Deutsch als Fremdsprache (2001) bzw. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (2010) formulieren ihre Titel, ohne den Begriff „Literaturdidaktik“ zu verwenden: Literarische Texte im Deutschunterricht (Ehlers 2001), Literatur, Kultur, Leser und Fremde – Theoriebildung und Literaturvermittlung im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Riedner 2010a).
In den Fachdidaktiken der Germanistik – Deutsch als L1 in Schulen der D-A-CH-L-Länder – und der Fremdsprachenphilologien wie Anglistik und Romanistik ist dagegen selbstverständlich von „Literaturdidaktik“ die Rede. So scheint der Begriff den schulischen Kontext zu implizieren, was auch die Definitionen der „Literaturdidaktik“, die sich in den einschlägigen fachdidaktischen Einführungen finden, nahelegen. So heißt es etwa bei Ehlers (2016: 13): „Literaturdidaktik ist die Wissenschaft vom Lehren und Lernen von Literatur und literarischen Erzählmedien im institutionellen Rahmen von Schule, die Literatur und Erzählmedien unter dem Aspekt ihres Bildungswertes für Schüler und ihrer Lehr- und Lesbarkeit betrachtet.“ Leubner/Saupe/Richter (2016: 13) fassen den Begriff zunächst weiter als „Wissenschaft vom Lehren und Lernen der Literatur“, weisen in einem zweiten Schritt dann aber ebenfalls darauf hin, dass die „entsprechenden Prozesse […] vor allem im Literaturunterricht im Rahmen des Deutsch- und Fremdsprachenunterrichts“ stattfinden.
Diese Implikationen werden jedoch zunehmend durchbrochen und der Begriff „Literaturdidaktik“ erhält ein über den schulischen Kontext hinausgehendes Verwendungspotenzial, was sich etwa an Buchtiteln wie Öffentliche Literaturdidaktik zeigt. In der Einleitung zu diesem 2018 von ihnen herausgegebenen Band argumentieren Christine Ott und Dieter Wrobel gegen die „Engführung des Begriffs und Konzepts“ auf den schulischen Kontext und für ein Aufsuchen „applikationsfähige[r] Schnittstellen zu einer öffentlichen Literaturdidaktik“ (Ott/Wrobel 2018: 7). Ihr Ziel ist es, Literaturdidaktik als wissenschaftlichen Diskussionszusammenhang nicht auf Fragen des schulischen Lernens zu begrenzen, sondern auch auf die Arbeit mit Literatur in unterschiedlichen außerschulischen Bereichen auszuweiten.
Bei der Wahl des Titels für diesen Einführungsband haben wir uns entschieden, den Begriff der „Literaturdidaktik“ zu verwenden. Dabei ist uns bewusst, dass wir damit eine Formulierung wählen, die man in der Fachdiskussion von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache bisher wenig genutzt hat. Mit anderen Formulierungen (s.o.) konnte man die spezifische Situation des Faches, das sich nur zum Teil als Fachdidaktik im schulischen Kontext verortet, berücksichtigen (siehe zu DaZ in der Schule Rösch 1992, 2001, 2017 und Ehlers 2008, 2014, 2016: 56–63). Anders als in den Fachdidaktiken sind die Fachdiskussionen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache weniger auf vorgegebene, in den Anforderungen an Curricula und Testformate bis zu einem gewissen Grad homogene und miteinander vergleichbare institutionelle Zusammenhänge ausgerichtet und auch weniger an standardisierten Vorgaben orientiert wie etwa den Bildungsstandards, die in der Folge des sogenannten PISA-Schocks (→ Kap. 4) für die Fachdidaktiken ausgearbeitet wurden. Einen mit den Bildungsstandards vergleichbaren Rahmen stellt für den fremd- und zweitsprachlichen Deutschunterricht zwar der vom Europarat herausgegebene Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) dar. Dieser berücksichtigt jedoch in seiner ersten Version (2001, engl./frz. 2000) kaum die Arbeit mit literarischen Texten. Lediglich in der Globalskala (2001: 36) auf dem Niveau B2 unter der Fertigkeit „Lesen“ wird auf sie hingewiesen – „Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen“ –, was für das Niveau C2 auf alle „literarische[n] Werke“ ausgeweitet und für die Fertigkeit „Schreiben“ durch das Item ergänzt wird, dass Lernende „literarische Werke schriftlich zusammenfassen und besprechen können“ (→ Kap. 5).1 Im neuen Begleitband zum GER (2020, engl./frz. 2018: 6f.), dessen ‚zweiter Version‘, findet die Arbeit mit literarischen Texten weitaus stärkere Berücksichtigung (→ Kap. 5). Die Umsetzung der Empfehlungen zur Förderung des „Lesen[s] als Freizeitbeschäftigung“, der „Analyse und Kritik kreativer Texte“ und der „Persönliche[n] Reaktion auf kreative Texte“ in Curricula, Lehr- und Lernmaterialien und Unterricht wird in den nächsten Jahren fachwissenschaftlich zu begleiten und zu reflektieren sein.
Während es in den Fachdidaktiken um Lehr- und Lernprozesse in dem in hohem Maß vorstrukturierten schulischen Kontext geht, werden im Hinblick auf den Unterricht von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sehr unterschiedliche Lehr- und Lernkontexte apostrophiert. So ist zu differenzieren, ob die Arbeit mit literarischen Texten im Kontext von Sprachunterricht oder Literaturunterricht stattfindet; mit Kindern, Jugendlichen oder in der Erwachsenenbildung; im universitären oder nicht-universitären Zusammenhang; mit Gruppen mit einer gemeinsamen oder mehreren unterschiedlichen L1; mit Lernenden, die in unterschiedlichen Lehr- und Lerntraditionen sozialisiert sind. Dieses weite Spektrum scheint in den offeneren Formulierungen wie etwa Literatur im DaF/DaZ-Unterricht (Koppensteiner/Schwarz 2012) auf. Mit der Entscheidung für den Begriff „Literaturdidaktik“ möchten wir diesen weiten Horizont des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache beibehalten und gleichzeitig ausdrücken, dass sich dessen Grundlagen als „Didaktik“ bezeichnen lassen, als „Wissenschaft vom Lehren und Lernen von Literatur“ (vgl. nochmals Ehlers 2016: 13, Leubner/Saupe/Richter 2016: 13). Wir möchten damit auch an den Sprachgebrauch in den Nachbardisziplinen anschließen, auf deren Reflexionspotenzial wir in unserem Band an verschiedenen Stellen zurückgreifen.
Wir schließen außerdem an eine Bestimmung des Begriffs „Literaturdidaktik“ an, wie sie in der fünften, aktualisierten und erweiterten Auflage des Metzler Lexikons Literatur- und Kulturtheorie (2013) gegeben wird. Hier wird der Begriff recht weit gefasst im Hinblick auf institutionalisierte Lernprozesse. In dem entsprechenden Lemma heißt es:
Literaturdidaktik bezeichnet den Komplex von Entscheidungen, Konzeptionen und Theorien über Literatur als Gegenstand institutionalisierter Lernprozesse. […] Die Bestimmung von Lernzielen bzw. -inhalten ist von gesellschaftlichen Wertregistern wie ästhetische und religiöse Bildung, National- oder Klassenbewusstsein, Emanzipation und Toleranz abhängig, die in Formen wie bildungs-, lernziel-, handlungsorientierter, erfahrungsbezogener und integrativer Unterricht umgesetzt werden. […] Literaturdidaktik umfasst die Organisation rezeptiver, produktiver, darstellender, analytischer, kommunikativer, rhetorisch-argumentativer, wissensentnehmender und -speichernder Handlungsformen und Erkenntnismöglichkeiten. (ebd.: 456)
Diese Definition umfasst einiges, was zur Vermittlung literarischer Texte auch im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in jüngerer Zeit diskutiert wird. Entscheidend sind die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand Literatur, die Bestimmung von Lehr- und Lernzielen und die Modellierung von Unterrichtssettings.
In dem Lemma „Literaturdidaktik“ im Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (2013) werden weiter Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte als Bezugswissenschaft(en) der Literaturdidaktik bezeichnet. Es wird darauf verwiesen, dass es gerade eine stärkere Orientierung an fachwissenschaftlichen Entwicklungen in der Literaturwissenschaft sei, die in jüngerer Zeit zu produktiven neuen Ansätzen und Konzepten in der Literaturdidaktik führe (vgl. ebd.). Allerdings ist das Verhältnis zwischen Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik keineswegs so unumstritten, wie es diese Formulierung vermuten lässt. Insbesondere in der Forschungsdiskussion der Fachdidaktik Deutsch finden sich zunehmend kontroverse Positionen. In ihrer erstmals 19982 und in zweiter Auflage 2006 erschienenen Einführung in die Literaturdidaktik bezeichnet Elisabeth Paefgen die Literaturdidaktik noch als „Teilgebiet der Literaturwissenschaft“ (Paefgen 2006: VIII). Während ihrer Einschätzung nach der „literaturwissenschaftliche Anteil für alle Literaturlehrenden gleichermaßen verpflichtend und grundlegend ist“ (ebd.), seien andere Aspekte wie „pädagogische, soziologische, kulturelle und politische Bezüge“ (ebd.) zwar auch von Relevanz, jedoch nicht in gleicher Weise verbindlich. Diese Position stärkt Klaus-Michael Bogdal in seinem Beitrag in dem von ihm und Hermann Korte herausgegebenen Band Grundzüge der Literaturdidaktik, erstmals 2002 erschienen und seit 2012 in sechster Auflage vorliegend: „Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft unterscheiden sich nicht in ihren Grundlagen, Methoden und Gegenständen, Ansprüchen, Problemen und Krisen“ (Bogdal 2012: 13). Er bezeichnet die Literaturwissenschaft als grundlegende Bezugsdisziplin, deren Forschungsergebnisse es in der Literaturdidaktik zu berücksichtigen gelte, und grenzt sich deutlich von Positionen ab, die Literaturdidaktik als Erforschung von Lese- und Vermittlungsprozessen verstehen:
Die literaturwissenschaftlich fundierte Vermittlungstätigkeit bildet das Zentrum der Literaturdidaktik. Ohne den ‚Gegenstand‘ Literatur und die systematische Erforschung seiner historischen, ästhetischen, kulturellen und kommunikativen Dimensionen wird wissenschaftliches Bemühen in diesem Bereich belanglos. (ebd.: 15f.)
Gegen die benannten Positionen gibt es Vorbehalte. In kritischer Bezogenheit auf die Überlegungen von Bogdal (2012) formuliert Volker Frederking (2014), dass die „Deutschdidaktik kein Appendix der Fachwissenschaft, keine Germanistik ‚light‘“ (ebd.: 110) sei. Vielmehr habe die Deutschdidaktik ihre eigenen Forschungsinteressen und müsse dafür auch eigene Methoden entwickeln. Insbesondere muss die Perspektive auf den Lerngegenstand „Literatur“ durch die Perspektive auf die „Lernenden“ ergänzt werden. Er formuliert als grundlegende These:
Deutschdidaktische Forschung setzt die stetige Oszillation zwischen fachlichem Lerngegenstand und fachspezifischen Lehr-Lern-Prozessen voraus. Deutschdidaktik ist in diesem Sinne die Wissenschaft vom fachspezifischen Lehren und Lernen im Zusammenhang mit deutscher Sprache, Literatur und anderen Medien. (ebd.)
Nach Frederking wäre die Deutschdidaktik als transdisziplinäre Wissenschaft zu verstehen, die zwischen der Germanistik und anderen Fachwissenschaften angesiedelt ist. Sie fokussiert fachliche Lerninhalte, fachspezifische Lehr-Lern-Prozesse, Lehrende und Lernende (ebd.: 111). Dabei ist vor allem der empirische Zugang zur Erforschung von Lehr- und Lernprozessen entscheidend:
Eine Deutschdidaktik, die sich als Wissenschaft versteht und als Wissenschaft ernst genommen werden will, muss überprüfte Theorien und abgesichertes Wissen generieren. Als Wissenschaftler müssen wir schlicht wissen, ob das, was wir theoretisch modellieren und als praxistauglich empfehlen, tatsächlich die erhofften Wirkungen zeitigt. Diesem Erfordernis kann nur auf empirischer Basis entsprochen werden. (ebd.: 115)
Von einer anderen Seite als Frederking kritisieren auch Ulf Abraham und Matthis Kepser in ihrer 2005 erstmals erschienenen und seit 2016 in vierter Auflage vorliegenden Einführung Literaturdidaktik Deutsch die Gegenstandsorientierung von Paefgen (2006) und Bogdal (2012). Sie nehmen Literatur als „Handlungsfeld“ (Abraham/Kepser 2016: 20) zum Ausgangspunkt ihrer Argumentation für eine sinnvolle Perspektive einer Literaturdidaktik: „Ihr kann es nicht in erster Linie darum gehen, wie Literatur beschaffen ist. Sie muss sich vor allem dafür interessieren, was Menschen damit machen und warum.“ (ebd.) Explizit setzen sie sich von den Positionen von Paefgen (2006) und Bogdal (2002)3 ab: Sie verstehen „Literaturdidaktik als eigenständige kulturwissenschaftliche Disziplin […]. Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik sind einander benachbarte, aber nicht auseinander ableitbare Disziplinen.“ (Abraham/Kepser 2009: 47f.)4
In der fremdsprachendidaktischen Forschung, besonders in der Fachdidaktik Englisch und auch Romanistik werden in jüngerer Zeit gerade die Transdisziplinarität und die kulturwissenschaftliche Orientierung einer Literaturdidaktik betont. Die Literaturwissenschaft wird als enge Bezugswissenschaft einer Literaturdidaktik angenommen, die sich in steter Auseinandersetzung mit neuen literatur- und kulturwissenschaftlichen Positionen und vielfältigen Lehr- und Lernprozessen dynamisch weiterentwickelt (siehe etwa Bredella/Delanoy/Surkamp 2004: 8, Freitag-Hild 2010: 9ff., Küster 2003). In dem von ihnen herausgegebenen Band Literaturdidaktik im Dialog bezeichnen Lothar Bredella, Werner Delanoy und Carola Surkamp (2004: 9) als wichtige Entwicklungsfelder der Literaturdidaktik beispielhaft eine gender-bezogene Fundierung der Vermittlung von Literatur, einen weiten Literaturbegriff und eine Aufgabenorientierung.
Eine Literaturdidaktik des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wie sie diesem Band zugrunde gelegt wird, knüpft an die dargestellten Forschungsdiskussionen an. Sie
betrachtet Literatur als Gegenstand institutionalisierter Lehr- und Lernprozesse, auf den mit den Grundlagen und Methoden einer (kulturwissenschaftlich orientierten) Literaturwissenschaft zugegriffen wird;
modelliert und erforscht (empirisch) fachspezifische Lehr- und Lernprozesse in ihren vielfältigen Komponenten wie Lernziele, Handlungsformen, Lehrende und Lernende.
Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik werden so als zwei eng miteinander verbundene Wissenschaften verstanden, die Fragestellungen und Analysekategorien zum Gegenstand Literatur teilen.
Diese Einführung verfolgt nicht das Anliegen, eine ‚eigenständige‘ Literaturwissenschaft für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, wohl aber eine fachspezifische Literaturdidaktik zu etablieren.
Die Formung einer ‚eigenständigen‘ Literaturwissenschaft für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wurde in Forschungsbeiträgen immer wieder gefordert (vgl. Dobstadt 2009: 21ff., Altmayer 2014: 34). Aber worin soll sie bestehen? Unserem Verständnis nach ist es – wie in den oben dargestellten Positionen einer Fachdidaktik Deutsch wie Fachdidaktik Englisch ebenfalls deutlich wird – die Literaturwissenschaft an sich, deren Grundlagen und Methoden für einen didaktischen Umgang mit Literatur auch im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache relevant sind.
Literatur müsse als Literatur ernst genommen und vermittelt werden – diese Forderung wird in der fachwissenschaftlichen Diskussion seit 2010 immer deutlicher formuliert. Verschiedene (neue) Konzepte nehmen die literarischen Texte als solche verstärkt in den Blick. Sie legen den Fokus auf
die Rolle der Form für deren (Be-)Deutung (form as meaning),
Medialität,
Deautomatisierung,
diskursive Vernetzung und
die Partizipation an fremdsprachigen Diskursen als übergreifender Zielsetzung des Fremd- und Zweitsprachenunterrichts.
Im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wird dieser Entwicklung in hohem Maße Rechnung getragen; sie ist forschungsleitend in den letzten Jahren. Das betont aus anglistischer Sicht auch Laurenz Volkmann (2015) und hebt die jüngeren Beiträge der fachwissenschaftlichen Diskussion in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache diesbezüglich als vorbildlich hervor:
Sie drehen ein oft vernommenes Hauptargument gegen den Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht bzw. für eine Reduktion von literarisch-ästhetischen Elementen gewissermaßen um. Nicht allein als fiktionaler Steinbruch für landeskundliche Phänomene oder interkulturelle Fremderfahrung habe Literatur zu wirken, sondern – im Gegenteil – Literatur solle im Mittelpunkt eines […] Unterrichts stehen. (Volkmann 2015: 367)5
Mit dieser Betrachtung rücken andere, im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ebenfalls vertretene Positionen in den Hintergrund, die literarische Texte zunächst als Medien für sprachliches und kulturelles Lernen auffassen. In dieser Perspektive werden literarische Texte hauptsächlich in entsprechenden Bedingungsgefügen gesehen. Für das sprachliche Lernen (→ Kap. 6) wird etwa hervorgehoben, dass literarische Texte für die Präsentation und Übung eines grammatischen Phänomens von Bedeutung sein können; eine Position, die sich auch in vielen Lehrwerken findet. Auch die Beschäftigung mit einem Aspekt wie der Literarizität von Texten generell, den literarische Texte jedoch in besonders auffälliger Weise ausstellen, kann in dieser Perspektive sprachliches Lernen fördern.
Mit dem Fokus auf dem kulturellen (bzw. landeskundlichen) Lernen werden die Lektüren literarischer Texte mitunter den Kulturstudien, der Kulturvermittlung bzw. Landeskunde im Fach subsumiert (→ Kap. 7), in besonderem Maße werden literarische Texte im Fokus des interkulturellen Lernens betrachtet (→ Kap. 8).
Eine andere Position betrifft das philologische Handlungswissen von Lernenden. Argumentiert wird, dass von DaF-Lernenden wenig literaturwissenschaftliche Kenntnisse bzw. philologisches Handlungswissen erwartet und gefordert werden können, die für einen adäquaten Umgang mit literarischen Texten erforderlich wären (vgl. Dobstadt 2009: 27). Das ist in Teilen sicher richtig, wobei – wie nachfolgend noch gezeigt wird – unterschiedliche Lehr- und Lernkontexte zu berücksichtigen wären. Auch richtig sind aber Positionen wie beispielsweise von Andrea Leskovec (2011b) und mit Blick auf die Arbeit mit Spielfilmen Renate Bürner-Kotzam (2011a), dass entsprechendes deklaratives Wissen im Unterricht etwa in Form von Glossaren oder kurzen Erklärungen bereitgestellt und von den Lernenden verwendet, günstigenfalls also zu prozeduralem Wissen werden kann. Eine solche Vorgehensweise setzt allerdings voraus, dass die Lehrenden über entsprechende Kenntnisse verfügen und sie schon in der Unterrichtsvorbereitung einsetzen können. Eine Fallstudie von Almut Hille (2017) in Anknüpfung an Überlegungen von Claire Kramsch (2011) zeigt, dass Studierende als künftige Lehrkräfte nicht in ausreichendem Maße über literaturwissenschaftliche Kenntnisse bzw. philologisches Handlungswissen verfügen. In der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften müssten sie also stärker vermittelt werden.
Fallstudien, wie die genannte, oder größere empirische Studien werden auch in der Literaturdidaktik des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen (müssen). Bislang werden empirische Forschungen insbesondere im Hinblick auf sprachliche Lehr- und Lernprozesse durchgeführt (siehe etwa Riemer/Settinieri 2010, Settinieri et al. 2014 und Riemer 2019). Im Bereich der Literatur- und Kulturvermittlung sind sie noch selten.6 In einem Überblicksartikel zu literaturwissenschaftlich orientierten Lehr- und Forschungsperspektiven im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache entwickeln Dobstadt/Riedner (2014a: 157f.) erste Überlegungen dazu; außerdem stellen sie in einem Beitrag von 2016 eine Pilotstudie zur Arbeit mit einer Lehrbuchlektion vor, die im Hinblick auf eine Literarizitätsdidaktik modifiziert und mit einer Gruppe von Lernenden evaluiert wurde. Potenzial für empirische Forschungen sehen sie vor allem in rezeptions- und leserbezogenen sowie methodisch-didaktischen Fragen, bei denen es um die Evaluierung von Aufgabenstellungen und Unterrichtskonzepten für das Erreichen von literaturbezogenen Lehr- und Lernzielen geht. Neben diesen generellen Überlegungen finden sich erste empirische Forschungen zu Unterrichtskonzepten, die auf der Basis literaturtheoretischer Diskussionen zur diskursiven Verfasstheit literarischer Texte (→ Kap. 10) modelliert wurden. In zwei Beiträgen zur Arbeit mit Texten der Gegenwartsliteratur im Rahmen von internationalen Masterstudiengängen für Deutsch als Fremdsprache bzw. von Fortbildungen für Deutschlehrer*innen in der internationalen Germanistik wurden Daten zu den Lektüren von Studierenden und Lehrenden erhoben und ausgewertet (Hille/Schiedermair 2018, Schiedermair 2020). Wie diese (ersten) Überlegungen und Publikationen zeigen, steht die Forschung hier noch am Anfang. Es gilt, weiter auszuarbeiten, welche Fragestellungen sich mit empirischen Forschungsmethoden bearbeiten lassen und welche Forschungsdesigns geeignet sind. Dabei sind insbesondere die (sehr) heterogenen Kontexte von Lehr- und Lernprozessen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache zu berücksichtigen. Anders als in den philologischen Fachdidaktiken, die auf erstsprachliche oder fremdsprachliche Literaturvermittlung in der Schule ausgerichtet sind und die institutionellen Gegebenheiten wie Schulformen, Jahrgangsstufen, Curricula, Prüfungsordnungen und Bildungsstandards teilen, unterscheiden sich diese erheblich. Wie oben bereits skizziert, stellt Literaturdidaktik im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache einen komplexen Zusammenhang dar, bei dem es auch gilt, zwischen unterschiedlichen
Lernsozialisierungen,
Ausgangssprachen,
Sprachniveaus
und Kursformaten
zu differenzieren (vgl. Rösler 2012: 227–237, Schiedermair 2020: 95).
Kommen wir auf das Lemma „Literaturdidaktik“ im Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (2013) zurück. In ihm wird neben oder als Teil der Literaturwissenschaft auch die Literaturgeschichte als Bezugswissenschaft der Literaturdidaktik genannt. Wir möchten ihr einen Stellenwert einräumen, obwohl oder gerade weil im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache so oft, wenn (überhaupt) von der Arbeit mit Literatur im Unterricht die Rede ist, die Gegenwartsliteratur im Vordergrund steht.7 Unberücksichtigt bleiben dann die Bezüge zum Vergangenen im Gegenwärtigen, „the echoes of past narratives“ in der Gegenwart wie Piera Carroli (2008: 186) sie in ihrer Studie Literature in Second Language Education nennt. Vor diesem Hintergrund plädiert auch Neva Šlibar (2011) für die Beachtung literaturhistorischer Dimensionen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Sie schlägt ‚Spaziergänge‘ durch die Literaturgeschichte vor, die Lernende z. B. in eigenständigen Recherchen und nachfolgenden Präsentationen oder Inszenierungen unternehmen können – in Gruppenarbeit und ohne Schwellenängste gegenüber Nachschlagewerken. Literaturgeschichte(n) würde(n) so erlebbar und Text-Kontext-Dimensionen ohne Reduktion auf einen ‚Biografismus‘ der Autor*innen nachvollziehbar (vgl. Šlibar 2011: 85).
Ein Nachschlagewerk, prädestiniert für ein solches Vorgehen, wäre z. B. die von David E. Wellbery u.a. herausgegebene Neue Geschichte der deutschen Literatur (2007). Sie steht für methodische Neuausrichtungen auch der Literaturgeschichtsschreibung. Ziel der gewählten Art der Darstellung von Literaturgeschichte ist es, einzelne Texte als „einzigartige Ereignisse“ (ebd.: 15) wahrzunehmen. Sie sollen nicht als „Veranschaulichungen einer Macht, einer Neigung oder Norm – als Geist eines Zeitalters oder einer Nation, als Klassenvorliebe oder ästhetisches Ideal“, als „typisch für etwas“ betrachtet werden (ebd.). Vielmehr sollen „wirkliche Begegnungen“ mit Texten ermöglicht werden, da es diese Begegnungen sind, die letztendlich das „Erregende der Leseerfahrung“ ausmachen (ebd.). Literaturgeschichte wird als Netz von Ereignissen erzählt, in dem Lesende sich nach Belieben bewegen können. So verweist das Inhaltsverzeichnis nicht auf einzelne Epochen, Dekaden oder Autor*innen sondern formuliert (im besten Fall Neugier erzeugende) Stichworte wie 1647. Dramaturgie des Reisens, 1804. Die Nacht der Phantasie oder Januar 1931. Irmgard Keun und die ‚Neue Frau‘. Jeder Eintrag beginnt mit einem Datum und einer historischen Schlagzeile; er endet mit Vorschlägen, welche weiteren Einträge im Kontext gelesen werden könnten.
Textbeispiel
Unter dem Eintrag Januar 1931 zum Beispiel begegnen Lesende nach der Schlagzeile Reichskanzler Brüning beruft eine Expertenkommission ein, um über die sich verschärfende Wirtschaftskrise zu beraten der Hauptfigur Gilgi aus Irmgard Keuns gleichnamigem, in jenem Jahr veröffentlichten Erfolgsroman Gilgi – eine von uns. Der Eintrag stellt ihr Verlangen nach Emanzipation und Geborgenheit, ihre alltäglichen (Überlebens-)Kämpfe in der Großstadt in den sogenannten Goldenen Zwanzigern, aber auch die desaströse wirtschaftliche Situation sowie den Medien- und Kulturbetrieb der Zeit vor; gleichzeitig werden Merkmale eines neusachlichen Schreibens expliziert. Vom Januar 1931 aus können Lesende zurückblättern zu 1670 Hermaphroditismus und Geschlechterkampf, 8. Februar 1765 „Papierene Mädchen erziehen“ und das private Leben meistern, Februar 1848 Die Neuerfindung eines Genres und Oktober 1924 Modernismus und Hysterie, aber auch nach vorn zu 30. Juni 1937 Schauspiel der Verunglimpfung und 1963 Liebe als Faschismus. So können abhängig von den individuellen Lektüren verschiedene Literaturgeschichtserzählungen entstehen, deren Grundlagen auch Zufälle, Anekdotisches und exemplarische Bezugnahmen bilden.
Ein solches Umgehen mit literarischen Texten möchten wir mit dem Konzept des Arbeitens mit Textnetzen auch für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache empfehlen (→ Kap. 10, 18).
Einen anderen Zugang zu literarischen Texten über neuere Konzeptionen von Literaturgeschichte bietet die 2017 von Sandra Richter publizierte Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur. Ihr Ziel sind Aufschlüsse darüber, „wie deutschsprachige Literatur in der Welt wahrgenommen wird“ (Richter 2017: 18). Anhand von „Fallbeispielen und ausgewählten Erzählungen“ mustert die Autorin „Verbreitungsformen und Verbreitungswege“ von Literatur sowie ästhetische und ethische Wertungen als Momente der Wahrnehmung und Deutung (ebd.).
Textbeispiel
Rainer Maria Rilke zum Beispiel erscheint in dieser Perspektive als „Vierländerdichter“ und „poeta touristicus“, der durch die Alpen und Italien, nach Ägypten, Schweden und mehrmals nach Russland reiste (vgl. ebd.: 275). Er schrieb auf Deutsch und Französisch, äußerte sich auch auf Russisch (vgl. ebd.). Weltweit rezipiert wurde besonders sein Spätwerk: Die Duineser Elegien (1923) zum Beispiel wurden ab 1927 zunächst ins Japanische, Polnische, Tschechische und Englische übersetzt; heute sind sie in allen Ländern Nord- und Südamerikas, Europas sowie in vielen asiatischen Ländern in entsprechenden Übersetzungen verbreitet (vgl. ebd.: 277ff.). Zu Intertexten wurden die Elegien etwa für das literarische Bekenntnis Einsiedler [Otšelnik] (1929) des bulgarischen Symbolisten Teodor Trajanov und für die Erzählung The Hungry Tide (2004) von Amitav Ghosh aus Indien. Mit einer solchen Betrachtungsweise wird deutschsprachige Literatur als Hybrid gekennzeichnet, das sich (inter-)regional, europäisch und global entfaltet und mehrsprachig ist (vgl. Richter 2017: 19f.). Gleichzeitig rücken die Lesenden in den Fokus. Denn es liegt weniger an einem „Text selbst, wie er wahrgenommen und gedeutet wird, als an seinen Lesern, ihren Interessen und Deutungsgewohnheiten“ (ebd.: 21).
Ein solches Konzept ist einerseits in seiner Fokussierung auf die Lesenden anschlussfähig an Diskussionen im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (→ Kap. 20), andererseits eröffnet es neue Dimensionen einer Literaturbetrachtung, die für das Fach von Bedeutung sind. In den Fokus rücken Phänomene wie die Vernetzung von Texten (→ Kap. 10), Intertextualität und Intermedialität (→ Kap. 11), Mehrsprachigkeit (→ Kap. 13), aber auch Übersetzungen als Aneignungen, verschiedene Kultur- und Wissenschaftsbetriebe, Zeitenwenden, zivilisatorische (Auf-)Brüche sowie globale Literaturentwicklungen und ein Global Mainstream oder Western Canon (vgl. ebd.: 467–480).
3Gibt es einen Kanon?
Braucht man einen eigenständigen Kanon für „Deutsch als Fremdsprache“? fragte Hartmut Eggert in einem so betitelten Aufsatz 1995, um diese Frage anschließend vorrangig mit Blick auf das Fach Deutsch als Fremdsprache und die internationale Germanistik zu diskutieren und letztendlich zu verneinen. Entscheidend ist dabei das Wörtchen „einen“: Den einen, starren, über längere Zeit gültigen Kanon für ‚das‘ Fach Deutsch als Fremdsprache oder ‚die‘ internationale Germanistik kann es nicht geben. Von Lehrkräften wird immer unter regional-, institutionen- und gruppenspezifischen Aspekten sowie curriculum- und prüfungsbezogen erwogen werden, welche literarischen Texte für Lehre und Unterricht geeignet erscheinen.
In den frühen Debatten um die Auswahl literarischer Texte für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache waren einige Diskussionsfelder der 1970er Jahre um einen Kanon für den schulischen (Deutsch-)Unterricht in der Bundesrepublik wiederzuerkennen. Sie scheinen weiterhin relevant zu sein. Es ging und geht um Fragen wie
moderne vs. ältere Texte
Weltliteratur vs. Nationalliteratur
Trivialliteratur vs. hohe Literatur
Gebrauchsliteratur vs. Dichtung
verschüttete und unterdrückte Literatur vs. etablierte Literatur (vgl. Eggert 1995: 199f.).
Von ‚einem‘ Kanon wird dabei kaum gesprochen, haben die literaturwissenschaftlichen und -didaktischen Debatten seit den 1970er Jahren doch einerseits zu verschiedenen Erweiterungen eines traditionellen (Bildungs-)Kanons und andererseits zu einer äußerst kritischen Reflexion des Kanon-Begriffs an sich geführt. Erst in jüngerer Zeit scheinen Kanon-Debatten wieder eine Konjunktur zu erleben. In ihrem Mittelpunkt steht die Frage, was Literatur im digitalen Zeitalter eigentlich sei und welche Bedeutung sie haben könne (→ Kap. 1). Einem literarischen Kanon wird dabei eine mögliche Orientierungs-, Ordnungs- und (Be-)Wertungsfunktion in der Menge der in verschiedenen medialen Formaten edierten Texte zugeschrieben.
Was sich hier in aller Kürze zusammengefasst findet, ist das Ergebnis eines langen Prozesses (vgl. zur folgenden Skizze Ackermann 2001: 1346–1350, Ewert 2010: 1555–1560, Winko 2013: 363):
Anfänge
Der Begriff „Kanon“ selbst (griech.: Regel, Maßstab, Richtschnur; urspr. Schilfrohr, Messrute) ist bereits in der Antike bekannt, auch die damit bezeichnete Vorstellung eines Gemeinsamen und Verbindlichen. So wurde er verwendet, um eine Sammlung von Regeln eines Fachgebiets, eine Sammlung von Texten oder auch bestimmte Ziel- und Idealvorstellungen zu bezeichnen und implizierte von Anfang an die Dimension des Normativen (vgl. Ackermann 2001: 1346, Ewert 2010: 1555). Im 2. Jahrhundert vor Chr. fanden sich im griechisch-römischen Bereich auch bereits Listen mit Namen von wichtigen Autoren – Dichtern, Rednern, Philosophen, Historikern –, die als Vorbilder galten.
Theologie als Vorbild
War das Kanonkonzept später zunächst vor allem in der Theologie





























