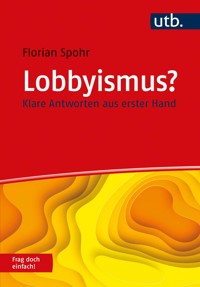
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Frag doch einfach!
- Sprache: Deutsch
Inwieweit beeinflussen Lobbyist:innen in Deutschland die Politik? Was unterscheidet Lobbyismus von Korruption? Sind Nebentätigkeiten von Abgeordneten problematisch? Diese und weitere Fragen beantwortet Florian Spohr in seinem Buch. Er stellt die vielfältigen Akteur:innen und ihre Strategien in diesem Feld vor und erklärt, weshalb Lobbyismus sowohl notwendig als auch bedrohlich für demokratisches Regieren und das Allgemeinwohl ist. Daneben verrät er, wie Lobbyismus effektiv reguliert werden kann und welche NGOs und Websites zur Transparenz von Lobbyismus beitragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Florian Spohr
Lobbyismus? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Hand
UVK Verlag · München
Dr. Florian Spohr ist akademischer Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart, wo er in dem DFG-Forschungsprojekt „Lobbying Across Multiple Levels: German Federal Institutions, European Union, and the Länder“ arbeitet. Neben den Themen Lobbyismus und Interessenvermittlung ist sein weiteres Forschungsgebiet die Arbeitsmarktpolitik.
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue – iStock
Icons im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur
Abbildung Berliner Reichstag (Infografik): © AlinArt – shutterstock
Abbildungen 3, 4 und 5: © Pauline Büsken
Autorenfoto: © Akofa Korfmann
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838556888
© UVK Verlag 2023— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
utb-Nr. 5688
ISBN 978-3-8252-5688-3 (Print)
ISBN 978-3-8463-5688-3 (ePub)
Inhalt
Vorwort und Einleitung
Als ich vor etwa zehn Jahren damit begonnen hatte, mich wissenschaftlich mit Lobbyismus auseinanderzusetzen, fiel mir schnell ein erstaunlicher Gegensatz auf. Auf der einen Seite kam in Gesprächen mit Bekannten über mein neues Forschungsfeld regelmäßig die Frage auf, warum Lobbyismus überhaupt erlaubt sei. Auch in Onlinekommentarspalten finden sich unter einschlägigen Artikeln viele Rufe nach Verboten. In dieser allgemeinen, sich aus medial viel beachteten (und vielen) Einzelfällen speisenden Sicht wird Lobbyismus assoziiert mit dunklen Machenschaften in Hinterzimmern und allgemein als illegitim und schädlich betrachtet.
Gleichzeitig wird in der politikwissenschaftlichen Interessengruppen- und Verbändeforschung, die sich diesem Thema widmet, Lobbyismus nicht nur als legitim, sondern als eine für eine demokratische und gute Politik notwendige Interessenvertretung betrachtet.
Dieser Widerspruch weckte mein bis heute anhaltendes Interesse an dem Thema und zeigt sehr gut dessen Spannweite und Komplexität auf. Aber worin liegt er begründet? Dass die Öffentlichkeit Lobbyismus kritisch gegenübersteht, ist zunächst sicherlich dem Nachrichtenwert von Skandalen geschuldet. Viele Menschen setzen daher Lobbyismus mit Korruption gleich (etwa Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale am 30.08.2022).
Daher möchte ich den Leser:innen dieses Buches auch die andere Seite nahebringen. Denn Lobbyismus kann viele Ziele haben und viele Formen annehmen. Letztlich vertritt ein Wirtschaftskonzern, der sich für Steuersenkungen einsetzt, genauso seine Interessen wie eine Bürgerinitiative, die eine Ampel auf dem Schulweg fordert. Lobbyismus ist ein „notwendiges Übel“ für eine Demokratie. Eine Gesellschaft, in der sich Interessen nicht formieren und artikulieren können, ist nicht frei. Und eine Politik, die nicht auf dem Ausgleich der unterschiedlichen Interessen beruht, ist nicht gerecht. Gleichzeitig bedrohen aber die ungleichen Möglichkeiten die für eine funktionierende Demokratie notwendige Chancengleichheit.
Der Forschung über Lobbyismus wird gelegentlich vorgeworfen, betriebsblind für die Defizite und Gefahren von Lobbyismus zu sein und dem Klischee „der sinnvollen Kontrolle durch Lobbyisten und der tradierten Routine im Parlamentsbetrieb“ (Leif 2018:35) zu folgen. Um dieser Gefahr zu entgehen, möchte ich aus dem akademischen Elfenturm hinaus auch über den Tellerrand schauen. Hierzu habe ich für dieses Buch neben dem aktuellen Stand der nationalen und internationalen politikwissenschaftlichen Forschung auch Quellen aus dem Journalismus, von Organisationen, die Lobbyismus kritisch beobachten, sowie von Lobbyist:innen selber einbezogen.
Dieses Buch legt einen Schwerpunkt auf den aktuellen Lobbyismus in Deutschland und der Europäischen Union, macht aber auch Exkurse in andere Zeiten und Länder. Es beginnt im ersten Kapitel mit dem spannungsreichen Verhältnis von Lobbyismus und Demokratie. Das zweite Kapitel stellt die vielschichtigen Akteure im Lobbyismus vor. In Deutschland gehören hierzu traditionell die großen Verbände wie Gewerkschaften, Arbeitgeber-, Industrie- und Wohlfahrtsverbände, aber auch Umweltschutzvereine und NGOs. Zudem sind Unternehmen direkt im Lobbying aktiv oder beauftragen Agenturen und Kanzleien hiermit, die als hired guns bzw. Söldner (Bernhagen 2019: 251) gutbezahlt die Interessen anderer vertreten. Diese verschiedenen Organisationen versuchen nun auf vielfältige Arten direkt und indirekt Einfluss auf Politik zu nehmen. Die unterschiedlichen Strategien des Lobbyismus stelle ich im dritten Kapitel im Detail vor.
Kapitel 4 und 5 geben einen Einblick in die aktuelle Interessenvermittlung in der Bundesrepublik und der Europäischen Union. Das sechste Kapitel behandelt die böse Schwester des Lobbyismus, die Korruption, und illustriert anhand einiger Fälle der jüngeren Vergangenheit den nicht immer eindeutig zu bestimmenden Graubereich zum Lobbyismus. Das siebte und abschließende Kapitel zeigt dann Möglichkeiten zur besseren Regulierung von Lobbyismus auf, stellt die jüngsten Reformen in Deutschland hierzu vor und legt dar, was auf dem Weg zu einem fairen und gemeinwohlfördernden Lobbyismus noch zu tun ist.
Zwei Personen gilt mein besonderer Dank. Zum einen Pauline Büsken von der Ruhr-Universität Bochum, die freundlicherweise einige ihrer Daten über Nebentätigkeiten von Abgeordneten für dieses Buch zur Verfügung gestellt hat. Zum anderen Nadja Hilbig vom UVK Verlag München, die mich stets professionell, freundlich und geduldig unterstützt hat.
Florian Spohr
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni verrät dir spannende Literaturtipps, Videos und Blogs im World Wide Web.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an. Das ist eine der Fragen zum Thema, deren Antwort du unbedingt lesen solltest.
Die Lupe weist dich auf eine Expert:innenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
→
Wichtige Begriffe sind mit einem Pfeil gekennzeichnet und werden im Glossar erklärt.
Lobbyismus und Demokratie
Mit Lobbyismus verbinden die meisten Menschen eine illegitime Beeinflussung der Politik durch Wirtschaftsinteressen. In diesem Kapitel wird geklärt, was an dieser negativen Konnotation des Begriffs dran ist. Auch die Bedeutung von Lobbyismus für das Allgemeinwohl und für die Demokratie kommt zur Sprache.
Woher kommt der Begriff „Lobbyismus“ und was meint er?
Der Begriff „Lobbyismus“, im Englischen lobbyism, leitet sich in seiner Wortherkunft von den Lobbys der Parlamentsgebäude, etwa des britischen Palace of Westminister und des US-amerikanischen Kongresses, ab. Lobby leitet sich wiederum vom lateinischen Labium (Wartehalle) ab. Da den Sitzungssaal nur gewählte Abgeordnete betreten durften, warteten alle, die Kontakt zu den Abgeordneten suchten, in der Lobby und versuchten dort diese in persönlichen Gesprächen davon zu überzeugen, ihre Probleme auf die Agenda zu setzen oder in ihrem Sinne zu entscheiden oder abzustimmen (Eckert 2005: 268).
So meint die Lobby als Teekesselchen neben einem Raum auch die Vertretung von → Interessen. Wir kennen etwa die Redewendung, „keine Lobby haben“, was so viel bedeutet wie keine Unterstützung zu bekommen. Umgekehrt nehmen wir an, wenn etwa bestimmte Industrien „eine starke Lobby“ haben, dass diese über Macht und → Einfluss verfügen. Eine Lobby haben bedeutet, einem „stehen innerhalb und außerhalb von Parlament und Regierung Personen zur Verfügung, die sich ihre Interessen zu eigen machen“ (Kolbe et al. 2011: 9). Daher sprechen wir etwa von der Automobil- oder Waffenlobby. Auch wenn im alltäglichen Gebrauch und wohl auch vor dem inneren Auge eine Lobby oft mit der Wirtschaft verbunden wird, können auch Tiere, das Klima oder die Umwelt ihre Lobby haben.
Durch diesen alltäglichen Gebrauch und einen mit ihm einhergehenden Bild einer illegitimen Einflussnahme von organisierten Interessen auf die Politik ist der Begriff „Lobbyismus“ im deutschen Zusammenhang bislang überwiegend negativ konnotiert. Daher nutzen hier etwa Lobbyist:innen selber zur Beschreibung ihrer Tätigkeit „bevorzugt alternative Anglizismen, wie public affairs, government relations und public relations, oder deutschsprachige Bezeichnungen wie Kommunikation, Strategieberatung und eben Politikberatung“ (Bernhagen 2019: 250).
Wie definiert die Politikwissenschaft Lobbyismus?
Aus Sicht der Politikwissenschaft meint Lobbyismus den Austausch von Positionen und → Interessen zwischen staatlichen und gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Akteuren, in welchem letztere versuchen, politische Entscheidungen im Sinne bestimmter Interessen zu beeinflussen (Baruth/Schnapp 2015: 246).
„Lobbying oder Lobbyismus bezeichnet die direkten und in der Regel informellen Versuche von Vertretern gesellschaftlicher Interessen, auf die Akteure des politischen Entscheidungsprozesses konkret einzuwirken, um Politikergebnisse in ihrem Sinne zu verändern.“ (Kleinfeld et al. 2007: 10)
Lobbyismus kann anhand mehrerer Aspekte identifiziert und definiert werden: Erstens ist er kommunikativ, denn Positionen, Bedürfnisse, Ablehnung, Bedenken und Wünsche werden argumentativ vermittelt. Hier sind wir wieder beim Bild der Wartehalle, in der die Abgeordneten von Bürger:innen abgepasst und in ein Gespräch verwickelt werden. Auch heute kommt Lobbyismus dem historischen Geschehen in der Wartehalle noch recht nahe, denn Lobbyist:innen vertreten Interessen in direkter, oftmals nichtöffentlicher und informeller Kommunikation – persönlich, telefonisch, per E-Mail, SMS, Fax oder postalisch – mit Mitgliedern und Angestellten der Regierung und des Parlamentes.
Ein zweites Merkmal von Lobbyismus ist, dass dieser das Ziel hat, politische Entscheidungen zu beeinflussen, welche die Adressaten des Lobbyismus, also in unserem Bild die Abgeordneten in der Wandelhalle, treffen oder zumindest beeinflussen können. Lobbyismus zielt hierbei nicht notwendigerweise auf politische (Gesetzes-)Änderungen, sondern kann auch zum Ziel haben, diese zu verhindern. In jedem Politikfeld haben sich Koalitionen von Interessen gebildet, die vom gegenwärtigen Status quo profitieren. So hat die Forschung gezeigt, dass vor allem wirtschaftliche Interessen diesen verteidigen, während nichtwirtschaftliche Interessen eher versuchen, neue Themen auf die politische Agenda zu bringen und sich für einen Politikwechsel einsetzen (Lindblom 1977; Dür et al. 2015).
Drittens geschieht diese Beeinflussung der politischen Beschlusslage zugunsten bestimmter Interessen, wobei diese Interessen sowohl von Organisationen und Unternehmen direkt vertreten werden können als auch von Dritten stellvertretend für diese.
„Interessenvertretung bedeutet, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen und ihre Verbände politische Entscheidungen über Regelungen oder die Verteilung von Ressourcen zu ihren Gunsten beeinflussen wollen.“ (Loer/Töller 2019)
Wirtschaftliche Lobbygruppen versuchen durch die Beeinflussung staatlicher Entscheidungen die Erträge ihrer Mitglieder zu maximieren (Speth 2010: 20). Beispiele hierfür sind etwa gesetzlich festgelegte Sonderregelungen oder Ausnahmen, etwa bei Steuern oder arbeitsrechtlichen Regelungen, bis hin zu Subventionen für eine bestimmte Branche.
Zusammengefasst ist Lobbying oder Lobbyismus, diese Begriffe können synonym verwendet werden, die Praxis, dass Personen → Informationen an Politiker:innen weitergeben, um so deren Entscheidungen in einer bestimmten Angelegenheit zu beeinflussen. Dieser engen Definition folgen etwa David Austen-Smith und John R. Wright:
„We define lobbying very specifically, and somewhat narrowly, as the transmission of information directly to legislators in an effort to reinforce or change their policy positions.“ (Austen-Smith/Wright 1994: 36)
Kann Lobbyismus auch breiter definiert werden?
Der Begriff „Lobbyismus“ hat im Laufe der Zeit eine Wandlung erlebt und wird mittlerweile breiter gefasst. Ursprünglich meinte Lobbyismus nur die zeitlich begrenzte Einflussnahme im Hinblick auf ein konkretes Vorhaben der Politik, etwa ein Gesetz, welches erlassen werden soll (Zimmer/Speth 2015: 12). Jedoch können zu Lobbyismus allgemeiner auch indirekte Versuche, auf Entscheidungen → Einfluss zu nehmen, oder generell Aufbau und Pflege von sozialen Kontakten zu relevanten Politiker:innen, gezählt werden (Austen-Smith/Wright 1994: 36). Lobbyismus als Interessenvertretung, die sich gezielt auf die konkrete Beeinflussung eines politischen Vorhabens richtet, ist also in eine umfassendere Strategie der Interessenvermittlung bzw. des public affairs management eingebettet (Kleinfeld et al. 2007: 10).
Einen weiteren Bedeutungswandel erfuhr der Begriff „Lobbyismus“ in Bezug auf seinen Adressatenkreis. Ursprünglich wurde unter Lobbyismus die Interaktion mit einem vergleichsweise kleinen Kreis verstanden, nämlich denjenigen, die direkt in die Politikformulierung involviert sind, etwa Abgeordnete oder Mitarbeiter:innen der Ministerien. Diese Versuche der Einflussnahme über personelle Kontakte werden auch als → „Inside-Lobbying“ bezeichnet. Mittlerweile jedoch wird Lobbyismus als Begriff häufig auch dann genutzt, wenn Informationen sich an die allgemeine Öffentlichkeit (oder Teile dieser) richten, mit dem Zweck, Aufmerksamkeit oder ein Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Interessenvertretung ist auch deswegen heutzutage gemeinhin breit angelegt, weil der öffentlichen Meinung ein wichtiger Stellenwert zukommt. Lobbyismus ist insofern zu einem guten Teil heute auch immer „Meinungsmache“ (Zimmer/Speth 2015: 12).
Ein solch indirektes oder → Outside-Lobbying versucht, → Interessen über die Öffentlichkeit an die Politik heranzutragen. Politische Ziele sollen dabei über die mediale Bande erreicht werden, indem an ihrer Wiederwahl interessiere Politiker:innen sich der öffentlichen Meinung beugen, welche durch Kampagnen oder Medien beeinflusst werden kann. Hierzu nutzen Interessenorganisationen wie → Verbände und → NGOsNichtregierungsorganisation (NGO), aber auch Stiftungen und Unternehmen, neben Kontakten zu den klassischen Medien auch vermehrt KampagnenKampagnen und PR-Arbeit, um sich so über soziale Medien Gehör zu verschaffen. Lobbyismus kann dabei für → Interessengruppen auch das indirekte Ziel haben, Mitglieder zu werben. Denn ein Verband, der gute Verbindungen zur Politik hat und somit offensichtlich Einfluss besitzt (oder zumindest diesen Anschein erweckt), ist für potenzielle Mitglieder attraktiver als die Konkurrenz (Berkhout 2013: 238). Insgesamt können mittlerweile alle Versuche von Vertreter:innen gesellschaftlicher Interessen, Politikergebnisse in ihrem Sinne zu verändern, als Interessenvertretung oder Lobbyismus bezeichnet werden (Zimmer/Speth 2015: 12).
Gehört Lobbyismus zur Demokratie dazu?
Die Vorstellung von Lobbyismus als illegitime, ja skandalöse Machenschaften in Hinterzimmern wird dessen tatsächlicher Bedeutung in und für eine DemokratieDemokratie nicht gerecht. Im Gegenteil ist diese vielmehr darauf angewiesen, dass sich gesellschaftliche Interessen frei formieren und artikulieren können. Die pluralistische Vorstellung von Demokratie geht davon aus, dass in einer differenzierten Gesellschaft nach mehrheitlicher Ansicht gerechte Politik als Kompromiss der divergierenden Ideen und → Interessen der Gruppen und Parteien entsteht. Auf diesem Grundgedanken baut die neopluralistische Theorie auf, welche Interessenvermittlung aus einer demokratietheoretischen Perspektive betrachtet. Ein wesentlicher Mitbegründer des → NeopluralismusNeopluralismus war der deutsch-amerikanische Rechtsanwalt und Politologe Ernst FraenkelFraenkel, Ernst. Fraenkel nahm die normative Idee der amerikanischen Pluralismustheorie auf und argumentierte, dass der Wettbewerb unterschiedlicher und entgegengesetzter Interessen nicht nur legitim, sondern vielmehr wünschenswert ist (Fraenkel 2007[1964]).
Um diesen Gedanken zu verstehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Fraenkels Konzeption ein Gegenentwurf zu den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts darstellte. So Nationalsozialismusbekämpfte die NSDAP unter Adolf Hitler den → PluralismusPluralismus, da sie diesen, ebenso wie den Parlamentarismus, als schädlich und als ein Hindernis für einen starken, dem Führerprinzip folgenden Staat betrachtete. Stattdessen installierten die Nazis ein staatliches System der Interessenvermittlung, in dem nur ein paar wenige → Verbände von der Regierung anerkannt, wenn nicht gar geschaffen wurden. Diese standen unter starker Kontrolle der Regierung, welche die wesentlichen Posten besetzte (Schmitter 1979: 13). So konnte die NSDAP die Interessenvermittlung im Dritten ReichDrittes Reich auf ein „Gemeinwohl“ der Volksgemeinschaft ausrichten, welches sie selbst definierte. Diese staatlich organisierten und gesteuerten Verhandlungen zwischen Kapital und Arbeit im „autoritären Staatskorporatismus“ sollten so gleichermaßen den Kapitalismus bändigen und den Klassenkampf des Kommunismus verhindern. Der Staatskorporatismus, den auch andere Diktaturen wie etwa das faschistische Italien unter Mussolini oder auch die DDRDDR (Heinze 2021: 408) verfolgten, ist nicht zu verwechseln mit der heutigen, als → NeokorporatismusNeokorporatismus bekannten Form der Interessenvermittlung, auch wenn es einige strukturelle Gemeinsamkeiten gibt.
Podcasttipp | In der Interviewreihe „Philosophie im 21. Jahrhundert“ des Podcasts Narabo spricht der Politikwissenschaftler Patrick Bernhagen über Demokratie und Lobbyismus. Ein Auszug aus dem Gespräch ist bei YouTube zu finden: www.youtube.com/watch?v=64j6XXlXJxg. Dort ist auch das komplette Gespräch verlinkt.
Welchen Stellenwert hat Lobbyismus im Pluralismus?
PluralismusPluralismus als normativer Leitgedanke und → Neopluralismus als DemokratietheorieDemokratietheorie wenden sich somit gegen einen solchen Totalitätsanspruch des Staates. Neopluralisten wie FraenkelFraenkel, Ernst betonen gerade die Notwendigkeit einer heterogenen Gesellschaftsstruktur und einer autonomen Willensbildung, die das GemeinwohlGemeinwohl erst definiert. Im Neopluralismus werden gesellschaftliche Interessenkonflikte als legitime politische Auseinandersetzungen angesehen, die der gesellschaftlichen Integration und Befriedung dienen. Dieser Gedanke beruht auf der Prämisse eines Kräftegleichgewichts zwischen den unterschiedlichen → Interessen (Speth 2010: 10). Beispielsweise wird der grundlegende Klassenkonflikt von Kapital und Arbeit aus Sicht der neopluralistischen Theorie so gelöst, dass sich als Reaktion auf das Interesse der Arbeitgeber:innen, den Gewinn durch niedrigere Löhne und ausbeuterische Arbeitsbedingungen zu maximieren, die Arbeitnehmer:innen organisieren und ihr Interesse an besseren Arbeitsbedingungen entgegensetzen. Oder Umweltschutzgruppen fordern staatliche Maßnahmen zur Reduktion von Schadstoffemissionen, während die Industrie diese ablehnen. Nach einem pluralistischen Verständnis befinden sich diese Interessen in einem vorpolitischen Raum; der Staat steht ihnen neutral gegenüber und Regierungen treffen nach Abwägung des Für und Wider politische Entscheidungen. Wenn die Politik der Regierung nachhaltig unausgeglichen ist, korrigieren die Wähler:innen dieses, indem sie eine neue Regierung wählen. So kommt es in der Theorie langfristig zu einem Gleichgewicht oder Ausgleich der unterschiedlichen Interessen. Lobbyismus ist so gesehen ein offener und fairer Wettbewerb der Interessen und Meinungen und Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft.
Was sind pluralistische und neokorporatistische Systeme der Interessenvermittlung?
PluralismusPluralismus war lange Zeit nicht nur ein normatives Leitbild einer legitimen Organisation und Vermittlung von gesellschaftlichen Interessen, sondern auch die führende Erklärung des Zusammenspiels der → Interessengruppen mit dem politisch-administrativen System. Im pluralistischen Ideal nimmt der Staat keinen strukturierenden Einfluss auf das System der Interessenrepräsentation und privilegiert auch keine bestimmten Interessengruppen über andere. Als Folge besitzt auch keine Gruppe ein Monopol in der Repräsentation eines spezifischen Interesses (Schmitter 1979: 15).
Die pluralistische Vorstellung, dass Staat und Interessengruppen getrennte Sphären darstellen, trifft in der Realität in vielen politischen Systemen und Politikfeldern aber nicht zu. Stattdessen sind dort Interessengruppen in die Politikformulierung eingebunden; was als „NeokorporatismusNeokorporatismus“ bezeichnet wird. Das Präfix „Neo“, auf das auch oft verzichtet wird, grenzt den liberalen Neokorporatismus von dem in undemokratischen Regimen praktizierten, autoritären Staatskorporatismus ab. Die Gemeinsamkeit ist, dass sich der seit den 1970er Jahren wieder genutzte Begriff des → NeokorporatismusNeokorporatismus ebenfalls auf ein System der Interessenvermittlung bezieht, in dem bestimmte Verbände eine intermediäre Stellung zwischen Bürger:innen und Staat einnehmen und ebenso vom Staat (gegenüber anderen Interessen) privilegiert einbezogen werden (Voelzkow 2021: 649).
Zudem ist die Anzahl der Gruppen im Neokorporatismus geringer als in einem pluralistischen System; denn diese sind funktional differenziert und konkurrieren nicht miteinander. Dieses bedeutet, dass jedes Interesse im Extremfall von nur einer Gruppe vertreten wird. Wir kennen dieses Prinzip vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB),Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) wo jede Branche eine Mitgliedsgewerkschaft und somit auch jede oder jeder Berufstätige eine spezifische Gewerkschaft hat.
Der Neokorporatismus ist im Prinzip ein institutionalisiertes Tauschverhältnis, bei dem Verbände, die der Politik notwendige → Informationen liefern können und denen es gelingt, einen Großteil ihrer potenziellen Mitglieder zu organisieren, bei der Implementation politischer Entscheidungen mitwirken können. Sie bekommen vom Staat privilegierten → Einfluss auf politische Entscheidungen und die Kompetenzen zur selbstständigen Regulierung in einigen Politikfeldern (Berkhout 2013: 231). Dadurch werden Verbände im Neokorporatismus zu „privaten Interessenregierungen“, die in Verhandlungen mit dem Staat oder mit anderen Verbänden verbindliche Regeln treffen und durchsetzen (Voelzkow 2021: 649).
Selbstregulierung und Selbstverwaltung sollen eine bessere, das Allgemeinwohl fördernde Politik ermöglichen. Zu seiner Hochzeit in den 1970er Jahren beruhte der Neokorporatismus auf der Annahme, dass Verhandlungen zwischen Organisationen mit teilweise gegensätzlichen → Interessen wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden oder den Verbänden der Krankenkassen und der Kassenärzte zu Ergebnissen führen, die auch dem öffentlichen Interesse dienen (Scharpf 1999: 25). Die Verfechter neokorporatistischer Strukturen versprechen sich hierdurch eine stabilere, ausbalanciertere und funktionsfähigere Wirtschaft. Die → SozialpartnerSozialpartner werden im Korporatismus aber nicht nur aus funktionalen, sondern auch aus legitimatorischen Gründen einbezogen. So soll das auch als SozialpartnerschaftSozialpartnerschaft bezeichnete Zusammenspiel der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital befrieden, indem die unterschiedlichen Interessen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden.
Wie kann Lobbyismus die Legitimation politischer Entscheidungen erhöhen?
Zur Beantwortung diese Frage müssen wir zunächst einmal betrachten, wie → Legitimation von Herrschaftsgewalt entsteht. Die DemokratietheorieDemokratietheorie unterscheidet zwei komplementäre Perspektiven der Legimitation: Die input-orientierte Perspektive betont die Herrschaft durch dasVolk, während im Unterschied dazu die output-orientierte Perspektive den Aspekt der Herrschaft für das Volk in den Vordergrund stellt (Scharpf 1999: 16). Lobbyismus kann theoretisch beide Formen der Legitimation erhöhen.
Aus der Input-Perspektive sind politische Entscheidungen dann legitim, „wenn und weil sie den ‚Willen des Volkes‘ widerspiegeln – das heißt, wenn sie von den authentischen Präferenzen der Mitglieder einer Gemeinschaft abgeleitet werden können“ (Scharpf 1999: 16). Diese Idee ist auch als Legitimationskette bekannt, welche gewährleisten soll, dass jede politische Entscheidung auf die Zustimmung der (Mehrheit der) Bevölkerung zurückgeführt werden kann. In liberalen, repräsentativen DemokratienDemokratie ist diese Zustimmung jedoch notorisch indirekt; denn hier sind Entscheidungen dadurch legitimiert, dass sie entweder durch vom Volk gewählte Abgeordnete in Parlamenten oder durch (in parlamentarischen Demokratien wiederum von den Abgeordneten) gewählte Regierungen getroffen werden. Während somit allgemeine, gleiche und freie Wahlen auf Länder- und Bundesebene generell das zentrale Instrument der Input-Legitimation sind, können sie in konkreten Sachfragen nur wenig Klarheit über die Zustimmung der Bevölkerung schaffen. Dieses gilt insbesondere in Systemen wie dem der Bundesrepublik, in denen direktdemokratische Elemente wie Volksinitiativen und -entscheidungen nur in sehr begrenztem Rahmen möglich sind.
Da somit die Partizipation der von der Politik Betroffenen im Entscheidungsprozess nur gering ausgeprägt und auch aus praktischen Gründen nur begrenzt möglich ist, können → organisierte Interessen diese Legitimationslücke ein Stück weit füllen. Denn Interessenvertretung im politischen Prozess kann insofern Legitimation stiften, als dass → Verbände die Meinungen ihrer Mitglieder aggregieren und in den politischen Prozess einfließen lassen. Die Kommunikation mit → Interessengruppen dient so der Rückbindung der Politik an gesellschaftlichen Forderungen und Bedürfnisse und kann die Akzeptanz der Gesetzgebung erhöhen. Politische Interessenvertretung ist somit Teil des demokratischen Willensbildungsprozess und Interessengruppen können Repräsentationsmängel durch Parteien kompensieren (Richardson 1995), indem sie als „Transmissionsriemen“ gesellschaftliche Präferenzen ins politische System einspeisen. Zusammen mit den Parteien bilden Vereine, Verbände und andere organisierte Interessen die intermediäre Struktur demokratischer Gesellschaften, die zwischen Bürger:innen und Politik vermittelt (Mai 2013: 397f.).
Eine Regierung muss sich aber immer auch über ihre Politik und deren Folgen legitimieren. Nach der Output-Legitimation sind politische Entscheidungen dann legitim, wenn und weil sie das GemeinwohlGemeinwohl fördern (Scharpf 1999: 16), also Probleme lösen oder zumindest mindern, Wohlstand mehren und Konflikte befrieden. Anders formuliert: Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen müssen effektiv und effizient ihren Zweck erfüllen. Da Regierungen und Parlamente im konkreten Einzelfall oft recht wenig Kenntnisse haben über die Bereiche, die sie regulieren, benötigen sie für die Politikformulierung externe Informationen, etwa über zu lösende Probleme und die Effektivität und Auswirkungen bestimmter Maßnahmen. Lobbyismus stellt hierbei auch eine Unterstützung im Gesetzgebungsprozess dar (Hall/Deardorff 2006), denn organisierte Interessen können elementare → Informationen für eine effektive Gesetzgebung bereitstellen.
Was wird am PluralismusPluralismus kritisiert?
Die pluralistische Idee, dass eine effiziente und legitime Politik durch Wettstreit und Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Interessen entsteht, setzt eine Waffengleichheit der Interessen voraus. Auch der → NeopluralismusNeopluralismus als demokratietheoretischesDemokratietheorie Ideal geht davon aus, dass alle gesellschaftlich vorhandenen Interessen organisierbar sind und vertreten werden. Theoretisch haben so alle Akteure die gleichen Chancen auf Gehör (Lowery et al. 2015: 1226).
Kritiker:innen des Pluralismusmodells weisen jedoch darauf hin, dass in der Realität die → Ressourcen der unterschiedlichen Interessen, etwa von Arbeit und Kapital oder zwischen den Erzeuger:innen von Umweltschäden und Umweltschützer:innen, strukturell ungleich verteilt sind (Loer/Töller 2019). Aufgrund dieser Blindstellen, und weil sie keine analytischen Instrumente für Macht- und Herrschaftsmomente liefern konnte, geriet die Pluralismustheorie zunehmend in die Kritik (Speth 2010: 10). Die unterschiedlichen Klassen oder Schichten der Gesellschaft verfügen eben nicht über die gleichen Möglichkeiten, sich zu organisieren und sich Verhör zu verschaffen. Einige Interessen können sich nicht oder nur schwer organisieren, während mächtige und konfliktfähige → Interessengruppen sich besser durchsetzen und den Staat durchaus in die Defensive drängen können. Hierbei ist sich die Forschung weitgehend einig, dass einkommensstärkere Teile der Bevölkerung sich besser politisch organisieren können (Olson 1965; Lindblom 1977; Offe/Wiesenthal 1980).
Die schärfste Kritik an dieser normativen Idee des → Pluralismus hat wohl der US-amerikanische Politologe Elmer E. SchattschneiderSchattschneider, Elmer E. in seinem im Jahr 1960 erschienenen Buch „The semisovereign people. A realist’s view of democracy in America“ geäußert. Schattschneider stellte fest, dass das als pluralistisch geltende Interessengruppensystem der USA entgegen der Idee des Pluralismus de facto recht klein ist. Die Vorstellung, dass dieses System die gesamte Gesellschaft repräsentiert, entlarvte er als Mythos. Anstelle eines demokratischen Systems, in dem die vielfältigen, konkurrierenden → Interessen der Bürger:innen durch Interessengruppen umfassend repräsentiert werden, ist dieses System schief und unausgeglichen zugunsten einer Minderheit, und zwar den gebildetsten und bestverdienenden Mitgliedern der Gesellschaft. Die Klassenunterschiede zwischen denen, die in Interessengruppen organisiert und aktiv sind, und denen, die es nicht sind, sind noch größer als zwischen Wähler:innen und Nichtwähler:innen. Seine Kritik fasste er zu seiner vielzitierten Erkenntnis zusammen, dass „the flaw in the pluralist heaven is that the heavenly chorus sings with a strong upper-class accent“ (Schattschneider 1960: 35).
Wieso haben allgemeine und öffentliche Interessen größere Organisationsprobleme?
Eine andere Kritik an den Grundlagen, auf denen die pluralistische Idee fußt, verfasste der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Mancur OlsonOlson, Mancur. In seinem 1965 erschienen Buch „Logik des kollektiven Handelns“ argumentiert er, dass → Interessengruppen Probleme durch TrittbrettfahrenTrittbrettfahrerproblematik(free-riding) bekommen, und zwar, weil der Nutzen mancher von Interessengruppen erkämpfter Kollektivgüter allen zur Verfügung steht, da niemand von deren Nutzen ausgeschlossen werden kann. So können alle die von der Deutschen Umwelthilfe durch Fahrverbote erklagte bessere Luft atmen.
Olson sieht die Vorstellung des → Pluralismus (und gleichzeitig auch des Marxismus), dass sich Menschen an der Bereitstellung dieser Kollektivgüter gleichermaßen beteiligen, als illusorisch an. Denn wenn diese durch eine Gruppe bereitgestellt werden, kann es für einzelne Menschen rationaler sein kann, nicht im Sinne der Gruppe zu handeln, sondern den eigenen Nutzen zu maximieren. Olson formuliert hier ein gruppentheoretisches Paradoxon, dass gerade individuell rationales Handeln einem kollektiven Interesse entgegensteht. Denn wenn die Mitglieder einer Gesellschaft rational ihren eigenen Vorteil suchen, werden sie sich nicht für etwas einsetzen, welches andere für sie erkämpfen (Olson 1965).
Das klassische Beispiel sind → GewerkschaftenGewerkschaften. Wenn diese in Tarifverhandlungen Lohnerhöhung erstreiten, profitieren davon nicht nur Gewerkschaftsmitglieder, sondern alle Arbeitnehmer:innen in der jeweiligen Branche. Warum also sollten diese Gewerkschaften beitreten, wenn sie auch ohne Mitgliedsbeitrag die Vorteile genießen können? Auch wenn viele Menschen dennoch aus Sympathie und Solidarität Mitglied in Gewerkschaften sind, stellt dieses für sie ein reelles Problem dar.
Die verschiedenen Interessen sind nun in unterschiedlichem Ausmaß von diesem TrittbrettfahrerproblemTrittbrettfahrerproblematik





























