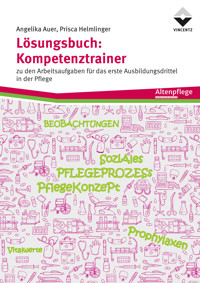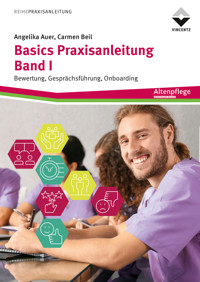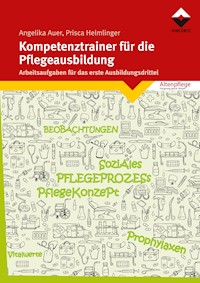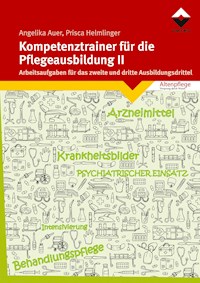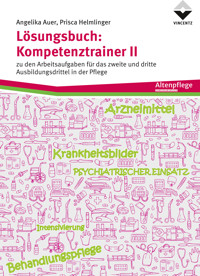
42,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vincentz Network
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Lösungen zum Kompetenztrainer für die Pflegeausbildung II. Das passende Lösungsbuch ist ein zeitsparendes Hilfsinstrument für Praxisanleiter:innen. Natürlich können auch Auszubildende die Antwortmöglichkeiten zur Kontrolle und Prüfungsvorbereitung nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Angelika Auer, Prisca Helmlinger
Lösungsbuch: Kompetenztrainer II
Arbeitsaufgaben für das zweite und dritte Ausbildungsdrittel in der Pflege
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Sämtliche Angaben und Darstellungen in diesem Buch entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens und sind bestmöglich aufbereitet.
Der Verlag und der Autor können jedoch trotzdem keine Haftung für Schäden übernehmen, die im Zusammenhang mit Inhalten dieses Buches entstehen.
© VINCENTZ NETWORK, Hannover 2024
Besuchen Sie uns im Internet: www.altenpflege-online.net
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne Weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um geschützte, eingetragene Warenzeichen.
Titelfoto: AdobeStock_kronalux (composing)
Autorinnen Fotos: Prisca Helmlinger; Foto Wöhrstein, Singen Angelika Auer; Foto Sabi&Ben Fotografie, Aldingen
E-Book ISBN 978-3-7486-0671-0
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
IPflegerelevante Grundlagen
Abführmittel
Beschwerdemanagement
Bilanzierung
Hemiplegie und Hemiparese
Krankheitsbild Apoplex
Krankheitsbild Parkinson
Kommunikation
Notfallsituationen
Pflegegrade
Positionierung
Schmerzerfassung
Schmerztherapie
Transurethrale Katheterisierung
IIBehandlungspflege
Drainagen
Intramuskuläre Injektion
Prä- und postoperative Pflege
Versorgung und Umgang Enterostoma
Versorgung und Umgang PEG (perkutane endoskopische Gastrostomie) und PEJ (perkutan endoskopische Jejunostomie)
Versorgung und Umgang Port
Versorgung und Umgang SPK (suprapubischer Katheter)
Versorgung und Umgang Tracheostoma
Versorgung und Umgang Transnasale Magensonde
Versorgung Wunden – Basiswissen
IIIArzneimittel
Arzneimittel Grundkenntnisse
Aufbewahrung Medikamente
Bedarfsmedikation
Infusionen
Insulinarten
Sauerstoffgabe
Verabreichen von Medikamenten
IVIntensivierung
Betäubungsmittel
Dialyse
Krankheitsbild Asthma bronchiale
Krankheitsbild COPD
Krankheitsbild Multiple Sklerose
Onkologische Therapieformen
Schichtleitung
Umgang mit Sterben und Tod – Erweiterung
Versorgung Wunden – Erweiterung
VPsychiatrischer Einsatz
Posttraumatische Belastungsstörung
Suchtkrankheiten – Erweiterung
Suizidalität
Umgang mit demenziell erkrankten Menschen – Erweiterung
Umgang mit depressiven Menschen
Umgang mit schizophrenen Menschen
Autorinnen
Vorwort
Liebe Pflegecommunity, zu Beginn möchten wir uns nochmals für die zahlreichen motivierenden Rückmeldungen zu unseren beiden Kompetenztrainern herzlich bedanken. Mit so viel positiver Rückmeldung aus allen Settings hatten wir bei Weitem nicht gerechnet. Herzlichen Dank!
Seit dem Beginn der neuen generalistischen Pflegeausbildung im Januar 2000 hat sich das Aufgabengebiet der Praxisanleiter:innen im Umfang enorm erweitert. Wir sind nach wie vor in unseren Einrichtungen mit der Umsetzung der neuen Ausbildung im theoretischen wie auch im praktischen Bereich beschäftigt. Darüber hinaus waren und sind wir in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv. Unter anderem haben wir im Landkreis einheitliche Ausbildungspläne mit erarbeitet, diskutieren die unterschiedlichen Herausforderungen und erörtern mögliche Lösungen.
Immer wieder wurde das Thema Arbeitsaufgaben in der Praxis hilfesuchend angesprochen, da vielen Einrichtungen die erforderlichen Ressourcen fehlen, woraufhin wir uns an die Erarbeitung der beiden Kompetenztrainer gemacht haben.
Uns liegt, wie Sie bereits wissen, eine ganzheitliche Pflegeausbildung am Herzen. Da wir überzeugt sind, dass nur aus einer allumfassenden Ausbildung handlungskompetente und motivierte Pflegefachkräfte hervorgehen können, haben wir uns nun auf vermehrte Nachfrage nach einem Lösungsbuch hin entschieden, diesem Wunsch nachzukommen.
Mit diesem Aufgabenbuch möchten wir allen praktischen Einrichtungen, Pflegeschulen, Praxisanleiter: innen sowie natürlich den Auszubildenden wieder ein hilfreiches, zeitsparendes Instrument an die Hand geben, das Sie bei der Nutzung der Arbeitsaufgaben unterstützen soll. Da die Arbeitsaufgaben im Kompetenztrainer beim Theorie-Praxis-Transfer vor allem die individuellen Gegebenheiten in Ihrer Einrichtung berücksichtigen sollen, können wir hier nicht alle Aufgaben beantworten.
Die Antworten im „allgemeinen Wissensteil“ werden wir möglichst umfangreich zusammenstellen. Die allumfängliche Bearbeitung der Themen würde aufgrund der verschiedenen Settings und Schwerpunkte den Umfang der geforderten Aufgabenbeantwortung überschreiten. Somit werden die hier aufgeführten Antworten begrenzt. Kurz gesagt: Aufgrund der umfangreichen Antwortmöglichkeiten wird hier nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die Antwortauswahl entspricht dem allgemeinen aktuellen pflegerischen und medizinischen Wissensstand im April 2024.
Um eine schnelle Übersicht und Zuordnung der Antworten zu gewährleisten, sind die Aufgaben wie in den Kompetenztrainern innerhalb der angebotenen Themenbereiche alphabetisch geordnet. Die Arbeitsaufgaben können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet und kontrolliert werden.
Die Lösungsbücher sind als zeitsparendes Hilfsinstrument, vor allem für Praxisanleiter:innen und Lehrer:innen gedacht. Natürlich können die verschiedenen Antwortmöglichkeiten auch von Auszubildenden zur Kontrolle ihrer Ausarbeitungen im allgemeinen Teil sowie als Informationssammlung zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden.
Angelika Auer, Prisca Helmlinger
IPflegerelevante Grundlagen
Abführmittel
Beschwerdemanagement
Bilanzierung
Hemiplegie und Hemiparese
Krankheitsbild Apoplex
Krankheitsbild Parkinson
Kommunikation
Notfallsituationen
Pflegegrade
Positionierung
Schmerzerfassung
Schmerztherapie
Transurethrale Katheterisierung
Abführmittel
Niveau:
2. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
I.2
I.3
II.2
III.2
V.2
Benennen Sie ausschlaggebende Stuhlbeobachtungskriterien, die Sie selbst tätigen bzw. der Dokumentation entnehmen können und auf deren Grundlage Sie entsprechende Maßnahmen einleiten.
Wie in vielen Bereichen der Medizin gibt es auch bei der Stuhlbeobachtung physiologische und pathologische Gründe für eine Veränderung des normalen beziehungsweise gesunden Stuhls.
Beschaffenheit
Zur Beschaffenheit des Stuhls gehören Menge, Form und Konsistenz. Der „normale“ Stuhl weist eine weiche, aber gut geformte Beschaffenheit auf. Die ausgeschiedene Menge ist ernährungsabhängig und beträgt bei einem erwachsenen Menschen ca. 120–300 g/Tag.
Ausscheidung größerer Mengen:
Physiologische Ursache: Ballaststoffreiche Ernährung
Pathologische Ursache: Störung des Nahrungstransports vom Darm in die Blut- und Lymphbahn
Eine bleistiftförmige Ausscheidung kann auf eine Stenose im Enddarm hinweisen.
Quelle: https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepaedagogik/20.1b_Stuhl_beobachten_und_kontrollieren.pdf
Farbe
Die „normale“ Farbe ist hell- bis dunkelbraun und entsteht überwiegend durch den enthaltenen Gallenfarbstoff.
Physiologische Veränderungen durch:
•Verschiedene Speisen: Z. B. färben Karotten den Stuhl orange, Spinat grün …
•Medikamente: Z. B. färben Eisen- oder Kohlepräparate den Stuhl schwarz.
Pathologische Veränderungen durch:
•Erkrankungen des Verdauungstraktes
•Grünlicher Stuhl, der mit heftigem Durchfall einhergeht, kann ein Zeichen für eine Salmonelleninfektion sein.
•Schwarzer Stuhl kann ein Anzeichen für verdautes Blut sein. Dieses Blut kommt meist aus dem oberen Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm).
•Erkrankungen anderer Organe, z. B. die Hyperbilirubinämie bei Neugeborenen, welche die Leber betrifft, können sich durch einen hellen, entfärbten Stuhl zeigen, da der Gallenfarbstoff fehlt.
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/symptome/gelbsuchtikterus-740463.html
Geruch
Der „normale“ Stuhlgeruch ist nicht übermäßig übel riechend.
Physiologische Einflussfaktoren: Aufgenommene Nahrung und die Verweildauer im Darm. So führt eine kohlenhydratreiche Ernährung eher zu einem säuerlichen Geruch.
Pathologische Veränderung:
FäulnisdyspepsieGeruch faulig-jauchig und die Farbe tiefbraun.
Quelle: https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepaedagogik/20.1b_Stuhl_beobachten_und_kontrollieren.pdf
Definieren Sie die Begrifflichkeit Laxantien.
Laxantien werden umgangssprachlich auch als Abführmittel bezeichnet. Es sind Medikamente, die zu einer schnelleren Stuhlausscheidung führen sollen. Viele Laxantien sind rezeptfrei in der Apotheke oder auch in Drogerien erhältlich.
Nennen Sie fünf verschiedene Laxantien, die der ärztlichen Anordnung bedürfen. Beschreiben Sie die jeweilige Wirkungsweise. Markieren Sie die Präparate, die in Ihrem Arbeitsumfeld eingesetzt werden.
Laxantien
Wirkungsweise
Movicol
Der Wirkstoff Macrogol bindet Wasser im Stuhlbrei, sodass der Stuhl aufgeweicht und das Stuhlvolumen erhöht wird. Dadurch wiederum wird die Darmbewegung angeregt und das Abführen erleichtert. Die Wirkweise von Movicol gilt als sanft und soll wenige Nebenwirkungen mit sich bringen.
Quelle: https://movicol.de/bei-verstopfung/#so-wirkt
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist unerlässlich, da die Wirkung sonst kontraproduktiv ausfallen wird.
Lactulose
Lactulose gehört zu den osmotisch wirksamen Laxantien. Die Wirkung entsteht durch zwei Mechanismen: Der enthaltene Zucker und die enthaltenen Säuren führen zu einer osmotischen (einseitige Wanderung von Flüssigkeit durch eine halbdurchlässige Membran) Wasserretention (verminderte Wasserausscheidung). Dadurch nimmt das Volumen des Koloninhaltes zu, wodurch indirekt die Darmperistaltik angeregt wird. Die Säuren sollen zudem einen direkt stimulierenden Effekt auf die Darmperistaltik haben.
Darüber hinaus besitzt Lactulose eine ammoniaksenkende Wirkung, weshalb es auch bei portokavaler Enzephalopathie eingesetzt wird.
Quelle: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Lactulose_819
Das Medikament darf bei einer bekannten Laktose-Unverträglichkeit nicht eingesetzt werden!
Microlax
Die Microlax-Lösung wird dem Stuhl direkt über den After in Form eines Microklistiers zugefügt. Ein Netzmittel sorgt dafür, dass die Oberfläche des harten Stuhls aufgeweicht wird. Die Wirkstoffe können auf den harten Stuhl einwirken und setzen das dort gebundene Wasser frei, wodurch der Stuhl weich und geschmeidig wird. Der aufgeweichte Stuhl vergrößert dadurch sein Volumen, wodurch die Rezeptoren der Darmwand aktiviert werden. Diese wiederum geben das Signal zur Ausscheidung.
Quelle: https://www.microlax.de/ueber-microlax/microlax-wirkweise
Freka-Clyss
Freka-Clyss ist eine Einlaufflüssigkeit (Makroklistier120ml) zur Entleerung des Darmes. Freka-Clyss wirkt lediglich auf die unteren, aber nicht auf die oberen Darmabschnitte ein. Mit dem Wirkungseintritt ist nach ca. 10–20 min. zu rechnen. Es eignet sich somit speziell in Fällen, wo orale Abführmittel nicht angebracht sind oder zu Reizungen führen können. Beispielsweise zur Vorbereitung bei Darm-Röntgenuntersuchungen …
Das Medikament darf bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden, tödlicher Ausgang möglich!!!!
Quelle: https://www.fresenius-kabi.com/de/medizinprodukte/freka-clyss
Dulcolax Zäpfchen
Dulcolax Zäpfchen werden in den After eingeführt und wirken direkt im Enddarm. Mit Wirkungseintritt wird zum einen die Eigenbewegung des Dickdarms gefördert. Zum anderen wird der Flüssigkeitsgehalt im Darm erhöht und so die Stuhlkonsistenz aufgeweicht, wodurch für eine Erleichterung bei Obstipation gesorgt werden kann.
Quelle: https://www.dulcolax.com/de-de/produkte/dulcolax-zaepfchen
Wählen Sie nach Rücksprache mit der Praxisanleitung drei zu pflegende Menschen aus, die Laxantien ärztlich verordnet bekommen haben.
Nennen Sie den jeweiligen Handelsnamen der Präparate die angeordnete Dosierung und den individuell zu erwartenden Wirkungseintritt des Medikamentes nach der Verabreichung.
Diese Aufgabe kann nur vor Ort in der jeweiligen Einrichtung bearbeitet werden. Beispielhaft werden hier mögliche Antworten angegeben.
Handelsname
Dosierung
Wirkungseintritt
Person 1
Dulcolax Zäpfchen
Laut Hersteller können Dulcolax Zäpfchen zu jedem beliebigen Zeitpunkt eingenommen werden.
In diesem bespielhaften Fall erfolgt die Dosierung im Bedarfsfall bei ausbleibendem Stuhlgang > als 48 Stunden.
Bedarfsmedikation:1 Zäpfchen/24 Std.
Schneller Wirkungseintritt nach ca. 15–30 Minuten.
Quelle: https://www.dulcolax.com/de-de/produkte/dulcolax-zaepfchen
Person 2
Lactulose-ratiopharm Sirup
Lactulose-ratiopharm Sirup muss je nach Anwendungsgebiet unterschiedlich dosiert werden. Empfohlene Dosierung laut Hersteller:
Erwachsene: 1- bis 2-mal täglich 7,5–15 ml Lactulose-ratiopharm Sirup (entsprechend 5 bis 10 g Lactulose).
Kinder: 1- bis 2-mal täglich 4,5–9 ml Lactulose-ratiopharm Sirup (entsprechend 3 bis 6 g Lactulose).
Es bedarf einer geraumen, oft von Patient zu Patient unterschiedlichen Zeit nach der Einnahme bis zum Wirkungseintritt. So kann die abführende Wirkung von Lactulose-ratiopharm Sirup bereits nach 2 bis 10 Stunden eintreten, es können aber auch ein bis zwei Tage bis zum ersten Stuhlgang vergehen. Besonders bei noch ungenügender Dosierung kann sich der gewünschte Wirkungseintritt verzögern.
Quelle: https://www.ratiopharm.de/produkte/details/praeparate/praeparatedaten/detail/pzn-4916859.html
Person 3
Microlax
Microlax kann über einen kurzfristigen Zeitraum täglich verwendet werden, ist jedoch nicht für eine Langzeitbehandlung vorgesehen. Bei langfristiger täglicher Verstopfung sollte ein/eine Arzt/Ärztin zur Ergründung der Ursache und zur weiteren Therapieplanung aufgesucht werden.
In diesem beispielhaften Fall erfolgt die Gabe von Microlax 2-mal wöchentlich (Montag und Donnerstag).
Laut Hersteller ist eine Wirkungseintritt 5–20 Minuten nach der Einnahme zu erwarten.
Quelle: https://www.microlax.de/ueber-microlax/microlax-wirkweise
Erläutern Sie drei weitere nicht medikamentöse Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die Darmtätigkeit anzuregen.
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr:
Viel trinken hilft in diesem Fall auch viel, sofern keine ärztliche Begrenzung beispielsweise bei Nieren-/Herzerkrankungen gesetzt wurde. Wird zu wenig Flüssigkeit aufgenommen, entzieht der Körper dem Stuhlbrei im Colon entsprechend mehr Wasser.
Dies führt dazu, dass der Darminhalt sehr fest und hart werden kann und sich so sehr langsam im Darm Richtung Anus vorwärtsbewegt. Prophylaktisch wird empfohlen, bereits morgens auf nüchternen Magen ein Glas Wasser zu sich zu nehmen. Als ideale Trinkmenge gilt ein Richtwert von 30–40 ml pro Kg Körpergewicht täglich.
Körperliche Aktivität:
Jede Art der Bewegung und jede zusätzliche körperliche Anstrengung aktiviert den Stoffwechseln und regt die Darmtätigkeit an. Das Ausmaß der Bewegung sollte dem Gesundheitszustand, den Ressourcen sowie dem Alter des zu pflegenden Menschen angepasst werden.
Position bei der Stuhlentleerung anpassen:
Die sitzende Haltung auf der Toilette ist anatomisch betrachtet nicht die beste Möglichkeit für eine leichte Stuhlentleerung. Ein leichtes Anheben/Anziehen der Knie hingegen (auf der Toilette sitzend, einen Hocker unter sie Füße stellen) kann den Ausscheidungsvorgang erleichtern. Diese Position sorgt dafür, dass sich der letzte Darmabschnitt streckt und der Schließmuskel leicht öffnet. So kann während der unterstützten Ausscheidung schmerzhaftes Pressen vermieden werden. Ein positiver Nebeneffekt ist zusätzlich, dass durch die Reduzierung der Pressintensität die Bildung von Hämorrhoiden positiv beeinflusst werden kann.
Gründlich kauen ohne Zeitdruck:
Die Verdauung beginnt bereits im Mund. Durch das Kauen wird die Nahrung zerkleinert.
Der Speichel macht den Nahrungsbrei weicher, breiiger und mengt der Nahrung Enzyme bei, die anfangen die Nahrung aufzuspalten. Durch das vorausgehende gründliche Kauen kommt die Nahrung bereits stark zerkleinert im Magen an, wodurch keine großen Nahrungsstücke mehr aufgespalten werden müssen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass durch gründliches Kauen das Schlucken von Luft minimiert wird und ein lästiges Völlegefühl oder auch Blähungen vermieden werden können.
…
Als „Einlauf“ wird das Einführen einer Flüssigkeit über den Anus in den Darm bezeichnet. Dies wird zur Behebung einer Obstipation oder zur Darmreinigung, beispielsweise während dem Heilfasten, angewendet. Hierzu gehören Mikro- und Makroklistiere sowie der Hebe-Senk-Einlauf.
Einlaufart
Charakterisierung
Mikroklistier
Ein Mikroklistier ist eine Tube mit Kunststoffrohr. Es ist nur zum einmaligen Gebrauch gedacht. Damit wird eine kleine Menge Flüssigkeit (durchschnittlich ca. 5 ml) in das Rektum eingebracht. Diese Lösung fördert die Stuhlentleerung, indem chemische Reize auf die Darmschleimhaut ausgeübt werden (durch Glyzerine und Salze). Dies steigert beispielsweise die Sekretion der Darmwand.
Quelle: https://www.microlax.de/ueber-microlax/microlax-wirkweise
Makroklistier
Das Makroklistier wird auch Klysma genannt. Es besteht aus einem Quetschbeutel, der mit einem dünnen, ca. 15 cm langen Plastikröhrchen verbunden ist. Auch das Makroklistier ist nur zur einmaligen Anwendung vorgesehen.
Quelle: https://www.fresenius-kabi.com/de/medizinprodukte/freka-clyss
Das hierbei verwendete Flüssigkeitsvolumen, welches rektal eingeführt wird, beträgt ca. 120 ml/130 ml (diese Angabe kann je nach Hersteller abweichen).
Hebe-Senk-Einlauf/Darmspülung
Über ein Darmrohr, welches über einen Schlauch mit einem Flüssigkeitsbehälter verbunden ist, werden zwischen 200–1500ml (Norm 500 ml) Flüssigkeit in den Darm eingeführt. Anschließend wird der Flüssigkeitsbehälter gesenkt, damit die Flüssigkeit zurück in den Behälter fließen kann. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt. Dieses Verfahren wird meist bei bestehender Obstipation zur Stuhlentleerung oder präoperativ zur Darmreinigung angewandt.
Da diese Prozedur den Kreislauf sehr belasten kann sollte ein zu pflegender Mensch nach Möglichkeit während der Maßnahmendurchführung mit angewinkelten Beinen auf der linken Körperseite positioniert werden. Ein weiterer Aspekt der Positionierung auf der linken Körperhälfte liegt in der Anatomie des Darmes, da somit der Enddarm nach unten gerichtet ist.
Kontraindikationen sind:
•Herz-Kreislauf-Erkrankungen
•Niereninsuffizienz
•Nach Darmoperationen
•Blutungen im Magen-Darm-Trakt oder ein akutes Geschehen im Bauchraum
•Verdacht oder diagnostizierter mechanischer Darmverschluss
•Bekannte frühe Schwangerschaft
•Drohende Frühgeburt
Quelle: https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepaedagogik/27.1_Darmeinlaeufe.pdf
Beobachten Sie nach Möglichkeit eine Fachkraft bei der Verabreichung eines Klistiers. Notieren Sie die einzelnen Handlungsschritte stichpunktartig, berücksichtigen Sie dabei die chronologische Reihenfolge und das vorherige Aufklärungsgespräch.
Diese Aufgabe ist einrichtungsintern nach Vorgaben des Hausstandards durchzuführen. Ein Aufklärungsgespräch kann hier nicht wiedergegeben werden. Wichtige Inhalte des Aufklärungsgespräches wären unter anderem:
•Grund der Indikation
•der genaue Ablauf der Maßnahme
•die Wirkweise
•mögliche Komplikationen
•Verhaltensanweisungen für den zu Pflegenden (beispielsweise Versuch, die Flüssigkeit über einen Zeitraum von einigen Minuten nicht auszuscheiden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen)
•Sollte das Klistier aufgrund einer Obstipation verabreicht werden, sollte der zu pflegende Mensch zusätzlich noch über obstipationsprophylaktische Maßnahmen aufgeklärt werden, um eine erneute Indikation eines Klistiers zu vermeiden (eine regelmäßige Obstipationsbehandlung mit einem Klistier ist nicht empfehlenswert und sollte möglichst vermieden werden)
Einzelne Handlungsschritte bei der Verabreichung eines Klistiers:
•Sicherstellen, dass die Verabreichung eines Klistiers ärztlich angeordnet ist. Abgleichen des verordneten mit dem vorhandenen Präparat. (In Einrichtungen der stationären Langzeitpflege ist dies oft unter Bedarfsmedikation verordnet. In ambulanten Einrichtungen wird es zusätzlich oft in Akutsituationen als Einmalverordnung ausgestellt).
•Zu pflegenden Menschen über die bevorstehende Pflegeintervention informieren, aufklären, wie oben beschrieben, und die Erlaubnis zur Durchführung einholen.
•Für Sichtschutz sorgen und Intimsphäre wahren, Fenster schließen, Durchzug vermeiden, Zimmertemperatur beachten.
•Alle benötigten Materialien bereitstellen (nach Hausstandard). Zu empfehlen sind folgende Materialien: Handdesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, wasserdichte Unterlage wie beispielsweise ein Geritex oder besser eine Einmalunterlage, Vaseline, Klistier, Mülleimer, ausreichend Zellstoff, im Bedarfsfall frisches Inkontinenzmaterial. Steckbecken oder Toilettenstuhl in erreichbarer Entfernung halten.
•Sollte der zu pflegende Mensch kognitiv und körperlich dazu in der Lage sein und die Pflegeintervention eigenständig durchführen wollen, muss er über die genaue Anwendung aufgeklärt und beraten werden. Die Klingel sollte in Reichweite angebracht sein. Während der Intervention wird die Intimsphäre des zu pflegenden Menschen gewahrt, indem er allein gelassen wird.
•Bett auf Arbeitshöhe stellen.
•Hygienische Handdesinfektion durchführen und Handschuhe anziehen.
•Eine wasserdichte Unterlage auf das Bett legen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
•Für gute Lichtverhältnisse sorgen, um die Maßnahme sicher durchführen zu können.
•Den zu pflegenden Menschen bitten, den Unterkörper zu entkleiden und sich auf die linke Körperhälfte zu positionieren, ggf. bei immobilen zu pflegenden Menschen die Unterkörperentkleidung übernehmen und den zu Pflegenden in die gewünschte Position bringen. Die Intimsphäre und der Erhalt der Körpertemperatur müssen zu jedem Zeitpunkt gewahrt werden.
•Das Klistier auf Körpertemperatur anwärmen, evtl. im Vorfeld dem zu Pflegenden bereits in die Hand geben oder Makroklistier in einem körperwarmen Wasserbad temperieren.
•Behälter vor Gebrauch je nach Herstelleranweisung schütteln bzw. den Beutel gut durchkneten (bei Fragen oder Unklarheiten im Vorfeld in der Apotheke anrufen bzw. Arzt/Ärztin kontaktieren).
•Die Analregion auf Verletzungen bzw. krankhafte Veränderungen untersuchen. Sollten diesbezüglich Auffälligkeiten vorhanden sein, muss die Intervention abgebrochen und ein Arzt/eine Ärztin kontaktiert werden.
•Die Verschlusskappe des Klistiers öffnen (darauf achten, dass keine scharfen Kanten an der Öffnung entstehen).
•Das dünne Ansatzrohr mit Vaseline einfetten, um ein möglichst schmerzfreies und leichtes Einführen in den Anus zu gewährleisten.
•Gesäßhälften auseinanderschieben, um eine bessere Sicht auf den Anus zu haben.
•Das Rohr des Klistiers (bei einen Makroklistier etwa 7–10 cm) in den Enddarm einführen. Beim Einführen des Rohres darf auf keinen Fall gegen Widerstände geschoben werden. Sinnvoll ist es in diesem Fall, das Rohr einige Zentimeter zurückzuziehen und es erneut zu versuchen. Ein gewalttätiges Einführen des Rohres kann zu Verletzungen (DarmdurchbruchPerforation) führen und ist unbedingt zu vermeiden.
•Sollte der zu pflegende Mensch Schmerzen äußern, ist die Anwendung abzubrechen.
•Vorsichtig die Flüssigkeit aus der Tube herausdrücken (beim Makroklistier den Beutel zum Anus hin aufrollen, bis er komplett entleert ist).
•Den zu pflegenden Menschen anhalten, die Flüssigkeit nach Möglichkeit für einige Minuten nicht auszuscheiden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Das Rohr im Anschluss vorsichtig aus dem Anus herausziehen (währenddessen die Tube des Mikroklistiers/den Beutel des Makroklistiers unbedingt zusammengedrückt halten, damit die Flüssigkeit nicht wieder aufgesogen werden kann) und direkt wegwerfen.
•Bei Säuglingen oder Kleinkindern (keine Anwendung von Makroklistieren!) sollten die Pobacken etwas zusammengedrückt werden, um das Ausscheiden der Flüssigkeit hinauszuzögern.
•Den zu pflegenden Menschen, je nach Krankheitsbild und körperlicher Verfassung, auf die Toilette bzw. den Topfstuhl transferieren, das Steckbecken reichen oder eine Inkontinenzversorgung mit einem geschlossenen Einlagensystem durchführen.
•Nach dem Stuhlgang Intimpflege durchführen. Anschließend Materialien versorgen und die Arbeitsflächen desinfizieren.
•Zimmer lüften und sich von dem zu pflegenden Menschen verabschieden.
•Dokumentation der Maßnahme und des Ergebnisses. Evtl. weitere Rücksprache mit dem Arzt/der Ärztin, falls dieses erforderlich ist.
Lesen Sie den internen Hausstandard zu diesem Thema durch und ergänzen Sie Ihre Notizen.
Diese Aufgabe kann hier nicht bearbeitet werden, da Sie vom jeweiligen Hausstandard abhängig ist.
Erläutern Sie folgende Aussagen.
Aussagen
Erläuterung
Das Klistier muss vor dem Verabreichen kurz angewärmt werden.
Die zu verabreichende Flüssigkeit sollte im Vorfeld unbedingt richtig temperiert sein. Ideal ist ein Verabreichen bei Körpertemperatur (ca. 36–37°C), um Komplikationen zu vermeiden. Zu warme Flüssigkeit kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Ist die Flüssigkeit zu kalt, können Krämpfe ausgelöst werden. Das Klistier vor der Verabreichung in ein warmes Wasserbad zu legen reicht zur Erwärmung vollkommen aus. Es kann auch dem zu Pflegenden während der weiteren Vorbereitung zum Erwärmen in die Hand gegeben werden.
Der zu pflegende Mensch muss während dem Verabreichen des Klistiers/des Einlaufs auf der linken Körperseite positioniert werden.
Liegt der zu pflegende Mensch auf der linken Seite, ist es aufgrund des anatomischen Verlaufs des Darms einfacher, die Flüssigkeit an dem gewünschten Zielort zu applizieren. Die Flüssigkeit kann so viel besser in den Darm laufen, da es „bergab“ geht, und der Wirkstoff gelangt besser an den Ort, an dem er wirken soll. Des Weiteren wird der Herz-Kreislauf durch die beschriebene Position entlastet.
Quelle: https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_pflegepaedagogik/27.1_Darmeinlaeufe.pdf
Mit der Zeit muss die Dosierung der Laxantien erhöht werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. So kann der zu pflegende Mensch unbemerkt in eine Abhängigkeit rutschen.
Bei einer langfristigen Laxantieneinnahme besteht die Gefahr, dass sich der Körper an die Präparate gewöhnt. Um eine konstante Stuhlentleerung zu sichern, müssen betroffene Personen die Dosis ständig erhöhen. Laxantien sind frei auf dem Markt verkäuflich, sodass sich der zu pflegende Mensch diese selbst, ohne ärztliche Anordnung, besorgen kann. Die Einnahme erfolgt in den meisten nicht stationären Einrichtungen in Eigenverantwortung. Pflegekräfte und Ärzte bekommen dies oft erst mit, wenn die typischen Symptome einer Laxantienabhängigkeit auftreten. Hierzu gehören beispielsweise Diarrhoe, Blähungen, leichte Bauchkrämpfe. Auch gravierende Symptome wie Herzrhythmusstörungen oder Blasenlähmungen etc. können auftreten. In stationären Einrichtungen sollte die Pflegekraft immer aufmerksam werden, sobald zu pflegende Menschen häufiger und in geringeren Abständen nach Abführmitteln verlangen.
Laxantien sollten nie abrupt abgesetzt werden. Die schrittweise Entwöhnung muss der Dauer und der Dosierung der vorherigen Einnahme angepasst sein.
Wurden Laxantien über einen kurzen Zeitraum eingenommen, können sie ohne Probleme wieder abgesetzt werden. Obstipationsprophylaktische Maßnahmen sollten allerdings nach dem Absetzen zwingend Anwendung finden, um die Gefahr einer Obstipation zu minimieren. Besteht der Konsum über einen längeren Zeitraum, gestaltet sich das Absetzen schwieriger. Der Darm hat sich an die zusätzliche Unterstützung durch Laxantien gewöhnt und benötigt seine Zeit, um wieder in Schwung zu kommen und die Ausscheidung selbstständig durchführen zu können. Eine gefürchtete Komplikation hierbei ist der Ileus. In diesem Fall ist die Reduktion der Dosierung und der Häufigkeit der Laxantieneinnahme sowie die Umstellung auf weniger darmreizende Mittel die beste Möglichkeit. Das langsame Ausschleichen bis hin zum kompletten Absetzen sollte in Beratungs- und Aufklärungsgesprächen mit den betroffenen Personen fokussiert werden und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
Beschreiben Sie der Praxisanleitung den chronologischen Ablauf der Maßnahme „Verabreichen eines Klistiers“. Erläutern Sie die Schwerpunkte des Aufklärungsgespräches, das vor der Durchführung der Maßnahme mit dem zu pflegenden Menschen geführt werden muss.
Diese und die folgende Aufgabe können hier nicht beantwortet werden, da diese in der Einrichtung selbst durchzuführen sind.
Verabreichen Sie, nach Möglichkeit unter Aufsicht der Praxisanleitung, einem zu pflegenden Menschen ein Klistier. Beginnen Sie die Maßnahme mit dem Aufklärungsgespräch.
Reflektieren Sie im Nachgang Ihre Art der Umsetzung dieser Maßnahme.
Beschwerdemanagement
Niveau:
2. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
II.1
II.2
II.3
III.1
IV.1
V.1
V.2
Lassen Sie sich das hausinterne Beschwerdemanagement erläutern und machen Sie sich Notizen zu den Vorgaben.
Diese Aufgabe ist einrichtungsspezifisch und kann hier nicht beantwortet werden.
Erarbeiten Sie Verhaltensregeln, mit denen Sie Ihrem Gegenüber vermitteln können, dass Sie das Anliegen ernst nehmen und seine Wahrnehmung respektieren.
Arbeiten Sie in der folgenden Tabelle empfehlenswertes und zu vermeidendes Verhalten heraus.
Wertschätzendes, respektvolles Verhalten
Abwertendes, provozierendes Verhalten
•Gegenüber ausreden lassen.
•Respektvoll gegenübertreten, auch wenn der Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin einen anderen Standpunkt vertreten sollte.
•Wertschätzung und Empathie zeigen.
•Authentisches Auftreten durch übereinstimmende verbale und nonverbale Kommunikation.
•Die Beziehung zu den anderen Personen, welche am Gespräch beteiligt sind, so gestalten, dass alle Parteien davon profitieren.
•Zufriedenheit schaffen.
•Auf Augenhöhe kommunizieren.
•Aktives Zuhören:Aussage des Gegenübers zusammenfassen, um Missverständnisse zu vermeiden. Aufmerksamkeit zeigen.
•Die Gesprächspartner beobachten und Gefühle wahrnehmen, ohne diese zu bewerten.
•Alternative Lösungen finden, sofern dieses möglich ist.
•Klare und konkrete Bitten äußern.
•Blickkontakt halten.
•Ich-Botschaften nutzen.
•…
•Ins Wort fallen.
•Aussagen oder Verhaltensweisen des Gesprächspartners beurteilen.
•Den Gesprächspartner bewerten und beurteilen.
•Beleidigungen äußern.
•Interpretation der Aussagen des Gegenübers.
•Einsatz von Du-Botschaften/Schuldzuweisungen.
•Auf zurückliegenden Forderungen beharren.
•Laut werden bis hin zum Schreien, sich im Ton vergreifen.
•Aggressives Auftreten.
•Während dem Gespräch Desinteresse vermitteln durch beispielsweise nonverbale Kommunikation oder Nachäffen.
•Augen verdrehen.
•Nutzung des Mobiltelefons.
•Demonstratives Nicht-Zuhören.
•Das Gegenüber auslachen.
•Böse Absichten unterstellen.
•Übersteigerte Äußerungen (z. B. „Nie lassen Sie mich ausreden“ oder „Das ist typisch für Sie! Immer die gleichen Ausreden“).
•…
Erstellen Sie eine Auflistung von weiteren abwertenden Verallgemeinerungen, kränkendem Verhalten sowie beleidigenden Äußerungen und erarbeiten Sie für sich jeweils mögliche Reaktionen und Aussagen, mit denen Sie die Situation von der emotionalen Ebene wieder auf die sachliche Ebene lenken können. Diskutieren Sie Ihre Ausarbeitung im Team.
Die Diskussion im Team kann hier nicht wiedergegeben werden. Mögliche Antworten können sein:
Provokationen, abwertendes Verhalten, Drohungen …
Lenkende Lösungsansätze
Wenn nicht gleich …/… dann
1.„Sie müssen die Anmeldeunterlagen bis Montag ausgefüllt zurückschicken.“
•Das Wort „müssen“ produziert immer Zwang und führt beim Gesprächspartner zu Unmut und Unlust.
2.„Es ist zwar möglich, aber …“
•Das Wort „aber“ verkörpert immer einen Widerspruch in der Aussage.
3.Ins Wort fallen, den Gesprächspartner unterbrechen.
4.„Wenn Sie das nicht gleich zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigen, werde ich Ihren Chef darüber in Kenntnis setzen.“
5.„Wenn du noch einmal …., bringe ich dich um“
•Drohungen
Ich-Botschaften als Feedback
1.„Sie können die Anmeldeunterlagen bis Sonntag gerne vollständig bearbeiten. Bitte senden Sie sie bis Montag an uns zurück.“
a)Diese harte Ausdrucksweise kann mit einem kleinen Trick softer formuliert werden.
2.„Alternativ könnte ich Ihnen … anbieten“
a)Widersprüche vermeiden und die Wirkung entschärfen.
3.„Wir lassen andere ausreden und hören uns gegenseitig zu.“
•Das gewünschte Verhalten nicht als Verbot, sondern als Gebot formulieren.
4.Auf Erpressungen nicht eingehen, Führungsebene zeitnah über Vorkommnisse in Kenntnis setzen, damit die verantwortlichen Personen direkt adäquat auf mögliche Beschwerden reagieren können.
5.Abstand schaffen zu der Person, die in diesem Augenblick ihre Aggressionen auslebt.
6.„Hören Sie auf mit Ihrer Besserwisserei!“
•Befehle und Forderungen
7.„Was Sie da sagen, stimmt überhaupt nicht!“
•Widersprechen
8.„Wie können Sie nur so fahrlässig und verantwortungslos arbeiten?“
•Urteilen
9.…
6.Wertschätzung zeigen
•Jeder Mensch möchte wertschätzend behandelt werden. Wenn das Gegenüber wertschätzend behandelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dies im Laufe des Gespräches auch umsetzt.
7.„Welche Möglichkeiten sehen Sie, um diese Meinungsverschiedenheit zu klären?
•Offene Fragen stellen hilft dabei, mehr über die eigentlichen Beweggründe in Erfahrung zu bringen. Das Gespräch kann so durch gezielte Fragen gelenkt werden und der Gesprächspartner fühlt sich ernst genommen.
8.„Die Vitalzeichen liegen alle im Normbereich, der Patient äußert/gibt seit gestern Schmerzen im Oberschenkel an. Bitte kontaktieren Sie morgen den Hausarzt.“
•Klare Beobachtungen formulieren und Bewertungen vermeiden
9.…
Formulieren Sie die Zielsetzung von Ich-Botschaften und beschreiben Sie die einzuhaltenden Regeln, die bei der Formulierung berücksichtigt werden müssen, …
Zielsetzung:
Ich-Botschaften verfolgen das Ziel, Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Sie sollen ein positives Gesprächsklima fördern und deeskalierend wirken, indem der Fokus auf die eigene Person gelenkt wird. Eigene Gefühle und Gedanken werden vom Sender zum Ausdruck gebracht. Der Empfänger erhält so die Möglichkeit, die Gefühlswelt des Senders zu verstehen und über das eigene Handeln nachzudenken. Konfliktsituationen sollen so entschärft bzw. vermieden werden.
Formulierungsregeln:
Ich-Botschaften sind nicht automatisch Ich-Botschaften nur, weil ein Satz mit „Ich“ anfängt. Versteckte Du-Botschaften sind zu vermeiden.
Beispiel: „Ich mag es nicht, dass du jeden Tag eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kommst!“
Wichtig bei Ich-Botschaften ist, dass sich die andere Person nicht in eine Ecke gedrängt fühlt. Der Fokus muss auf den eigenen Empfindungen des Senders der Ich-Botschaft liegen. Eigene und persönliche Eindrücke und Empfindungen werden wiedergegeben, Wünsche und Gefühle werden geäußert. Durch die Selbstoffenbarung in einer Ich-Botschaft bildet sich eine Gesprächsgrundlage, die der am Gespräch beteiligten Person die Möglichkeit gibt, sich ebenfalls emotional zu öffnen.
Um eine richtige Ich-Botschaft zu formulieren, ist es also wichtig, dass das „Ich“ zu Beginn des Satzes steht. Anschließend werden die Beobachtung bzw. der Sachverhalt genannt, eigene Gefühle offenbart, ohne die Gesprächspartner anzugreifen. Der Wunsch der Veränderung kann innerhalb der Aussage formuliert, oder in den weiteren Verlauf des Gespräches eingebettet werden.
Beispiel: „Ich habe aktuell zwei Krankmeldungen (Wiedergabe der Situation), deswegen fühle ich mich aktuell unter Druck und überfordert (persönliches Empfinden), wenn der Dienst nicht pünktlich von allen Mitarbeiter:innen angetreten wird.“
Sammeln Sie über den Zeitraum von einer Woche Themen, über die man sich innerhalb Ihres Arbeitsumfeldes beschwert hat. Sie können aktuelle Beschwerden notieren, aber auch Erfahrungen Ihrer Kolleg:innen abfragen.
Diese Aufgabe ist individuell und hängt von den Gegebenheiten in den jeweiligen Einrichtungen ab. Mögliche Beschwerdemöglichkeiten könnten sein:
Durch Arbeitskolleg:innen:
•Der gleiche Kollege ist nach seinem freien Wochenende immer für weitere zwei Tage krank.
•Es sind immer die gleichen Pflegekräfte, die wirklich arbeiten, während andere nur im Büro sitzen und Kaffee trinken.
•Wir haben keine Zeit für eine umfangreiche strukturierte Praxisanleitung.
•Immer wenn ich den Dienst starte, muss ich tanken gehen, da meine Kolleg:innen nicht darauf achten, dass der Sprit langsam zu Ende geht (ambulante Versorgungsbereiche).
Durch Vorgesetzte:
•Die Pflegekräfte machen zu viel Pause, deshalb wird die Arbeit nicht vollständig/gewissenhaft erledigt.
•Die Pflegedokumentation ist lange nicht überarbeitet worden. Wenn der MD (früher MDK) ins Haus kommt, hat die Einrichtung ein Problem.
•Die neue Personalbemessungsgrenze nach Rothgang stürzt uns noch weiter in den Abgrund.
•Die Forderungen der Mitarbeiter:innen sind überzogen, wie sollen die zusätzlichen Mehrkosten getragen werden?
Durch Auszubildende:
•Ich bekomme keine Praxisanleitung. Die geforderte Praxisanleitung von 10 % wird nicht durchgeführt, sondern nur unterschrieben.
•Ich muss an den Wochenenden im Schulblock arbeiten, obwohl ich meine Sollarbeitszeit durch den Unterricht erfüllt habe.
•Ich kann an der praktischen Einsatzstelle nicht nach theoretischem Standard arbeiten.
•Ich habe keine festen Ansprechpartner:innen oder Praxisanleitungen, die ich bei Fragen kontaktieren könnte.
Durch Angehörige:
•Mein Vater wird nicht mobilisiert, er liegt den ganzen Tag allein im Zimmer in seinem Bett und starrt an die Wand.
•Der Hausarzt sollte dringend vorbeischauen, das wird hier nie organisiert.
•Der Zimmerboden wird nicht richtig geputzt. Unter dem Bett meiner Mutter ist eine ganz dicke Staubschicht.
Durch zu pflegende Menschen:
•Das Frühstück ist auch jeden Tag das Gleiche. Immer gibt es nur Brötchen mit Wurst, Käse, Honig, Marmelade, …
•Das Mittagessen ist geschmacklich schlecht. Die Auswahl zwischen drei verschiedenen Menüs ist definitiv zu wenig.
•Ich muss auf die Toilette und niemand hilft mir.
•Keiner hat Zeit für mich.
Erstellen Sie aus den gesammelten Beschwerden ein Ranking. Notieren Sie die drei häufigsten Beschwerden. Beginnen Sie mit der Beschwerde, die am häufigsten geäußert wird. Erarbeiten Sie jeweils Lösungsansätze, die dem zu pflegenden Menschen oder seinen Angehörigen angeboten werden können, und diskutieren Sie die Vorschläge in einer Übergabe. Ergänzen Sie Ihre Notizen um die konstruktiven Vorschläge Ihrer Kolleg:innen.
Diese Aufgabe ist individuell und hängt von den Gegebenheiten und Situationen in den jeweiligen Einrichtungen ab. Hier wurden mögliche Lösungsansätze auf fiktive Beschwerden als Beispiel erarbeitet.
Häufige Beschwerden
Lösungsansätze
1.Zu pflegender Mensch ambulant zu Hause betreut mit Essen auf Rädern:
Das Mittagessen ist geschmacklich schlecht. Die Auswahl zwischen drei verschiedenen Menüs ist definitiv zu wenig.
•Mit dem zu pflegenden Menschen ins Gespräch kommen.
•Den zu pflegenden Menschen nach seinen Wünschen und Vorlieben befragen.
•Umsetzbare Wünsche erfüllen (oft sind es Kleinigkeiten, die den Unmut mildern oder sogar vollständig beseitigen können).
•Angehörige mit einbeziehen.
•…
2.Angehörige stationäre Akutpflege:
Mein Vater wird nicht mobilisiert, sondern liegt den ganzen Tag nur in seinem Bett und starrt an die Wand.
•Protokolle der Positionswechsel führen und Mobilisationszyklus zeigen, Maßnahmenplan erläutern, sofern die Angehörigen bevollmächtigt sind, diese Informationen einzusehen.
•Angehörige über Krankheit und Gesundheitszustand informieren und erklären, weshalb eine Mobilisation zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist, sofern eine Information nicht der Schweigepflicht widerspricht.
•Basale Stimulation berücksichtigen und in den Alltag integrieren.
•Einzelbetreuungen anbieten und für Abwechslung sorgen.
•Angehörige bitten, die Räumlichkeit durch Dekoration abwechslungsreich zu gestalten (wechselnde Bilder an Wand und Decke, Mobile, bewegliche LED-Lichter, Fernseher, Hörspiele/Musik …)
•…
3.Angehörige stationäre Langzeitpflege:
Der Hausarzt sollte dringend vorbeischauen, das wird hier nie organisiert.
•Einen Einblick in die ärztliche Kommunikation gewähren, sofern der Angehörige Einsichtserlaubnis hat.
•Indikation für den Kontakt zum Hausarzt erfragen, es kann beispielsweise Veränderungen des Allgemeinzustandes geben, die den Pflegepersonen nicht aufgefallen sind.
•Den Angehörigen die Möglichkeit geben, selbst in Kontakt mit dem Hausarzt zu treten, sofern diese dazu bevollmächtigt sind.
•Bei notwendigen Indikatoren Hausarzt kontaktieren und einen Hausbesuch auf Wunsch der Angehörigen erbitten.
•…
Nennen Sie verschiedene „Weichmacher“, die in der deutschen Sprache oft verwendet werden, die Sie zukünftig zu vermeiden versuchen.
Weichmacher sind nicht hilfreich, da sie keine relevanten und aussagekräftigen Informationen enthalten. Die Auslegung bedarf der subjektiven Wahrnehmung und persönlichen Deutung. Sie begünstigen Missverständnisse und bergen Konfliktpotenzial, daher sollten sie vermieden werden.
•vielleicht
•eventuell
•möglicherweise
•ein Bisschen
•eigentlich
•mehr oder weniger
•im Prinzip
•grundsätzlich
•normalerweise
•im Normalfall
•unter Umständen
•…
Besprechen Sie die Thematik im Team und diskutieren Sie Alternativen, die zur Wahl stehen, um die Aufforderung „Sie müssen“ zukünftig zu vermeiden. Bedenken Sie bei Ihren Überlegungen, dass Aufforderungen nur als Frage formuliert werden können, wenn wirklich eine Wahlmöglichkeit für die Angesprochenen besteht.
•„Ich würde mir wünschen, dass …“
•„Sie könnten mich unterstützen, indem …“
•„Sie können gerne …“
•„Sie haben die Möglichkeit …“
•„Sie dürfen …“
•…
Erarbeiten Sie weitere Möglichkeiten, die zur Vermeidung von Konflikten ergriffen werden können. Bedenken Sie bei Ihrer Überlegung, dass viele Konflikte durch Unwissenheit entstehen, beispielsweise sind interne Regeln (stationsbezogen, einrichtungsbezogen, …) für Außenstehende unbekannt.
•Strukturen, Abläufe … besonders für neue Mitarbeitende und Schüler möglichst transparent gestalten.
•Gesprächsbereitschaft vermitteln.
•Informationsveranstaltungen durchführen, Infoschreiben aushändigen, Aushänge anbringen bei Neuerungen.
•Freundlich bleiben und versuchen, sich in die Lage des anderen zu versetzen.
•Gliederung der Organisation transparent gestalten.
•Erwartungen, Zielsetzungen usw. mit neuen Kollegen und Schülern kommunizieren.
•Informationssammlung für alle Mitarbeiter:innen zugänglich machen, z. B. Handbuch (analog), Intranet (digital).
•Mögliche Hierarchiestrukturen und Zuständigkeiten deutlich darstellen.
•Auf kleinere Probleme zeitnah reagieren, bevor sich daraus große Probleme entwickeln und/oder es eskaliert.
•…
Bilanzierung
Niveau:
2. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
I.1
II.1
III.2
IV.1
V.1
V.2
Definieren Sie folgende Begriffe und geben Sie bei den ersten beiden jeweils drei mögliche Ursachen an.
Definition
Ursachen
Positive Bilanz
Ist die Flüssigkeitseinfuhr innerhalb 24 Stunden größer als die Ausfuhr, wird von einer positiven Bilanz gesprochen. In diesem Fall lagert sich allerdings Flüssigkeit im Gewebe ab, der Blutdruck steigt und es können sich Ödeme bilden.
•Niereninsuffizienz
•Herzinsuffizienz
•Hormonelle Dysregulation
•…
Negative Bilanz
Ist die Flüssigkeitsausfuhr innerhalb 24 Stunden größer als die Einfuhr liegt eine negative Bilanz vor. Der zu pflegende Mensch scheidet in diesem Fall mehr Flüssigkeit aus, als er zu sich nimmt. Dies kann die Gefahr einer Dehydration erhöhen und eine Exsikkose hervorrufen.
•Diarrhoe
•Erbrechen
•Blutverlust
•Starkes Schwitzen
•Fieber
•Hormonstörungen
•Stoffwechselerkrankungen
•Einnahme bestimmter Medikamente wie z. B. Diuretika
•…
Ausgeglichene Bilanz
Sind die Flüssigkeitseinfuhr und die Flüssigkeitsausfuhr nahezu identisch, wird von einer ausgeglichenen Bilanz gesprochen.
Normalfall
Zählen Sie zehn verschiedene Lebensmittel auf, die einen besonders hohen Flüssigkeitsanteil aufweisen.
•Salatgurke
•Rhabarber
•Sternfrucht
•Wassermelone
•Radieschen
•Grapefruit
•Tomate
•Molkeprodukte
•Pampelmuse
•Orangen
•Salat
•Cantaloupe-Melone
•Mandarinen
•Erdbeeren
•Zuckerschoten
•Eis
•Pfirsiche
•Nektarinen
•Joghurt
•Paprika
•Ananas
•Suppen
•Blumenkohl
•Karotten
•Zucchini
•Spinat
•Papaya
•Spargel
•Kohlrabi
•…
Wählen Sie zwei zu pflegende Menschen aus und berechnen Sie den individuellen Flüssigkeitsbedarf für 24 Stunden.
Folgend werden zwei Rechenbeispiele angegeben.
Person 1
Frau 1,68 m groß, 64,8 kgBei diesem Beispiel liegt der individuelle Flüssigkeitsbedarf zwischen 1944–2592 ml innerhalb 24 Stunden.
Person 2
Mann 1,89 m groß, 103,4 kgBei diesem Beispiel liegt der individuelle Flüssigkeitsbedarf zwischen 3102–4136 ml innerhalb 24 Stunden.
Ermitteln Sie den durchschnittlichen Flüssigkeitsbedarf für folgende Personengruppen.
Personengruppe
Alter
Flüssigkeitsbedarf in ml
Baby
0–12 Monate
680–1000 ml/Tag
Kleinkind
1– 7 Jahre
1300–1600 ml/Tag
Kind
7–15 Jahre
1800–2450 ml/Tag
Jugendliche:r
15–19 Jahre
2800 ml/Tag
Junge:r Erwachsene:r
19–25 Jahre
2700 ml/Tag
Erwachsene:r
25–51 Jahre
2600 ml/Tag
Senior:innen
> 51 Jahre
2250 ml/Tag
Schwangere
2700 ml/Tag (Schätzwert)
Stillende Mütter
3100 ml/Tag (gerundeter Wert)
Quelle: https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/wasser/
Definieren Sie die beiden folgenden Begriffe:
Perspiratio sensibilis
Perspiratio insensibilis
Die durch Aktivierung der Schweißdrüsen abgegebene Flüssigkeit (sichtbares Schwitzen)
Die ohne Aktivierung der Schweißdrüsen über Haut, Schleimhäute und Atmung abgegebene Flüssigkeit (dieser Flüssigkeitsverlust geschieht unbemerkt)
Quelle: https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/perspiration/50460
Lassen Sie sich die verschiedenen Assessments sowie die Dokumentationsweisen zur Bilanzgestaltung zeigen und erläutern.
Befassen Sie sich mit den entsprechenden Standards.
Notieren Sie sich wichtige Schwerpunkte, die beachtet werden müssen.
Die Flüssigkeitsbilanzierung ist durch keinen Expertenstandard einheitlich geregelt. In der Praxis gibt es daher verschiedene Varianten der Umsetzung. Aus diesem Grund kann für diese Aufgabe keine einheitliche Lösung vorgegeben werden.
Wichtig zu wissen ist, dass eine Flüssigkeitsbilanzierung ausschließlich auf ärztliche Anordnung durchgeführt wird, da die Ergebnisse durch Ärzte und nicht durch das Pflegepersonal ausgewertet und interpretiert werden sollten. Es kann jedoch auch laut Hausstandard vorgegeben sein, dass bei Neuaufnahme oder im Verdacht einer negativen Bilanz, für einen vorgegeben Zeitraum die Bilanzierung erhoben wird. Zu einer Flüssigkeitsbilanzierung gehört neben dem Einfuhrprotokoll auch das Ausfuhrprotokoll. Hierbei wird jeweils die zugeführte und die ausgeschiedene Flüssigkeitsmenge gemessen bzw. geschätzt und dokumentiert. Gerade das Festlegen der Perspiratio sensibilis und der Perspiratio insensibilis sowie das Ausscheiden in eine Inkontinenzvorlage gestalten eine Flüssigkeitsbilanzierung schwer. Ausschlaggebend für ein aussagekräftiges Ergebnis ist deshalb, dass innerhalb einer Einrichtung bzw. innerhalb einer Station einheitlich gerechnet und dokumentiert wird. Dies gestaltet sich am einfachsten nach einem festgelegten Hausstandard.
Um einen zuverlässigen Gesamteindruck des zu pflegenden Menschen zu erhalten und Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe frühzeitig zu erkennen, können ergänzend weitere Parameter hinzugezogen werden. So empfiehlt es sich, den Hautturgor (Spannungszustand der Haut) sowie den Bauchumfang des zu pflegenden Menschen in regelmäßigen Abständen zu messen und eine tägliche Gewichtskontrolle durchzuführen.
Definieren Sie die jeweilige Zielsetzung und erfassen Sie verschiedene Indikatoren, die eine Flüssigkeitsbilanz mit dem jeweiligen Bilanzziel erforderlich machen können.
Bilanzziel
Zielsetzung
Mögliche Indikatoren
Positive Bilanz
Das Ziel ist es, dass der zu pflegende Mensch mehr Flüssigkeit zu sich nimmt, als er ausscheidet.
•Dehydration bekämpfen
•Exikosen vermeiden
•…
Negative Bilanz
Das Ziel ist es, dass der zu pflegende Mensch mehr Flüssigkeit ausscheidet, als er zu sich nimmt.
•Ödeme verringern
•Wasserablagerungen beseitigen
•…
Ausgeglichene Bilanz
Das Ziel ist es, dass der zu pflegende Mensch möglichst genauso viel Flüssigkeit ausscheidet, wie er zu sich nimmt.
•Keine Einschränkungen des Gesundheits- und Allgemeinzustandes
•…
Wählen Sie mit der Praxisanleitung einen zu pflegenden Menschen aus, bei dem eine Flüssigkeitsbilanz erhoben wird.
Beschreiben Sie das Bilanzziel und das genaue Vorgehen. Ermitteln Sie mithilfe des Dokumentationssystems den Indikator, der dieses Handeln erforderlich macht.
Diese Aufgabe ist individuell an zu pflegende Menschen in der Einrichtung gerichtet und kann hier nicht bearbeitet werden.
Bilanzziel
Indikator
Ablauf der Bilanzerfassung
Hemiplegie und Hemiparese
Niveau:
2. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
I.2
I.3
I.5
I.6
II.2
IV.2
V.2
Beschreiben Sie die Begriffe Hemiplegie und Hemiparese.
Hemiplegie
Hemiparese
Unter Hemiplegie wird die vollständige Lähmung einer Körperhälfte verstanden (umgangssprachlich Halbseitenlähmung). Dieser Begriff beschreibt einen vollständigen Funktionsausfall, welcher dazu führt, dass betroffene Menschen mit der betroffenen Körperhälfte keine bewusst gesteuerten Bewegungen mehr ausführen können.
Unter Hemiparese wird eine unvollständige Lähmung einer Körperhälfte verstanden, bei der noch eine Restaktivität vorhanden sein kann. Bei der betroffenen Person kommt es zudem zu einer Verminderung der Kraft in der betroffenen Seite. Dies ist daraufhin zurückzuführen, dass nur einzelne Muskelgruppen von der Lähmung betroffen sind.
Eine Hemiplegie kann sich durch eine schlaffe oder spastische Lähmung zeigen.
Charakterisieren Sie die beiden Formen.
Schlaffe Lähmung
Spastische Lähmung
Bei einer schlaffen Lähmung (periphere Lähmung) hängt die betroffene Extremität spannungslos herab. Der Muskeltonus ist herabgesetzt oder vollständig erloschen, die Reflexe sind reduziert oder komplett verschwunden.
Bei einer spastischen Lähmung (zentrale Lähmung) kommt es zu Anspannung und Verkrampfung der betroffenen Extremität. Der Muskeltonus (Muskelspannung) der betroffenen Körperregion ist erhöht, Muskeln sind versteift, die Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt und Reflexe lassen sich leichter auslösen.
Beschreiben Sie die Lokalisation der folgenden Begriffe.
Vorsilbe
Beschreibung Lokalisation
Faszial
Das Gesicht betreffend (der Gesichtsnerv Nervus facialis ist betroffen).
Para
Zwei parallele Extremitäten sind betroffen. Also entweder beide Arme oder beide Beine.
Tetra
Alle vier Extremitäten sind betroffen. Je nach Höhe der Nervenschädigung können zusätzlich auch Atem- und Rumpfmuskulatur betroffen sein.
Geben Sie drei verschiedene Ursachen an, die zu einer Hemiplegie oder -parese führen können.
Ursachen für eine Hemiparese bzw. Hemiplegie können sein:
•Hirninfarkt
•Hirnblutung
•Schädel-Hirn-Verletzungen durch Unfälle
•Schädigung des Rückenmarks durch Unfälle
•Entzündungen des Gehirns durch Bakterien oder Viren (z. B. Meningitis, Enzephalitis …)
•Tumore
•Angeborene Bewegungseinschränkungen wie beispielsweise genetische Erkrankungen oder Verletzungen bei der Geburt
•…
Quelle: https://www.enableme.de/de/artikel/hemiparese-11247
Erläutern Sie die folgenden Einschränkungen.
Apraxie
Das bewusste Ausführen von zielgerichteten Bewegungen ist, obwohl keine motorischen oder sensorischen Defizite vorliegen und Hirnfähigkeit bzw. Verständnis zur Bewegungsausführung der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt sind, nicht möglich.
Agnosie
Das Erkennen von Gegenständen mit einem oder mehreren Sinnen ist nicht möglich. Erinnerungen an vertraute Objekte, Geräusche, Anblicke, … können nicht mehr abgerufen werden.
Neglect
Aufmerksamkeitsstörung, bei der eine Körperhälfte vernachlässigt wird. Dies kann auch die Sinne (wie Sehen, Hören, Riechen, Berührungsreize, Empfinden von Wärme/Kälte/Schmerz) betreffen, obwohl die Sinnesorgane selbst intakt sind.
Quelle: Shortlink: https://eref.thieme.de/V8RMH
Im Regelfall wird der Blutdruck an der linken Körperseite gemessen. Die Hemiplegie/-parese linksseitig stellt hierfür jedoch eine Kontraindikation dar.
Erläutern Sie den Ablauf der Blutdruckmessung bei den genannten Einschränkungen und begründen Sie dieses Vorgehen.
Eine RR-Messung an einem gelähmten Arm ist prinzipiell nicht verboten. Es empfiehlt sich allerdings bei einer Hemiplegie/Hemiparese, die gesunde Seite zu wählen. Bei Menschen mit einer Querschnittslähmung (Tetraplegie) hat man keine andere Wahl, da beide Körperhälften betroffen sind. Die Venenpumpe ist abhängig von der stattfindenden Muskelkontraktion und diese ist durch eine Lähmung beeinträchtigt. Dies wiederum kann zu einem verlangsamten Blutfluss führen, wodurch die Gefahr einer Thrombosebildung erhöht ist. Der fehlende Muskeltonus kann zudem den Blutdruckwert verändern und somit zu falschen Ergebnissen führen.
Sollte der betroffene Mensch eine spastische Lähmung entwickelt haben, ist die Gefahr gegeben, dass sich durch die RR-Messung der Muskeltonus zusätzlich verstärkt. Das korrekte Anlegen der Manschette kann aufgrund der Spastik deutlich erschwert bzw. nicht richtig durchführbar sein. Dies wiederum führt ebenfalls zu fehlerhaften Ergebnissen.
Bei den verschiedenen Pflegeinterventionen sollte der zu pflegende Mensch möglichst von der betroffenen Seite aus angesprochen und unterstützt werden (Bobath-Konzept).
Beschreiben Sie die Wichtigkeit der Umsetzung dieses Vorgehens.
Dieses Vorgehen unterstützt die eingeschränkte Person dabei, sich der betroffenen Körperpartien wieder bewusst(er) zu werden. Die Wahrnehmung wird gezielt dorthin gelenkt. Das Bobath-Konzept basiert auf der Plastizität des Gehirns. Dies stellt die Grundlage für jede Art von Lernen dar und ist die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu regenerieren und/oder neu zu strukturieren. Durch das Bewusstmachen und das Trainieren der betroffenen Körperpartien wird dieser Prozess gezielt gefördert.
Erläutern Sie am Beispiel des An- und Auskleidens mindestens zwei weitere Richtlinien, die Sie während der Intervention beachten sollten.
Eine Hemiparese/-plegie erschwert das Umkleiden betroffener Menschen sehr stark, da zusätzlich zu den Lähmungserscheinungen weitere neuropsychologische Beeinträchtigungen wie Apraxie, Agnosie und/oder Neglect auftreten können.
Das höchste Ziel ist die Rehabilitation des zu pflegenden Menschen. Dies wird gefördert, indem der zu pflegende Mensch seinen Fähigkeiten entsprechend immer aktiv in die Durchführung der Pflegeintervention eingebunden wird. Wichtig dabei ist, dass genügend Zeit zur Verfügung gestellt wird, da der zeitliche Aufwand einer ressourcenfördernden Intervention im Vergleich zu einer vollständigen Übernahme der Maßnahme durch die Pflegekraft deutlich höher ist. Das Auskleiden beginnt immer mit der nicht/weniger betroffenen Seite, das Ankleiden im Gegensatz dazu mit der mehr betroffenen Seite.
Beispiel: Der eingeschränkte Arm wird beim Anziehen zuerst in den Ärmel eingefügt, danach erst der nicht betroffene Arm. Beim Ausziehen wird erst der nicht betroffene Arm herausgezogen, danach der betroffene Arm. So wird die jeweilige Bewegungsfähigkeit der Extremitäten berücksichtigt. Der zu pflegende Mensch soll nach seinen Ressourcen optimal mithelfen und kann beispielsweise mit dem weniger betroffenen Arm den mehr betroffenen Arm führen und unterstützen.
Wählen Sie einen zu pflegenden Menschen mit einer Hemiplegie/-parese aus.
Setzen Sie Ihr bisher erworbenes Fachwissen in Bezug auf die Ressourceneinbindung, das Bobath-Konzept sowie die kinästhetische Grundhaltung innerhalb einer Pflegeintervention um. Lassen Sie sich bei der Umsetzung von der Praxisanleitung beobachten und im Anschluss ein konstruktives Feedback von ihr geben.
Diese Aufgabe kann hier nicht beantwortet werden.
Erstellen Sie eine Zusammenfassung verschiedener Hilfsmittel für folgende Alltagsbereiche.
Alltagsbereich
Hilfsmittel
Essen und Trinken
•Speziell geformtes Besteck (bietet durch ergonomische Griffe eine bessere Griffigkeit und unterstützt so dabei, das Essen sicher zum Mund zu führen)
•Rutschfeste Spezialteller mit Schiebekante (erleichtern das einhändige Essen, da Essen nicht vom Teller rutscht und der Teller sicher stehen bleibt)
•Einhandbrett (ermöglicht das einhändige Streichen und Belegen von Brötchen oder Brotscheiben, da diese fixiert werden können)
•Trinkhilfen wie beispielsweise Strohhalme (erleichtern das Trinken bei eingeschränkter Nackenbeweglichkeit und Aspirationsgefahr)
•…
Mobilisation
•Spezielle Rollstühle (ausgestattet mit Einhandgreifreifen und Einhandbremse) ermöglichen das selbständige sichere Fortbewegen
•Elektrorollstühle (ermöglichen einen größeren Bewegungsradius, da sie nicht unter Krafteinsatz manuell angetrieben werden müssen, sondern mit einem Motor in Bewegung kommen. Betroffene Menschen mit Hemiplegie können diese Art von Rollstuhl mit einem Joystick lenken)
•Rollatoren (unterstützen Menschen mit Hemiparese bei einem sicheren Stand und dienen der Sturzprophylaxe. Betroffene Menschen haben so die Möglichkeit, sich eigenständig fortzubewegen)
•Vierpunktstock (kann als Unterstützung bei einer leichten Hemiparese eingesetzt werden und Sicherheit, Selbstständigkeit und Flexibilität fördern)
•Angepasstes unterstützendes Schuhwerk oder Orthesen (unterstützen die Stabilität der Fußgelenke)
•…
An- und Auskleiden
•Knopfhaken (der verstärkte Handgriff sorgt für eine bessere Griffigkeit und ermöglicht das Schließen von Knöpfen mit nur einer Hand)
•Langer Schuhlöffel (ermöglicht das Anziehen der Schuhe beispielsweise aus dem Rollstuhl heraus, ohne dass sich der zu pflegende Mensch weit nach vorne bücken muss und so evtl. das Gleichgewicht verliert)
•Reißverschlussring (dient den betroffenen Menschen dabei, einen Reißverschluss weiter zu öffnen oder zu schließen)
•An die Ressourcen des betroffenen Menschen angepasste Kleidung (Hosen mit Gummizug statt Knopf und Reißverschluss. Schuhe mit Klettverschluss oder Reißverschluss ermöglichen ein leichteres An- bzw. Ausziehen, als es bei Schnürsenkeln der Fall wäre)
•…
Wählen Sie mit der Praxisanleitung einen zu pflegenden Menschen mit Hemiplegie/-parese aus und erstellen Sie eine Auflistung der Hilfsmittel, die diesem zu Pflegenden den Alltag erleichtern können.
Unterscheiden Sie dabei die Hilfsmittel, die die zu Pflegenden selbst finanzieren müssen, und jene, die bei gesetzlich Versicherten durch die Krankenkasse erstattet werden können.
Diese Aufgabe ist individuell auf einen zu pflegenden Menschen abzustimmen und kann hier deshalb nicht gelöst werden. Es sollen aber allgemeine Informationen zusammengefasst werden.
Vorab ist noch zu erwähnen, dass Hilfsmittel Gegenstände sind, die sich bewegen lassen. Der behindertengerechte Umbau von Immobilien wie der Einbau eines Treppenlifts oder einer Rampe fällt nicht unter diese Kategorie. Jedoch kann bei Vorliegen eines Pflegegrades ein Zuschuss durch die Pflegeversicherung für solche Einbaukosten gewährt werden.
Quelle:https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/hilfsmittel-was-ist-das-6889
Hilfsmittel Selbstzahler
Hilfsmittel erstattungsfähig
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen keine Kosten für allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, die unentbehrlich sind oder von einer großen Anzahl von Menschen genutzt werden. Beispiele hierfür sind eine Heizdecke oder ein Standardtelefon.
Des Weiteren besteht kein Anspruch auf Kostenübernahme für Gegenstände, die einen geringen oder umstrittenen therapeutischen Nutzen haben, wie beispielsweise Wärmflaschen, oder deren Preis gering ist, wie zum Beispiel Alkoholtupfer zur Desinfizierung der Haut vor einer Insulinspritze.
Diese Kosten müssen durch die Versicherten selbst übernommen werden.
Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/hilfsmittel-was-ist-das-6889
Damit die Krankenkasse die Kosten für Hilfsmittel trägt, müssen die individuell abzustimmenden Produkte ärztlich verordnet werden. Des Weiteren müssen diese Produkte im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgelistet sein (sollte das benötigte Hilfsmittel nicht gelistet sein entscheidet die Krankenkasse einzelfallbezogen individuell). Sind diese Voraussetzungen gegeben, übernimmt die Krankenkasse beispielsweise die Kosten für Rollstühle, Rollatoren, Dreiräder, Elektrostimulatoren, Alltagshelfer, Orthesen …