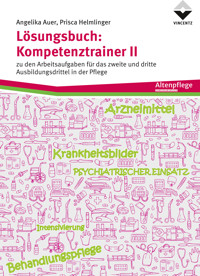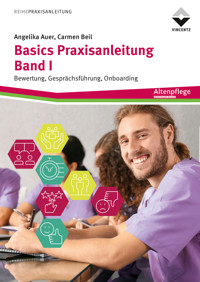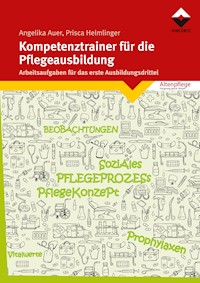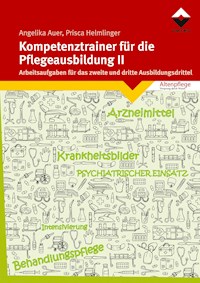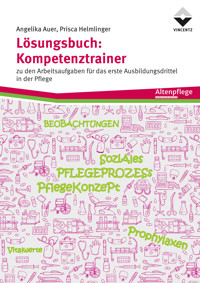
41,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vincentz Network
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die ideale Ergänzung zum "Kompetenztrainer für die Pflegeausbildung". Dieses passende Lösungsbuch ist ein zeitsparendes Hilfsinstrument für Praxisanleiter:innen. Natürlich können auch Auszubildende die Antwortmöglichkeiten zur Kontrolle und Prüfungsvorbereitung nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Angelika Auer, Prisca Helmlinger
Lösungsbuch: Kompetenztrainer
zu den Arbeitsaufgaben für das erste Ausbildungsdrittel in der Pflege
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Sämtliche Angaben und Darstellungen in diesem Buch entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens und sind bestmöglich aufbereitet.
Der Verlag und der Autor können jedoch trotzdem keine Haftung für Schäden übernehmen, die im Zusammenhang mit Inhalten dieses Buches entstehen.
© VINCENTZ NETWORK, Hannover 2024
Besuchen Sie uns im Internet: www.altenpflege-online.net
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne Weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um geschützte, eingetragene Warenzeichen.
Titelfoto: AdobeStock_kronalux (composing)
Autorinnen Fotos: Prisca Helmlinger; Foto Wöhrstein, Singen Angelika Auer; Foto Sabi&Ben Fotografie, Aldingen
E-Book ISBN 978-3-7486-0668-0
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I Organisation
Ablaufplanung einer Pflegeintervention
Ärztliche Anordnungen/Arztvisite
Eindämmung von Infektionsgeschehen
Handhygiene – Basiswissen
Handhygiene – Erweiterung
Neuaufnahme
Orientierung in der Einrichtung (TpA)
Schnittstellenmanagement
Tagesstruktur
II Beobachtungen
Beobachtung Erbrochenes und Sputum
Beobachtung Haut
Beobachtung Pflegeintervention
Beobachtung Stuhl und Urin
III Pflegerelevante medizinische Grundlagen
Diabetes
Ernährung
Subkutane Injektion (Beispiel Insulingabe)
Suchtkrankheiten – Basiswissen
Umgang mit demenziell erkrankten Menschen – Basiswissen
IV Vitalwerte
Atmung
Blutdruck
Blutzucker
Körpertemperatur
Puls
V Prophylaxen
Aspirationsprophylaxe
Dekubitusprophylaxe
Immobilitätsprophylaxe
Inkontinenzprophylaxe
Intertrigoprophylaxe
Kontrakturenprophylaxe
Obstipationsprophylaxe
Pneumonieprophylaxe
Soor- und Parotitisprophylaxe
Sturzprophylaxe
Thromboseprophylaxe
Zusammenhänge Prophylaxen
VI Pflegekonzept/Pflegeprozess
Basale Stimulation
Biografiearbeit
Bobath
Dokumentation
Kinästhetik
Pflegemodell ABEDL nach Monika Krohwinkel
Pflegemodell ATL nach Liliane Juchli
Pflegemodell Transkulturelle Pflege nach Madeleine Leininger
Pflegeprozessplanung nach Fiechter und Meier
Ressourcen
Strukturierte Informationssammlung (SIS®)
VII Soziales
Ekel und Scham
Freiheitsentziehende Maßnahmen
Gewalt in der Pflege
Nähe und Distanz
Sexualität in der Pflege
Umgang mit Sterben und Tod
VIII Pädiatrie
Dreimonatskoliken
Einwilligungsfähigkeit
Fieberkrampf und Epilepsie
Hyperbilirubinämie bei Neugeborenen
Krankheitsbild Appendizitis
Krankheitsbild Keuchhusten
Krankheitsbild Masern
Krankheitsbild Windpocken
Pubertät
Autorinnen
Vorwort
Liebe Pflegecommunity, zuallererst möchten wir uns für die zahlreichen, motivierenden Rückmeldungen zu unseren beiden Kompetenztrainern herzlich bedanken. Mit so viel positiver Rückmeldung aus allen Settings hatten wir bei Weitem nicht gerechnet. Herzlichen Dank!
Seit dem Beginn der neuen generalistischen Pflegeausbildung im Januar 2020 hat sich das Aufgabengebiet der Praxisanleiter:innen im Umfang enorm erweitert. Wir sind nach wie vor in unseren Einrichtungen mit der Umsetzung der neuen Ausbildung, im theoretischen wie auch im praktischen Bereich, beschäftigt. Darüber hinaus waren und sind wir in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv. Unter anderem haben wir im Landkreis einheitliche Ausbildungspläne mit erarbeitet, diskutieren die unterschiedlichen Herausforderungen und erörtern mögliche Lösungen.
Immer wieder wurde das Thema Arbeitsaufgaben in der Praxis hilfesuchend angesprochen, da vielen Einrichtungen die erforderlichen Ressourcen fehlen, woraufhin wir uns an die Erarbeitung der beiden Kompetenztrainer begeben haben.
Uns liegt, wie Sie bereits wissen, eine ganzheitliche Pflegeausbildung am Herzen. Da wir überzeugt sind, dass nur aus einer allumfassenden Ausbildung handlungskompetente und motivierte Pflegefachkräfte hervorgehen können, haben wir nun aufgrund vermehrter Nachfrage nach einem Lösungsbuch entschieden, diesem Wunsch nachzukommen.
Mit diesem Lösungsbuch möchten wir allen praktischen Einrichtungen, Pflegeschulen, Praxisanleitern und -anleiterinnen sowie natürlich den Auszubildenden wieder ein hilfreiches, zeitsparendes Instrument an die Hand geben, das sie bei der Nutzung der Arbeitsaufgaben unterstützen soll. Da die Arbeitsaufgaben im Kompetenztrainer beim Theorie-Praxis Transfer vor allem die individuellen Gegebenheiten in Ihrer Einrichtung berücksichtigen sollen, können wir hier nicht alle Aufgaben beantworten.
Die Antworten im „allgemeinen Wissensteil“ werden wir möglichst umfangreich zusammenstellen. Die allumfängliche Bearbeitung der Themen würde aufgrund der verschiedenen Settings und Schwerpunkte den Umfang der geforderten Aufgabenbeantwortung überschreiten. Somit werden die hier aufgeführten Antworten begrenzt. Kurz gesagt: Aufgrund der umfangreichen Antwortmöglichkeiten wird hier nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die Antwortauswahl entspricht dem allgemeinen, aktuellen pflegerischen und medizinischen Wissenstand Mai 2023.
Um eine schnelle Übersicht und Zuordnung der Antworten zu gewährleisten, sind die Aufgaben wie in den Kompetenztrainern innerhalb der angebotenen Themenbereiche alphabetisch geordnet. Die Arbeitsaufgaben können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet und kontrolliert werden.
Die Lösungsbücher sind als zeitsparendes Hilfsinstrument vor allem für Praxisanleiter:innen und Lehrer:innen gedacht. Natürlich können die verschiedenen Antwortmöglichkeiten auch von Auszubildenden zur Kontrolle ihrer Ausarbeitungen im allgemeinen Teil sowie als Informationssammlung zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden.
Angelika Auer, Prisca Helmlinger
IOrganisation
Organisation
Ablaufplanung einer Pflegeintervention
Ärztliche Anordnungen/Arztvisite
Eindämmung von Infektionsgeschehen
Handhygiene – Basiswissen
Handhygiene – Erweiterung
Neuaufnahme
Orientierung in der Einrichtung (TpA)
Schnittstellenmanagement
Tagesstruktur
Ablaufplanung einer Pflegeintervention
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
II.1
II.2
II.3I
IV.1
IV.2
V.1
V.2
Die komplette Aufgabe 1.1 „Ablaufplanung einer Pflegeintervention“ ist eine individuelle Aufgabe und kann nur vor Ort in der Einrichtung durchgeführt und beantwortet werden.
Ärztliche Anordnungen/Arztvisite
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
I.1
III.2
III.3
IV.1
IV.2
Beurteilen Sie, ob die in der folgenden Tabelle aufgeführten Berufsgruppen berechtigt sind, eine Behandlungspflege nach SGB V zu delegieren, begründen Sie Ihre Entscheidung.
Beurteilen Sie, welche der folgenden Tätigkeiten in der Tabelle verordnungspflichtig sind, begründen Sie Ihre Aussage und fügen Sie selbstständig drei weitere verordnungspflichtige Maßnahmen hinzu.
Begleiten Sie Ihre Praxisanleitung bei einer Arztvisite, wenn es Ihnen möglich sein sollte, bevorzugt bei einer Facharztvisite.
Notieren Sie sich den Ablauf der Visite in Stichpunkten:
Der Verlauf einer Arztvisite kann je nach Arzt, Anzahl der zu pflegenden Personen, aber auch nach internem Hausstandard, unterschiedlich gestaltet sein.
Reflektieren Sie gemeinsam mit der Praxisanleitung den Ablauf der begleiteten Arztvisite und arbeiten Sie diesbezüglich Ihre Wahrnehmung positiv wie negativ heraus.
Diese Aufgabe kann hier nicht beantwortet werden, sondern ist von der Situation vor Ort abhängig.
Diskutieren Sie mit der Praxisanleitung, welche rechtliche Form eine ärztliche Anordnung/Verordnung erfüllen und welche Daten sie enthalten muss.
•Schriftlich
•Änderungsdatum/Anordnungsdatum
•Änderung/Anordnung (Medikamentenname, -dosierung, Einnahmezeitpunkt, Applikationsform, angeordnete Behandlungspflege …)
•Bedarfsmedikation (maximale Tagesdosis, maximale Einzeldosis und Indikation)
•Bei temporär angeordneten Medikamenten die Einnahmedauer (beispielsweise Antibiotikum, Kortison …)
•Zuordnung/Informationen des Arztes (Anschrift, Wirkungsbereich …)
•Zuordnung des zu pflegenden Menschen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift …)
•Unterschrift des verordnenden Arztes/der verordnenden Ärztin
•…
Erstellen Sie eine Auflistung, welche Änderung/Neuerung wo und wie dokumentiert wird.
In § 137 SGB V wird die Dokumentation zur Qualitätssicherung gefordert.
In Bezug auf die Arztvisite muss Folgendes dokumentiert werden:
•Tag der Änderung
•Arzt, der die Änderung vorgenommen hat
•Behandlungspflegerische Anordnungen, die geändert oder neue angeordnet wurden (z. B. RR-Messung bisher 3-mal wöchentlich auf 1-mal reduziert, Verbandswechsel)
•Neu angeordnete Medikamente mit Namen, evtl. Namen des Wirkstoffes, Dosierung des Medikamentes, Verabreichungsform, Verabreichungszeitpunkt, Einzel- und Tagesdosierung bei Bedarfsmedikamenten …
•Veränderung bereits angeordneter Medikamente (Reduzierung oder Erhöhung der Dosierung)
•Absetzen von Medikamenten
•Anpassung von Diagnosen
•Anordnung von diagnostischen Maßnahmen (Blutabnahme, MRT …)
•Überweisungen an Fachärzte oder Therapeuten
•…
Wie die jeweiligen Angaben dokumentiert werden, ist abhängig vom hausinternen Dokumentationssystem (analog, digital, Betriebssystem…)
Erklären Sie den Unterschied zwischen SGB V und SGB XI.
SGB V umfasst Maßnahmen der Behandlungspflege, die wiederum der ärztlichen Anordnung unterliegen. Erstattungsfähige Leistungen werden direkt mit der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet, nicht erstattungsfähige Leistungen werden mit dem Leistungsempfänger abgerechnet. Diese kann der Leistungsempfänger bei freiwilligen Zusatzversicherungen (z. B. Zahnversicherung) mit der entsprechenden Versicherung abrechnen.
Bei privatversicherten Leistungsempfängern erfolgt die Abrechnung in der Regel mit dem Leistungsempfänger, der sich die erstattungsfähigen Leistungen von der privaten Krankenversicherung erstatten lässt.
Zur besseren Zuordnung kann folgende Eselsbrücke hilfreich sein:
Die römische Zahl „V“ gleicht dem Buchstaben „V“. Dieser wiederum bildet in diesem Zusammenhang den ersten Buchstaben des Wortes Verordnung.
SGB XI umfasst die pflegerischen Maßnahmen und vorbehaltenen Tätigkeiten nach§ 4 PflBG. Die Finanzierung erfolgt bei Vorliegen eines Pflegegrades im Umfang der entsprechenden Pflegesachleistung. Andernfalls sind die Leistungen vom zu Pflegenden selbst zu zahlen.
Eindämmung von Infektionsgeschehen
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
I.2
I.4
I.5
II.1
II.2
III.1
III.2
III.3
IV.1
IV.2
V.1
V.2
Erklären Sie kurz folgende Krankheitsbilder:
Definition
Symptome
SARS-CoV-2 (Corona)
Corona ist eine Erkrankung der Atemwege, die für eine weltweite Pandemie gesorgt hat.
Die Viren wurden nach ihrem Aussehen benannt, daher wurde ihnen der Name „Corona“ gegeben. Dies bedeutet Krone oder Kranz.
Der Erreger verteilt sich über Aerosole, die ausgeatmet werden und sich, da sie schwerer als Luft sind, auf Boden und Flächen ablegt.
•Halsschmerzen
•Kopfschmerzen
•Fieber
•Husten
•Schnupfen
•Müdigkeit, Abgeschlagenheit
•Kurzatmigkeit
•Luftnot
•Je nach Schweregrad niedrige Sauerstoffsättigung
•Verlust des Geruchs und/oder Geschmacksinns
•Der Krankheitsverlauf kann allerdings auch völlig symptomfrei sein
•…
MRSA
MRSA ist die Abkürzung für: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus.
Hierbei handelt es sich um resistente Erreger, die sich auf der Haut und den Schleimhäuten ansiedeln.
•Lokale Infektionen von Wunden, z. B. OP-Wunden oder der HautAbszesse (Allgemeine Anzeichen einer EntzündungÜberwärmung, Schwellung, Schmerzen, Rötung, Funktionseinschränkungen
Die Keime sind resistent/unempfindlich gegen viele Antibiotika, besonders gegen den Wirkstoff Methicillin wie bereits aus dem Namen hervorgeht. Somit wird die Behandlung erschwert und schwerwiegende Infektionen können sich ausbreiten.
Für gesunde Menschen ist der Erreger meistens ungefährlich, bei geschwächten und kranken Menschen können schwere Infektionen auftreten.
•Lungenentzündung, die durch den Keim hervorgerufen wird
•Entzündungen verschiedener Organe mit den jeweils typischen Anzeichen
•Mittelohr (Ohrenschmerzen, Fieber…)
•Nasennebenhöhlen (Fieber, Kopfschmerzen, Druckgefühl …)
•Harnwege (Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang …)
•Hirnhautentzündung (Nackenschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen …)
•Blutvergiftung (Sepsis)
•Verschlechterung des Allgemeinzustandes.
Norovirus
Bei Noroviren handelt es sich um hochansteckende Viren. Die Viren sind sehr widerstandsfähig und können tagelang auf Gegenständen (Türgriffen, Lichtschaltern, Handläufen …) überleben.
Temperaturen > 60° können sie minutenlang überleben, ebenso auf gekühlten und sauereingelegten Lebensmitteln.
•Durchfall
•Übelkeit
•Erbrechen
•Bauchkrämpfe
•Schwindelgefühl
•Abgeschlagenheit
Erkrankte Menschen können bereits vor dem Eintreten der Symptome Viren über den Stuhlgang ausscheiden und somit für andere ansteckend sein.
Nach Ausbruch der Symptome werden die Erreger mit dem Stuhlgang und beim Erbrechen ausgeschieden.
Eine Häufung der Symptome ist im Winter zu beobachten. Bei geschwächten, kranken Menschen und bei Kindern kann es zu Komplikationen kommen, da ein großer Verlust an Flüssigkeit und Mineralstoffen entsteht, die dem Körper möglichst schnell wieder zugeführt werden müssen.
•Kopfschmerzen
•Fieber
•Dehydration
•…
Schauen Sie sich die internen Standards zu den jeweiligen Infektionserkrankungen an.
Arbeiten Sie Abläufe, Maßnahmen und Vorgaben heraus, die im Fall einer Infektion bzw. schon im Verdachtsfall einzuhalten sind.
Die hier aufgeführten Maßnahmen sind nur beispielhaft und können vom jeweils hausinternen Standard abweichen, dieser ist für Sie an Ihrem Einsatzort immer richtungsweisend.
Handlungsleitfaden/Maßnahmen/Vorgaben
SARS-CoV-2 (Corona)
•Information an den/die zuständige/n Arzt/Ärztin.
•Im Akutfall Information für den betroffenen Menschen und nach Möglichkeit dessen Angehörige (Einhalten der Hygienemaßnahmen, Informationen zum Krankheitsbild und dessen Behandlung, aktuelle Handlungsrichtlinien zu vorgegebener oder freiwilliger Absonderung …).
•Die Handlungsrichtlinien haben sich während der Akutphase der Pandemie ständig geändert. Geregelt waren beispielsweise Besuchszeiten bzw. Besuchsrechte, Hygienerichtlinien, erforderliche persönliche Schutzausrüstung, Überwachung und Meldung der erkrankten Personen, Umgang mit infizierten Personen und Umgang mit infizierten verstorbenen Personen, Müllbeseitigung und Wäscheaufbereitung, Isolation, Quarantäne und Absonderung der infizierten Personen …
•Zum aktuellen Standpunkt (April 2023) wurden alle Vorgaben aufgehoben. Der weitere Umgang sollte durch einen internen Hausstandard vorgegeben sein.
•Dokumentation aller verrichteten Maßnahmen, Beobachtungen, ärztlichen Anordnungen, Untersuchungen mit Ergebnissen …
•…
MRSA
•Information an den/die zuständige/n Arzt/Ärztin.
•Information für den betroffenen Menschen und nach Möglichkeit dessen Angehörige (Einhalten der Hygienemaßnahmen, Informationen zum Krankheitsbild und dessen Behandlung …).
•Isolation/Absonderung der infizierten Person je nach Gegebenheit.
•Sanierung nach ärztlicher Verordnung.
•Ablauf und Maßnahmen der Sanierung:
•Screening (Erfassen der betroffenen Region, z. B. unter den Achseln, Nasenvorhof, Rektum …).
•Behandlung (Je nach Behandlungsregion z. B. Antibiotische Nasensalbe, Rachenspülungen, Desinfizierende Waschlotionenca. eine Woche).
•Behandlungspause (2 - 4 Tage, um den Kontrolltest durch Substanzen der Behandlung nicht zu verfälschen).
•Kontrolle (Die betroffene Stelle wird drei Tage in Folge abgestrichen und auf MRSA untersucht).
•Weiteres Vorgehen (Sollten bei den Probenentnahmen keine Keime mehr nachgewiesen werden, kann der betroffene Mensch entisoliert werden. Werden weiterhin Keime nachgewiesen wird in den Kreislauf bei der Behandlung wieder eingestiegen. Dieses wiederholt sich so lange, bis keine Keime mehr nachgewiesen werden können. Die Dauer der Behandlungszeit kann sich durch sanierungshemmende Rahmenbedingungen (z. B. bestehende Wunden, Katheterträger …) verlängern).
•Striktes Einhalten der Hygienemaßnahmen
•z. B. Handdesinfektion, Flächendesinfektion unter strengster Beachtung der Einwirkzeit und mit geeignetem Desinfektionsmittel (nicht jedes Desinfektionsmittel wirkt gegen MRSA). Tragen von persönlicher Schutzausrüstung beim Betreten des Zimmers der betroffenen Person.
•Wäsche wird in einem separaten Wäschesack transportiert und bei mindestens 60 Grad gewaschen.
•Dokumentation aller verrichteten Maßnahmen, Beobachtungen, ärztlichen Anordnungen, Untersuchungen mit Ergebnissen …
•…
Norovirus
•Information an den/die zuständige/n Arzt/Ärztin.
•Namentliche Meldepflicht nach § 7 Abs. 1 IfSG bei direktem oder indirektem Nachweis des Norovirus.
•Information für den betroffenen Menschen und nach Möglichkeit dessen Angehörige (Einhalten der Hygienemaßnahmen, Informationen zum Krankheitsbild und dessen Behandlung …).
•Isolation/Absonderung der infizierten Person (nach Möglichkeit mit eigener Toilette).
•Striktes Einhalten der Hygienemaßnahmen
•z. B. Handdesinfektion, Flächendesinfektion unter strengster Beachtung der Einwirkzeit und mit geeignetem Desinfektionsmittel (nicht jedes Desinfektionsmittel wirkt gegen MRSA). Tragen von persönlicher Schutzausrüstung beim Betreten des Zimmers der betroffenen Person.
•Wäsche wird in einem separaten Wäschesack transportiert und viruzid wirksam gereinigt.
•Je nach Setting kann eine Sperrung des betroffenen Bereiches/der Station angeordnet werdenfür Neuaufnahmen oder VerlegungenVerringerung der Patienten-/Bewohnerbewegung.
•Labortechnische Untersuchung des Stuhlgangs für einen gesicherten Nachweis des Virus oder der Genesung.
•Bei Bedarf richten eines Tablettes mit allen nötigen Utensilien, die dem zu Pflegenden beim Erbrechen nützlich sein können und dieses in Reichweite platzieren.
•Dokumentation aller verrichteten Maßnahmen, Beobachtungen, ärztlichen Anordnungen, Untersuchungen mit Ergebnissen …
•…
Erstellen Sie eine Auflistung meldepflichtiger Krankheiten. Geben Sie nach Rücksprache mit der Praxisanleitung kurz die Meldungskette wieder.
Die meldepflichtigen Krankheiten sind im Infektionsschutzgesetz § 6 IfSG aufgeführt.
Hier eine reduzierte Auswahl meldepflichtiger Krankheiten bei Verdachtsfall:
•Röteln
•Tollwut
•Mumps
•Masern
•Cholera
•Pest
•Virushepatitis
•Milzbrand (§ 6 IfSG)
•…
Hier eine reduzierte Auswahl meldepflichtiger Krankheiten bei Erkrankung und Tod:
•Behandlungspflichtige Tuberkulose
•Clostridioides-difficile-Infektion (§ 6 IfSG)
•…
Die Meldepflicht bei nachgewiesenen Erregern ist im § 7 IfSG aufgeführt. Die direkte Meldungskette kann je nach Setting und internem Hausstandard abweichen und kann hier nicht einheitlich dargestellt werden.
Beschreiben Sie den vorgeschriebenen Ablauf, den Mitarbeiter:innen einhalten müssen, wenn sie bei sich selbst Symptome einer der genannten Infektionskrankheiten wahrnehmen.
Berücksichtigen Sie die hausinternen Dienstanweisungen, mögliche Vorgaben können sein:
1.Von der Arbeit/dem Unterricht fernbleiben mit sofortiger Meldung bei Arbeitgebern und Schule.
2.Medizinische Abklärung der Symptome.
3.Rückmeldung über das Ergebnis an die Arbeitgeber und Schule.
4.Information an alle Kontaktpersonen innerhalb der Inkubationszeit.
5.Einhalten der vorgegeben Verhaltensregeln sowie der medizinischen Maßnahmen.
Leiten Sie mögliche Folgen ab, die sich für die Betroffenen aus den Rahmenbedingungen des Lockdowns oder der Quarantänezeit ergeben, und ergänzen Sie passende Maßnahmen, die ergriffen werden können, um die Einschränkungen erträglicher zu machen.
Der Einsatz der folgenden Maßnahmen ist immer abhängig von dem aktuellen Gesundheitszustand und den Interessen des zu Pflegenden sowie den personellen Ressourcen.
Zu beobachten waren unter anderem:
Mögliche Einschränkungen und deren Folgen
Gegenwirkende Maßnahmen im Bereich der Möglichkeiten
KontaktarmutVereinsamung
•Einzelbetreuung/Einzelaktivierung (Gespräche führen, Gedächtnistraining …)
•…
Religiöse Rituale fehlen im Tages-/Wochenablauf.
•Gottesdienste … werden im hauseigenen Fernseh-/Radiokanal übertragen.
•Einzelgebete unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen mit der hausinternen Seelsorge.
•Besuchsangebote verschiedener Glaubensgemeinschaften, sofern die gesetzlichen Vorgaben oder ergriffene Sicherheitsvorkehrungen z. B. am „Besucherfenster“ eingehalten werden.
•…
Bewegungsmangel Daraus resultiert:
•körperlicher Abbau,
•erhöhtes Kontrakturenrisiko,
•Gymnastische Übungen, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining … in der Einzelbegleitung.
•Bereitstellen von gymnastischen Geräten mit entsprechender Einführung (Gummibänder, Igelbälle, Hanteln, Hometrainer…)
•verringerte Ausdauer,
•Muskelabbau,
•erhöhtes Sturzrisiko,
•erhöhtes Thromboserisiko
•…
•Gezielte prophylaktische Maßnahmen in die Pflegeintervention integrieren.
•…
Verminderter Kontakt mit Familienangehörigen und Bekannten
•Bereitstellen von Endgeräten (iPad, Smartphone …).
•Bei Bedarf Begleitung der Videoanrufe z. B. durch FSJ`ler:innen, Betreuungskräfte, Sozialdienst …
•„Fensterbesuche“ ermöglichen.
•…
Reizarmut, LangeweileKognitiver Abbau
•Zeitschriften, Kreuzworträtsel, Bilderrätsel … zur Verfügung stellen.
•Basale Stimulation, wie:
•Musik/Hörspiele laufen lassen
•Duftöle einsetzen
•Radio/Fernseher bereitstellen
•Kunstausstellung in den eigenen vier Wänden (regelmäßig neue Bilder/Fotos/Wimmelbilder im Zimmer in Sichtweite anbringen).
Verlust des Zeitgefühls
•Orientierung durch Kalender, Uhren, geregelten Tagesablauf … bieten.
•Tagesaktuelle Informationen, z. B. aktuelle Nachrichten, Hinweis auf Feiertage … in der Pflege mit einbringen.
•Für einen strukturierten, immer wiederkehrenden Tagesablauf sorgen.
•…
Handhygiene – Basiswissen
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
Kompetenzbereiche:
III.1
III.2
V.1
V.2
In dieser Aufgabe geht es darum, die folgenden Aufgaben zu beantworten, um sich mit der Thematik auseinander zu setzen. Hier wird noch kein theoretisches Hintergrundwissen vorausgesetzt.
Arbeiten Sie die Situationen heraus, in denen Sie zu Ihrem jetzigen Wissensstand eine Handwaschung mit anschließendem Eincremen der Hände empfehlen würden.
•Vor Dienstbeginn
•Nach Dienstende
•Vor und nach der Pause (Eincremen nach Bedarf).
•Nach dem Rauchen (Eincremen nicht jedes Mal zwingend erforderlich).
•Nach dem eigenen Toilettengang (Eincremen nicht jedes Mal zwingend erforderlich).
•Bei Verschmutzung (Eincremen nicht jedes Mal zwingend erforderlich).
Definieren Sie, in welchen Situationen Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Handdesinfektion empfehlen würden.
•Vor Dienstbeginn
•Nach Dienstende
•Vor Kontakt zum zu pflegenden Menschen, auch vor dem Betreten des Zimmers.
•Nach dem Kontakt mit zu pflegenden Menschen, auch bei Verlassen des Zimmers.
•Nach dem Kontakt mit jeglichen Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung der zu pflegenden Menschen.
•Nach jeder Handschuhnutzung (nach dem Ausziehen der Handschuhe).
•Nach Kontakt mit unreinen und/oder infektiösen Materialien.
Berücksichtigen Sie die jeweilige Einwirkzeit des verwendeten Desinfektionsmittels, in der Regel beträgt diese 30 Sekunden (Tipp: zwei Mal das Lied „Alle meine Entchen“oderzwei Mal das Lied „Happy Birthday“ entsprechen ca. 30 Sek).
Erstellen Sie eine Auflistung mit Tätigkeiten, bei denen Sie instinktiv Handschuhe tragen würden.
•Bei der Intimpflege des zu Pflegenden
•Kontakt mit wirkstoffhaltigen Substanzen
•Bei der Wundversorgung
•Bei zu erwartendem Kontakt mit möglichen infektiösen Stoffen (Kot, Urin, Gewebsflüssigkeit, Blut, Pilzinfektionen …)
•Bei der Versorgung zu pflegender Menschen mit übertragbaren Krankheiten (Corona, MRSA, Norovirus, Windpocken …)
•Nutzung von Flächendesinfektionsmittel
•Bei Maßnahmen mit erhöhtem Infektionsrisiko (Injektionen, Infusionen, Blutentnahme, BZ-Messung …)
Handhygiene – Erweiterung
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
III.1
III.2
V.1
V.2
Bei der Ausarbeitung dieser Aufgabe wird theoretisches Hintergrundwissen vorausgesetzt und klare Aussagen gefordert, die in einem Gespräch begründet werden könnten.
Erläutern Sie die Situationen, in denen eine Handwaschung mit anschließendem Eincremen der Hände durchgeführt werden sollte.
Eine regelmäßige Hautpflege ist notwendig, um die Haut, die unter regelmäßiger Anwendung von Handdesinfektion und dem Tragen von Handschuhen sehr strapaziert wird, zu schützen und so vor Schädigungen zu bewahren.
•Bei Dienstbeginn
•Bei Dienstende
•Vor und nach der Pause (Eincremen nach Bedarf)
•Nach dem Rauchen (Eincremen nicht jedes Mal zwingend erforderlich)
•Nach dem eigenen Toilettengang (Eincremen nicht jedes Mal zwingend erforderlich
•Bei Verschmutzung (Eincremen nicht jedes Mal zwingend erforderlich)
•Das Eincremen soll vor dem Aufweichen der Haut, beispielsweise durch die Schweißbildung, während des Handschuhtragens schützen, um so die natürliche Schutzbarriere zu erhalten und die Haut vor Mikroläsionen zu bewahren
•Geeignete Hautpflegeprodukte enthalten weder Farb- noch Duftstoffe und wirken rückfettend
•Zur besseren Regeneration der Haut kann diese zusätzlich vor dem Schlafengehen erneut mit geeigneten Pflegeprodukten eingecremt werden
•Waschlotionen sollten ebenfalls frei von Duftstoffen sein, eine rückfettende Wirkung aufweisen und pH-neutral sein
•Zum Abtrocknen der Hände sind aus hygienischen Gründen Einmalhandtücher zu nutzen
Nennen Sie Indikatoren für die Anwendung einer fachgerechten Handdesinfektion.
•Bei Dienstbeginn
•Bei Dienstende
•Vor Kontakt zum zu pflegenden Menschen, auch vor dem Betreten des Zimmers
•Nach dem Kontakt mit zu pflegenden Menschen, auch bei Verlassen des Zimmers
•Nach dem Kontakt mit jeglichen Oberflächen in der unmittelbaren Umgebung der zu pflegenden Menschen
•Nach jeder Handschuhnutzung (nach dem Ausziehen der Handschuhe)
•Nach Kontakt mit unreinen und/oder infektiösen Materialien
•Berücksichtigen Sie die jeweilige Einwirkzeit des verwendeten Desinfektionsmittels, in der Regel beträgt diese 30 Sekunden (Tipp: zwei Mal das „Lied Alle meine Entchen“ oder zwei Mal das Lied „Happy Birthday“ entsprechen ca. 30 Sek)
•Zur optimalen Wirkweise sollten die Hände vor der Handdesinfektion trocken sein, um das Desinfektionsmittel nicht zu verdünnen
•Nach Möglichkeit sollten Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion eine rückfettende Wirkung aufweisen
Definieren Sie, in welchen Situationen das Tragen von Handschuhen unabdingbar ist, beachten Sie dabei die ökologischen und ökonomischen Aspekte.
•Bei der Intimpflege des zu Pflegenden
•Bei Kontakt mit wirkstoffhaltigen Substanzen
•Bei der Wundversorgung
•Bei zu erwartendem Kontakt mit möglichen infektiösen Stoffen (Kot, Urin, Gewebsflüssigkeit, Blut)
•Bei der Versorgung zu pflegender Menschen mit übertragbaren Krankheiten (Corona, MRSA, Norovirus, Windpocken …)
•Nutzung von Flächendesinfektionsmittel
•Bei Maßnahmen mit erhöhtem Infektionsrisiko: Injektionen, Infusionen, Blutentnahme, BZ-Messung
•Handschuhe werden aus hygienischen Gründen nicht in den Kitteltaschen gesammelt
Vergleichen Sie die Inhaltsstoffe von Hand- und Flächendesinfektionsmitteln.
Arbeiten Sie Unterschiede sowie Übereinstimmungen heraus.
Diese Aufgabe hängt von den in der Einrichtung genutzten Produkten ab. Generell gilt jedoch:
Flächendesinfektionsmittel sind in der Regel schärfer als Handdesinfektionsmittel, da materielle Oberflächen nicht so empfindlich sind wie die Haut. Allerdings gibt es auch sehr empfindliche Oberflächen, daher sollten Desinfektions- aber auch sonstige Reinigungsmittel beim ersten Einsatz erst an einer unauffälligen Stelle ausprobiert werden.
Zu einem großen Teil bestehen Desinfektionsmittel aus Alkoholen (Ethanol, 1-Propanol und 2-Propanol). Die weiteren Inhaltsstoffe oder deren Konzentration können je nach Einsatzzweck variieren, hierbei kommt es auf die zu beseitigenden Erreger an.
Erstellen Sie eine Liste der Desinfektionsmittel, die in Ihrem Einsatzbereich verwendet werden, und notieren Sie Einwirkzeit sowie Verwendungszweck.
Diese Aufgabe hängt von den in der Einrichtung genutzten Produkten ab, dennoch sollen hier mögliche Antworten angeboten werden:
Produkt
Verwendung
Einwirkzeit
Incidin Alcohol Wipe
•Flächendesinfektion
•Alkoholische Schnelldesinfektion
•Die getränkten Tücher können zwei Monate lang genutzt werden.
•Nicht über 25°C Lagern
•Mit Anbruchdatum und Ablaufdatum versehen
•Bei der Verwendung müssen Handschuhe getragen werden.
•Behälter nach Gebrauch gut verschließen
•Bei alkoholbeständigen Oberflächen einsetzbar
•Fläche muss vollständig benetzt seinQuelle: vgl. https://www.ecolabhealthcare.de/website/seiten/produkte/flaechendesinfektion/tuecher/incidin_alcohol_wipe.php
•…
Variiert je nach Einsatzzweck
Beispiel laut DVV/RKI-Leitlinie:
Norovirus
10 Minuten und Rotavirus 30 Sekunden.
Quelle: vgl. https://www.ecolabhealthcare.de/website/seiten/produkte/flaechendesinfektion/tuecher/incidin_alcohol_wipe.php
Sterillium pure
•Handdesinfektion zur hygienischen und chirurgischen Handdesinfektion
•Hautdesinfektion vor Punktionen und Injektionen
•Anwendung nach den „sechs Schritten“ der Handdesinfektion
•Dosierung: 3 ml zur HanddesinfektionQuelle: vgl. https://produktkatalog.bode-chemie.de/produkte/haende/produktblaetter/Sterillium_pure.pdf
•…
30 Sekunden
Quelle: https://produktkatalog.bode-chemie.de/produkte/haende/produktblaetter/Sterillium_pure.pdf
Erläutern Sie, warum Sie nach einer Pflegetätigkeit eine Handdesinfektion durchführen sollen, obwohl sie während der Tätigkeit Handschuhe getragen haben.
•Nach dem Tragen von Handschuhen bei der Durchführung einer Pflegemaßnahme werden die Hände desinfiziert, da beim Ausziehen der Handschuhe eine Kontaminationsgefahr besteht und durch die Handdesinfektion das Verteilungsrisiko der Erreger minimiert wird.
•Geeignete Handschuhe (Herstellerhinweis beachten!) können im Ausnahmefall mit üblichem Handdesinfektionsmittel zwischenzeitlich behandelt werden. Bei dauerhaftem Tragen erhöht sich die Gefahr, dass die Handschuhe undicht werden, die Hände aufweichen und somit die eigene Schutzbarriere zerstört wird.
Neuaufnahme
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.1I
II.2
IV.1
Notieren Sie die Informationen, die Ihnen innerhalb Ihres aktuellen Einsatzortes wichtig erscheinen. Im Anschluss lassen Sie sich den gängigen Anamnesebogen und alle weiteren Instrumente zum Aufnahmeablauf zeigen und vergleichen die Inhalte mit Ihrer Ausarbeitung.
Wichtig für alle Settings sind in der Regel:
•Vor- und Nachname
•Geburtsdatum
•Rechnungsstelle (Krankenkasse/Pflegekasse/Rechnungsadresse bei Privatzahlern …)
•Medizinische Diagnosen
•Medikamentenplan
•Ansprechperson, Bezugsperson
•Bestehende gesetzliche Betreuung (mit Zuständigkeitsbereich)
•Bestehende Allergien
•Patientenverfügung
•…
Befassen Sie sich ausführlich mit dem Hausstandard, in dem der Ablauf einer Neuaufnahme geregelt ist.
Notieren Sie anschließend den Ablauf stichpunktartig in chronologischer Reihenfolge. Lassen Sie sich unklare To-dos mit deren Notwendigkeit erläutern.
Da hier nicht alle Abläufe dargestellt werden können, jedes Setting seine eigenen Schwerpunkte hat, wird hier die Situation in der stationären Langzeitpflege gewählt, da diese sich am umfangreichsten dazustellen scheint.
•Dokumente und Formalitäten sind so weit wie möglich bereits im Vorfeld mit dem/der zu Pflegenden oder/und seinen/ihren Angehörigen durchgearbeitet und unterschrieben.
•Anmeldebogen
•Ärztliche Verordnungen
•Medikamentenplan
•Negativnachweise, sofern gefordert (Corona, MRSA …)
•Vorsorgevollmacht
•Patientenverfügung
•Pflegegradbestätigung
•Betreuungsurkunde, wenn vorhanden
•Heimvertrag
•Kopien von Arztbriefen
•…
•Im Vorfeld bereits zu erledigen
•Zimmer für den Einzug nach Bedarf streichen, lüften, säubern …
•Zimmertür ist mit dem Namen beschriftet und je nach Einrichtung mit Bild versehen
•Eigene Möbel aufbauen lassen
•Bett und Nachttisch einladend vorbereiten
•Checkliste Heimeinzug (Konzept Neueinzug) - falls vorhanden - vorbereiten
•Bezugsperson in der Einrichtung festlegen und informieren
•Zu Pflegende:n im internen Dokumentationssystem mit allen bisher vorhanden Informationen hinterlegen
•…
•Tag des Einzuges
•Begrüßung durch Pflegedienstleitung, Bezugsperson …
•Direkte Sitznachbarn, Zimmernachbar (Doppelzimmer stellen in der stationären Langzeitpflege ein auslaufendes Modell dar) vorstellen
•Medikamente (Vorräte von zu Hause) nach Möglichkeit von den Angehörigen mitbringen lassen
•Rundgang auf dem Wohnbereich (auf Orientierungshilfen hinweisen)
•Erläutern der Klingelanlage
•Toiletten in der Nähe zeigen
•Essensbestellung für den Tag und die Woche, je nach hauseigener Struktur durchführen
•Schnittstellenmanagement (Information des Neueinzuges an Hauswirtschaft, Küche, Verwaltung, Sozialarbeiter …)
•Kontakt zum zu Pflegenden halten, aber nicht einengen und überfordern, genügend Freiräume einräumen
•Dokumentation der Beobachtungen und Wahrnehmungen des ersten Tages
•Zusätzliche Orientierungshilfen platzieren, z. B. Namensschild am Essensplatz
•…
•Zeitnah nach dem Einzug zu organisieren
•Krankenkassenkarte, Impfausweis, Personalausweis hinterlegen
•Weitere Kollegen vorstellen
•Persönliche Hilfsmittel (Rollator, Rollstuhl …) beschriften
•Erneuter Rundgang im Haus (auf Orientierungshilfen hinweisen)
•Kontakt mit Haus- und Fachärzten aufnehmen (Information über den Umzug, evtl. Termin zum Hausbesuch ausmachen)
•Vitalwerte als Richtwerte erfassen und dokumentieren
•Hautbeobachtung (Defekte jeglicher Art dokumentieren ggf. mit Bildaufnahmen)
•Informationssammlung für SIS oder Pflegeplanung erfassen
•Erfassen von Ressourcen und Defiziten
•Risikoeinschätzung vornehmen
•Umfängliche Dokumentation der Beobachtungen, Informationen … die in den ersten Tagen zusätzlich erfasst werden konnten
•…
Nennen Sie mindestens zehn pflegerelevante Werte, Angaben, Besonderheiten und/oder Auffälligkeiten, die direkt nach dem Einzug erhoben/in Erfahrung gebracht und dokumentiert werden sollten.
•Erfassung der Vitalparameter (je nach Bedarf oder Vorgabe: RR, Puls, Atmung, BZ, Sauerstoffsättigung, Gewicht, Temperatur)
•Krankenkasse, Rechnungsadresse erfassen
•Hautzustand dokumentieren (Wunden, Hämatome, Dekubiti, Ausschläge, Pilzbefall …)
•Sofern gefordert negative Testergebnisse (MRSA, Corona, TBC …) erfassen
•Bekannte medizinische Diagnosen
•Bestehende ärztliche Anordnungen (Wundversorgung, Vitalzeichenüberprüfung, Medikamente: Besonders wichtig Notfallmedikation wie Nifedipinspray®, Diacepam® …)
•Bestehende Einschränkungen. (Bewegung, Orientierung, Dysphagie, Allergien …)
•Hilfebedarf bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten
•Kostform und Essenswünsche
•Gerichtliche Anordnungen. (bestehende Betreuung, genehmigte freiheitsentziehende Maßnahmen, Zwangsmedikamentierung …)
•Erfassen eigener benötigter Hilfsmittel: Hörgeräte, Brille, Gehhilfe, Rollator, Rollstuhl, Zahnprothesen, Arm- oder Beinprothesen, Kompressionsstrümpfe …
Begleiten Sie im ersten Schritt nach Möglichkeit ein Aufnahmegespräch, machen Sie sich entsprechende Notizen und klären Sie im Nachgang evtl. offene Fragen zum Ablauf/Inhalt.
Die Abläufe eines Aufnahme-/Anamnesegespräches sind im jeweiligen Hausstandard hinterlegt und sind von den jeweiligen Strukturen der Einrichtung abhängig. Mögliche Strukturen können sein:
•Im stationären Akuteinsatz liegt das Anamnesegespräch in der Zuständigkeit der Ärzte, zwar kann auch eine Pflegefachkraft die Angaben schriftlich festhalten, jedoch müssen die zuständigen Ärzte die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben in einem Gespräch mit den zu Pflegenden oder deren Angehörigen abfragen, überprüfen, im Bedarfsfall ergänzen oder abändern.
•Zu Beginn des Aufnahmegespräches sollten sich die Gesprächspartner:innen (Pflegefachkräfte, Pflegedienstleitung, Ärzte …) namentlich, mit der jeweiligen Funktion in der Einrichtung vorstellen.
•Im stationären Akuteinsatz sollte nach Möglichkeit besonders bei angekündigten Aufnahmen das Zimmer einladend hergerichtet sein (bei notfallmäßigen Aufnahmen nicht möglich): Zimmer frisch gelüftet, Rollladen oben/Vorhänge auf, Klingel/Lichter sind auf Funktionsfähigkeit geprüft, Bett frisch bezogen und einladend hergerichtet, Getränk und frisches Glas auf dem Tisch bereitgestellt …
•Im stationären Akuteinsatz wird nach Möglichkeit die Krankenkassenkarte eingelesen, wodurch die Stammdaten in das System eingelesen und Patientenaufkleber erstellt werden können. Datenschutzvereinbarung, Versorgungsvertrag, falls vorhanden Einwilligung zur Nutzung des Patientenboards im Zimmer werden vom zu Pflegenden oder seinen gesetzlichen Vertretern unterzeichnet.
•Im stationären Langzeitbereich sind im Idealfall alle Formalitäten bereits vor dem Tag des Einzuges erledigt worden. Stammdaten sind bereits im PC hinterlegt, der Heimvertrag und Datenschutzvereinbarung sind vom zu Pflegenden oder seinen gesetzlichen Vertretern unterschrieben.
Im Vorfeld sollte das Zimmer hergerichtet sein: evtl. frisch gestrichen, Zimmer frisch gelüftet, Rollladen oben/Vorhänge auf, nach Möglichkeit sind bereits eigene Möbel/Radio/Fernseher/Bilder vor Ort, Klingel/Lichter sind auf Funktionsfähigkeit geprüft, Bett frisch bezogen und einladend hergerichtet, Willkommenskarte auf dem Tisch, Blumen zur Begrüßung, Getränk und frisches Glas auf dem Tisch bereitgestellt …
Weiteres Vorgehen stationärer Langzeitbereich (Abhängig vom Allgemeinzustand):
•Hausrundgang
•Vorstellung der Bezugsperson
•Vorstellung weiterer Mitarbeiter:innen und Mitbewohner:innen
•Erläuterung des Tagesablaufes (Essenszeiten, Aktivierungsprogramm …)
•…
Die Arbeitsabläufe und Prioritäten in den verschiedenen Versorgungsbereichen können sehr unterschiedlich ausfallen.
Arbeiten Sie mindestens drei verschiedene Schwerpunkte heraus, die bei einer ersten Datenerfassung in den verschiedenen Pflegebereichen bei einer Neuaufnahme unverzichtbar sind.
Ambulante Pflege
Stationäre Langzeitpflege
Stationäre Akutpflege
•Vor- und Nachname
•Zu erbringende Leistungen
•Ärztliche Verordnungen bei Behandlungspflege
•Adresse, an der die Leistungen zu erbringen sind
•Zeitplanung der Versorgungsbesuche (Wochentage, Uhrzeiten …)
•…
•Vor- und Nachname
•Bisherige Gewohnheiten zur Tagesstruktur (Vorlieben, Wünsche …)
•Biografische Rahmenbedingungen
•Ärztliche Anordnungen (Medikamentenplan …)
•Ansprechpersonen (Angehörige, behandelnde Ärzte …)
•…
•Vor- und Nachname
•Krankenkasse, Rechnungsadresse
•Aufnahmegrund
•Bestehende Diagnosen
•Medikamentenplan
•Allergien
•…
Begründen Sie die Wichtigkeit der folgenden Dokumente bzw. in welchen Situationen sie vorliegen müssen. Notieren Sie sich den jeweiligen Aufbewahrungsort.
Die Aufbewahrungsorte sind von den jeweiligen Strukturen der Einrichtung abhängig. Hier können nur Möglichkeiten der Aufbewahrung angeboten werden.
Dokumentenart
Verwendungszwecke, Aufbewahrungsort
Personalausweis
Im Todesfall und für die Teilnahme an politischen Wahlen.
In stationären Langzeiteinrichtungen oft bei den Unterlagen des zu Pflegenden, für Unbefugte unzugänglich, aufbewahrt.
In den Settings stationäre Akutpflege und ambulante Langzeitpflege bleiben persönliche Dokumente im Regelfall in Obhut der zu Pflegenden oder deren Angehörigen (bei KindernEltern).
Krankenversichertenkarte
Muss quartalsmäßig beim Hausarzt und bei sonstigen Arzt- oder Krankenhausbesuchen vorgelegt werden.
In stationären Langzeiteinrichtungen oft bei den Unterlagen des zu Pflegenden, für Unbefugte unzugänglich, aufbewahrt.
In den Settings stationäre Akutpflege und ambulante Langzeitpflege bleiben persönliche Dokumente im Regelfall in Obhut der zu Pflegenden oder deren Angehörigen (bei KindernEltern).
Vorsorgevollmacht
Die Vorsorgevollmacht wird von einem Vollmachtgeber einem Vollmachtnehmer gegeben. Dieser ist dann berechtigt, den Vollmachtgeber in genannten Bereichen zu vertreten. Hierzu zählen beispielsweise die Aufenthaltsbestimmung, Finanzen, Postregelungen, Vergabe von Untervollmachten etc. Siehe Aufgabe Einwilligungsfähigkeit.
Sollte eine Vorsorgevollmacht bestehen, sollte der aktuelle Aufbewahrungsort der Unterlagen den Pflegenden und den Angehörigen bekannt sein.
In stationären Langzeiteinrichtungen, Akutpflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten wird oft eine Vorsorgevollmacht in Kopie bei den Unterlagen des zu Pflegenden aufbewahrt. Originale bleiben im Regelfall bei den Vollmachtnehmern.
Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung kann jeder Mensch seine individuellen Wünsche zu medizinischen Eingriffen und Behandlungen schriftlich festhalten. Ärzte und Pflegepersonal sind gehalten, sich nach den formulierten Wünschen des Patienten zu richten. Eine sehr detaillierte Formulierung sollte bei der Erstellung beachtet werde, um mögliche Interpretationsfehler zu vermeiden.
Siehe Aufgabe Einwilligungsfähigkeit.
Die Patientenverfügung mit ihrem groben Inhalt und dem aktuellen Aufbewahrungsort sollte den Pflegenden und den Angehörigen bekannt sein.
In stationären Langzeiteinrichtungen, Akutpflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten wird oft eine Patientenverfügung in Kopie bei den Unterlagen des zu Pflegenden aufbewahrt. Originale bleiben im Regelfall bei den Angehörigen/Betreuern oder den zu pflegenden Menschen.
Betreuungsurkunde
Sobald eine gesetzliche Betreuung besteht, sollte diese mit den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen des Betreuenden in den Patientenunterlagen als Kopie hinterlegt sein.
Dieses Dokument befähigt den bestellten Betreuer, im Sinne des zu Pflegenden, dessen Geschäfte im Rahmen des festgelegten Aufgabenbereiches (z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Finanzen, Post …) weiterzuführen. Der bestellte Betreuer steht unter Kontrolle des Betreuungsgerichtes.
Orientierung in der Einrichtung (TpA)
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
Kompetenzbereiche:
I.4
III.1
III.3
IV.1
V.2
Die komplette Aufgabe 1.7 „Orientierung in der Einrichtung“ ist eine individuelle Aufgabe und kann nur vor Ort in der Einrichtung durchgeführt und beantwortet werden.
Schnittstellenmanagement
Niveau:
1. Ausbildungsdrittel
Geltungsbereich:
Orientierungseinsatz
stationäre Langzeitpflege
stationäre Akutpflege
ambulante Pflege
Kompetenzbereiche:
II.1
III.1
III.2
III.3
IV.2
Definieren Sie den Begriff Schnittstelle. Unterscheiden Sie dabei interne und externe Schnittstellen.
•Als Schnittstelle in diesem Zusammenhang können alle Übergangs- und Verbindungsstellen/Kontaktpunkte bezeichnet werden, die für die Leistungserbringung erforderlich sind.
•Als interne Schnittstellen werden jene bezeichnet, die innerhalb der Einrichtung stattfinden (beispielsweise die Station gibt die Lebensmittelbestellung an die Küche durch).
•Externe Schnittstellen sind jene Kontaktpunkte, die die Einrichtung mit der Außenwelt verbinden (beispielsweise Rezepte werden beim Hausarzt bestellt, Termine zum Hausbesuch werden vereinbart, der ambulante Dienst wird informiert, dass der zu pflegende Mensch nach Hause entlassen wird).
Jede Pflegeeinrichtung hat sehr viele Schnittstellen. Vervollständigen Sie jeweils das Mindmap für interne und externe Schnittstellen. Markieren Sie die Schnittstellen, mit denen Sie häufig in Berührung kommen, in einer anderen Farbe.
Diese Aufgabe hängt von den einrichtungsinternen Strukturen ab, dennoch sollen hier mögliche Antworten angeboten werden. Zur vereinfachten Darstellung umfasst die Bezeichnung Stationsmitarbeiter:innen alle Mitarbeiter:innen im ambulanten und stationären Bereich und kann auch die Stationsleitung und/oder Bereichsleitung umfassen.
Abbildung 1.1: Interne Schnittstellen
Abbildung 1.2: Externe Schnittstellen
„Das Schnittstellenmanagement ist ein sehr wichtiger Teil des Qualitätsmanagements.“ Bewerten Sie diese Aussage.
Im Rahmen eines gelungenen Schnittstellenmanagement können:
•Synergien und Ressourcen optimal genutzt werden
•Reibungspunkte und Missverständnisse minimiert werden
•Produktivität und Effizienz gesteigert werden
•Die Umsetzung von Experten- und Hausstandards erleichtert werden
•…
Erarbeiten Sie jeweils fünf bestehende Instrumente/Tätigkeiten, die in Ihrer Einrichtung umgesetzt werden, um einen erfolgreichen Austausch zwischen den Schnittstellen zu ermöglichen und zu gewährleisten. Bringen Sie eine eigene Idee mit ein, wie/wo das Schnittstellenmanagement zu verbessern wäre.
Diese Aufgabe hängt von den einrichtungsinternen Strukturen ab, dennoch sollen hier mögliche Antworten angeboten werden:
Intern:
•Einheitliche Bestellformulare digital oder/und analog (beispielsweise Essensbestellung)
•Digitale oder/und analoge Vordrucke/Checklisten (beispielsweise für Sturzprotokolle)
•Ablagefächer zur Informations- und Auftragsweitergabe (Hausmeister, Abrechnung …)
•Digitales Kommunikationssystem, z. B. Microsoft Teams. Informationsweitergabe per Mail
•…
Extern:
•Digitale oder/und analoge Vordrucke (beispielsweise für Sturzprotokoll, Menübestellungen bei Essen auf Rädern …)
•Feste themenbezogene Ansprechpersonen
•Zugriff auf Telefon- und Faxnummerübersichten
•Anlegen fester themenbezogener E-Mail-Verteiler
•…