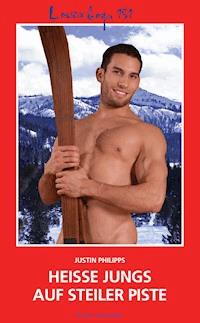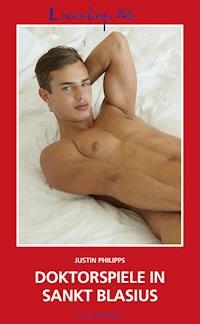Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Loverboys
- Sprache: Deutsch
Jeden Abend schwingt der junge Callum seine sportlichen Schenkel um harte Stangen: Als Tänzer im berüchtigtsten Strip-Club der Stadt bringt er das Blut der Gäste in Wallung, und bei seinen Private Dance Sessions geht er mit den zahlungskräftigen Männern auf Tuchfühlung -- nur richtiger Sex ist tabu! Als jedoch eines Abends der attraktive Antoine den Club besucht, schmelzen auch die letzten Hemmungen im heißen Dunst des Lusttempels dahin …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Loverboys 154
PRIVATE DANCER
Ein Boy an der Stange
JUSTIN PHILIPPS
Loverboys 154
© 2018 Salzgeber & Co. Medien GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
Umschlagabbildung: © George Duroy, USA
www.belamionline.com (Model: Lars)
Printed in Germany
ISBN 978-3-95985-305-7
eISBN 978-3-95985-347-7
Die in diesem Buch geschildertenHandlungen sind fiktiv.
Im verantwortungsbewusstensexuellen Umgang miteinander geltennach wie vor die Safer-Sex-Regeln.
Inhalt
Licht am Ende des Tunnels
Yannick
An der Stange
Ruhm und Neid
Taxi Boy
Antoine
Ein blauer Schmetterling
Mont Royal
Fleshjack
Private Private
Beachboys
Versprochen
Männertausch
Happy Birthday
Séparée
That’s What Friends Are For
Das Casting
Auf der Campus-Klappe
Kriegsrat
Dinner for Four
Ritz-Carlton
Versprochen
Boy Academy
Licht am Ende des Tunnels
Die U-Bahn jagte durch den Schacht. Meine Reisetasche hatte ich auf dem Boden abgestellt und fest zwischen die Füße geklemmt. Je näher wir der Innenstadt kamen, desto voller wurde es im Waggon. Menschen starrten stumm ins Leere. Großstadtgesichter, geübt darin, die Umgebung nicht mehr wahrzunehmen und sich wie in Trance durch die Adern der Metropole transportieren zu lassen. Einzig Touristen mit großen Rucksäcken blickten wach und hektisch umher und verfolgten aufmerksam, mit zusammengekniffenen Augen, auf den Linienplänen an der Decke unsere Route. Ich fragte mich, ob die Verkehrsgesellschaft von Montreal die Metropläne absichtlich an die Decke geklebt hatte, damit Taschendiebe sich leichter an den Rucksäcken zu schaffen machen konnten? Immer wenn der Zug eine Kurve nahm, gaben die Stahlräder einen schrillen Ton von sich, der mich an die Schreie hysterischer Mädchen in Horrorfilmen erinnerte. Ich mochte dieses Geräusch nicht. Und hysterische Mädchen mochte ich auch nicht.
Ich betrachtete mein Gesicht, das sich in der dunklen Scheibe spiegelte. Es hatte sich in den vergangenen Monaten verändert. Ich war erwachsen geworden – ohne dass ich genau hätte sagen können, wann das passiert war. Sah mein Gesicht im Spiegel nicht jeden Morgen genauso aus wie am Vorabend? Mein kräftiger Unterkiefer und die tief liegenden Augenbrauen ließen mich männlicher erscheinen als noch vor einem Jahr. Die hohen Wangenknochen, der volle Mund und vor allen Dingen meine verträumten, blauen Augen bildeten wiederum einen jungenhaften Kontrast. Auch meine blonde Mähne, die ich mit viel Hingabe und Gel in ein kunstvolles Durcheinander gebracht hatte, unterstrich meine jugendlichen Züge. Die Schatten der vorbeirauschenden Stützpfeiler huschten in gleichbleibendem Takt über mein Spiegelbild. Mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms wischten sie wieder und wieder über meine glatte Haut.
Ein Lächeln legte sich auf meine Lippen. Ich fühlte mich gut. Ich hatte alles Schlechte hinter mir gelassen. Davon war ich überzeugt. Ich hatte mein Leben in eine Reisetasche gestopft und mich auf den Weg gemacht, hatte beschlossen, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – endlich! Eine glückliche Zukunft schien mir zum Greifen nah. Der Gedanke, dass ich versagen könnte, kam mir gar nicht erst. Ich konnte nicht scheitern – nicht mit diesem Gesicht.
Surrende Deckenventilatoren wirbelten unerträglich warme Luft ins Innere des Waggons. Es war der erste heiße Tag des Jahres. Mir gegenüber saß eine Gruppe Jungs, sie trugen Shorts, denen der lange Winterschlaf in der hintersten Ecke des Schrankes unansehnliche Knitterfalten beschert hatte. Ihre Beine hatten lange keine Sonne gesehen. Sie waren hell – fast weiß. Ein weicher Flaum dunkler Härchen schmiegte sich um die junge, glänzende Haut. Ihre Füße steckten in weißen Sneakern.
Ich mochte Shorts. Ich mochte Beine mit weichem Flaum. Und ich mochte Jungs mit weißen Sneakern.
Vermutlich würden sie an der Station UQAM, der Université du Québec à Montréal, aussteigen. Nicht nur die Bücher, die aus ihren Beuteln ragten, ließen darauf schließen, dass sie auf dem Weg zur Uni waren. Vielmehr hatten ihre Gesichter einen Ausdruck, wie ich ihn nur von Studenten kannte. Spürbar selbstbewusst. Und irgendwie vornehm! Aus gutem Hause eben. Sie waren in Mont Royal zugestiegen, der neuen Hipstergegend. Professorensöhnchen vermutlich.
Auch ich würde an der UQAM aussteigen. Allerdings würde mich mein Weg nach Norden führen, in die Rue Sainte-Catherine. Ich hatte dort ein Vorstellungsgespräch – oder sollte ich besser sagen: ein Casting? Ich war mit Monsieur Charles, dem Besitzer des Cocks verabredet. Das Cocks war eine über die Grenzen Montreals hinaus bekannte schwule Bar, in der gut gebaute Jungs sich auf der Bühne auszogen, um dann für ein paar Dollar mit sabbernden Kunden in Kabinen zu verschwinden. Private Dance nannten sie das wohl. Ich kannte das Cocks bislang nur von außen. Ein paarmal war ich durch die Rue Sainte-Catherine, die Hauptstraße des Schwulenviertels, geschlichen, hatte aus den Augenwinkeln Jungs und Kerle auf den Terrassen begafft und mir ihre Gesichter und Körper eingeprägt, um mir vor dem Einschlafen darauf einen runterzuholen.
Nie hatte ich mich getraut, in eine solche Bar zu gehen und einen Typen anzusprechen. Erst recht hatte ich es nicht gewagt, einen Fuß ins Cocks zu setzen, das mit seinen hell erleuchteten, überdimensionierten Plakaten das ganze Viertel dominierte. Kerle mit nackten und durchaus ansehnlichen Oberkörpern prangten auf diesen Plakaten, die mich an jene Riesenbanner aus meiner Kindheit erinnerten, die über den Eingängen von Kinos angebracht wurden. Mit laszivem Ausdruck und offener Jeans schauten diese Götter aus Muskeln und Haut hinab auf die Rue Sainte-Catherine und nötigten Passanten verstohlene und manchmal auch unverhohlene Blicke ab.
Die Internetseite des Cocks war eine meiner liebsten Wichsvorlagen. Von jedem Tänzer gab es dort einen kurzen Videoclip. Ein Typ namens Yannick hatte es mir besonders angetan. Wie alle Tänzer im Cocks hatte er diesen perfekt geformten, muskulösen Oberkörper. Obwohl seine Oberarme und seine Brustmuskeln gewaltig waren, wirkten sie überhaupt nicht bullig – eher drahtig-elegant. Yannick schien etwas größer zu sein als seine Kollegen. Seine Beine waren lang, schlank und mit blonden Härchen überzogen. Ich fuhr schon immer auf schöne Männerbeine ab, und Yannicks Beine waren perfekt. Im Video zog er sich nicht komplett aus. Die letzte Einstellung zeigte ihn mit einem blauen Slip von PUMP bekleidet. Das Paket darin schien vielversprechend. Sein Schwanz, den er quer gelegt hatte, drängte so sehr gegen den Stoff, dass es ein Leichtes war, den Umriss der Eichel auszumachen.
Das Beste an Yannick aber war sein Gesicht. Es hatte so etwas Freches, Jungenhaftes, fast schon Unschuldiges, das gar nicht so recht zu den provokanten Bewegungen seines Beckens passen wollte. Wenn er tanzte, berührte er sich, strich sich zärtlich über die wohlgeformte Brust, schloss dabei die bernsteinbraunen Augen, um im nächsten Moment direkt und fordernd in die Kamera zu schauen – ein Blick, der mich jedes Mal im Unterleib traf. Hätte ich all das Sperma, das ich beim Betrachten dieser Augen schon verschossen hatte, gesammelt, wäre ich vermutlich im Besitz der größten Samenbank des amerikanischen Kontinents.
Wenn ich es heute nicht versaute, dann gäbe es vielleicht bald auch von mir einen kleinen Videoclip auf der Seite des Cocks, und Yannick wäre mein Kollege. Glänzende Aussichten!
Die Jungs auf den Sitzen gegenüber erzählten von ihrem letzten Urlaub. Einer sagte, dass er zum Skifahren in Österreich gewesen sei. Gleich würde er sein iPhone zücken, um seinen Kommilitonen stolz Selfies mit Alpenpanorama zu präsentieren. Als ob wir hier in Kanada keine Berge hätten! Der Typ rechts außen, ein Wuschelkopf, warf mir hin und wieder merkwürdige Blicke zu. Immer wenn sich unsere Augen trafen, schaute ich rasch ins dunkle Fenster.
Ich kannte diese Professorensöhnchen wie meine Westentasche. Bei uns in Laval rannten eine Menge davon herum – natürlich nicht in der Gegend, in der Mama und ich wohnten. Oder sollte ich sagen: gewohnt hatten? Gestern hatten sie Mama wieder eingeliefert. Die gefühlt hundertste Entziehungskur stand bevor. Es würde nicht mehr lange dauern, und die Inkassobüros würden ihre Rottweiler vorbeischicken, um unsere jämmerlichen Habseligkeiten zu pfänden und mich aus der Wohnung zu jagen. Ins Heim konnten sie mich nicht mehr stecken, schließlich war ich 18. Und dieses Mal war ich ihnen zuvorgekommen. Alles, was irgendwie Wert hatte und transportabel war, befand sich in meiner Reisetasche: mein Laptop, Mamas goldene Ohrringe, die Kaffeedose, in der sie ihre gesamten Ersparnisse – 600 Dollar – aufbewahrte, und ein Album mit meinen Kinderfotos. ›Mon petit garçon Callum‹ hatte sie die erste Seite mit einem goldenen Stift betitelt. Darunter Fotos von einer strahlenden, jungen Frau, die stolz auf ein Baby schaut. Sie war hübsch, meine Mama, bevor sie zu trinken begann und Zigarettenrauch ihre Haut fahl werden ließ. Sie hatte hohe Wangenknochen und einen vollen Mund – irgendwie erinnerte sie mich immer an Angelina Jolie. Ich habe dieselben Wangenknochen und denselben Mund wie meine Mama.
»Das einzig Gute, das sie dir mitgegeben hat«, hatte mein Erzeuger bei einem seiner seltenen Besuchen abfällig kommentiert.
Im Gegensatz zu Angelina hatte es meine Mama nicht verstanden, ihre Schönheit gewinnbringend zu nutzen. Die Typen, die sie nach Hause brachte, erinnerten optisch nicht einmal im Entferntesten an Brad Pitt und hatten meist auch keinen besonders guten Charakter. Meine Mutter war eine jener Schönheiten, die von Männern ausgenutzt und gedemütigt werden.
Ich wollte es anders machen. Komplett anders. Mein Aussehen war mein Kapital. Und dieses Kapital würde ich zu nutzen wissen. Niemand würde mich demütigen. Das hatte ich beschlossen, und zwar nicht erst, als ich zum ersten Mal auf der Internetseite des Cocks über das Bewerbungsformular für Tänzer gestolpert war. ›Devenir danseur‹ hatte da gestanden. Werden Sie Tänzer! Doch viel früher hatte ich schon verstanden, welche Macht ich mit meinem Körper ausüben konnte. Ich wusste es seit jenem Sommertag, an dem ich vergessen hatte, das Fenster im Bad zu schließen, und nackt aus der Dusche trat. Mein nasses Haar klebte mir an der Stirn, und Wassertropfen rannen meinen Körper hinab, suchten sich ihren Weg über Brustwarzen und Bauchnabel zu meinem Schwanz, der zwischen meinen schlanken Beinen baumelte. Ich hatte Monsieur Guillot zunächst nicht bemerkt. Erst als ich mir den Rücken abtrocknete, sah ich ihn: unseren Nachbarn, Vater zweier reizender Töchter, ein Mustergatte, der augenscheinlich auch über einen Musterschwanz verfügte, an dem er sich hinter dem Fenster seines Schlafzimmers zu schaffen machte, während er auf meinen Schwengel stierte. Er hatte in der Tat ein stattliches Gerät mit einer dicken Eichel, über die er beim Wichsen wieder und wieder mit dem Daumen rieb – eine interessante Technik, wie ich fand. Er war Anfang 30 und durchaus attraktiv, etwas bullig zwar – vermutlich hatte er in seiner Jugend Rugby gespielt –, aber insgesamt doch mein Typ. Es war aber nicht der Körper Monsieur Guillots, der mich erregte, nicht der Anblick seines Schwanzes mit der beachtlichen Eichel ließ meinen eigenen Riemen zucken. Es war sein Blick!
Diese stierenden Augen, die offenbar die Welt um sich herum vergessen hatten und sich schamlos in meinen Unterleib bohrten, ließen mir das Blut in den Adern – und Schwellkörpern – pochen. Ich beobachtete Monsieur Guillot nur aus den Augenwinkeln, tat so, als ignorierte ich ihn, während sich mein Schwanz langsam aufrichtete. Allein das Wissen, dass mein Nachbar so sehr durch meinen nackten Körper aufgegeilt wurde, dass es ihm egal war, ob er entdeckt werden könnte, ließ meinen Riemen wachsen. Monsieur Guillot steigerte sein Wichstempo, die Augen auf meinen Ständer gerichtet. Sein Blick war wie hypnotisiert. Er wirkte apathisch, fast hilflos und verletzlich. Ich spürte, dass er alles mit sich hätte machen lassen. Ein Wort von mir, ein Blick oder ein kurzes, autoritäres Zeichen mit dem Kinn, und Monsieur Guillot wäre vermutlich vor mir auf die Knie gegangen und hätte um meinen Schwanz gebettelt. Ich stellte mich breitbeinig ans offene Fenster. Er sollte mich gut sehen können. Mein Penis ragte zuckend in den Himmel, ohne dass ich ihn berührte. Sonnenstrahlen fielen auf meine Eichel, die sich aus der Vorhaut geschält hatte. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und rubbelte mir mit dem Handtuch die Haare trocken. Die Augen fast geschlossen, spähte ich zwischen meinen Wimpern hindurch unauffällig ins gegenüberliegende Fenster. Monsieur Guillot wichste wild. Ich sah, wie sich sein behaarter Brustkorb hob und senkte. Er schien schwer zu atmen. Schweißperlen traten auf seine Stirn. Hin und wieder schnitt er eine Grimasse, wie ich sie nur von Menschen kannte, die unter Schmerzen litten. Schließlich sackte er ein wenig in die Knie und schoss eine ordentliche Ladung Sperma aus seinem fleischigen Rohr gegen die Fensterscheibe. Sein Saft rann in milchigen Fäden am Glas hinab. Monsieur Guillot blickte hektisch – fast schon ängstlich – im Zimmer umher. Röte war ihm in die Wangen gestiegen. Schnell griff er nach einem Handtuch und rieb die Fensterscheibe sauber, und mit einem Ruck zog er die Vorhänge zu und verschwand aus meinem Sichtfeld. Ende der Vorstellung.
Die Jungs gegenüber stiegen tatsächlich an der UQAM aus. Ich tat es ihnen gleich. Offenbar hatte ich sie zu lange angestarrt, denn der Wuschelkopf warf mir einen fragenden Blick zu. Eine Sekunde lang verloren sich seine tiefbraunen Augen in meinen. Er war ein hübsches Professorensöhnchen, das musste ich zugeben – verdammt hübsch sogar. Ich ging Richtung Ausgang. Ein paarmal drehte ich mich um und ertappte ihn dabei, dass er sich auch den Kopf nach mir verdrehte. Wir blickten uns noch einmal in die Augen, und dann verschwand er aus meinem Sichtfeld.
Für einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich umsteigen sollte, um bis Beaudry zu fahren (das Cocks war direkt neben dem U-Bahnhof), beschloss dann aber doch, die kurze Strecke über die Rue Sainte-Catherine zu Fuß zu gehen. Die zentrale Straße des Village gai hatte sich bereits für den Sommer herausgeputzt. Wie überall auf der Welt wurden bei den ersten Sonnenstrahlen Tische und Stühle nach draußen geräumt, damit sich die Gäste von Cafés und Bars bei einem Cappuccino oder Bier die Sonne auf die Nase scheinen lassen konnten. Nirgendwo war der Unterschied zwischen Winter und Sommer so deutlich spürbar wie in der Rue Sainte-Catherine: Sechs Monate lang türmten sich hier Schneeberge am Straßenrand, aber in der warmen Jahreszeit verwandelte sie sich in eine sonnendurchflutete Fußgängerzone, die mich mit ihren markanten rosaroten Girlanden, die sich quer über die Straße zogen, an ein Foto erinnerte, das ich einmal im People Magazine gesehen hatte: Feria in Sevilla.
Das Cocks war tagsüber geschlossen. Monsieur Charles hatte mir am Telefon erklärt, wo sich der Seiteneingang befand. Ich klopfte wie verabredet an die unscheinbare Stahltür. Eine Weile tat sich nichts. Dann hörte ich gedämpfte Schritte. Mein Herzschlag beschleunigte sich – alles würde davon abhängen, ob ich Monsieur Charles von meinen Vorzügen überzeugen konnte. Ich war längst nicht so muskulös wie die meisten Tänzer, die im Cocks auftraten. Diesen kleinen Makel musste ich mit meinem Gesicht, meiner Persönlichkeit und vor allem mit meinem Schwanz wettmachen. Ich hoffte, Monsieur Charles würde mir Gelegenheit geben, ihm diese Qualitäten zu präsentieren. Die Tür öffnete sich knarrend. Im Rahmen erschien eine kleine, rundliche Gestalt mit schütterem Haar. Der Typ erinnerte mich an Danny DeVito. Eine Zigarette glimmte zwischen seinen dünnen Lippen. Er trug ein weißes Hemd, das über dem Nabel spannte und dadurch aus dem Bund der schwarzen Stoffhose gerutscht war. Seine Augen wirkten aufgeweckt – sie huschten über mein Gesicht und meinen Körper und tasteten mich ab wie ein Scanner.
»Guten Tag, ich … ich bin«, stammelte ich, »Callum Dubois. Wir haben …«
»Ich weiß«, unterbrach mich Monsieur Charles mit regungslosem Gesicht, »ich bin nicht dement. Ich kann mich erinnern, mit wem ich verabredet bin!« Mit einer leicht herrischen Kopfbewegung bedeutete er mir einzutreten. Ich folgte ihm und seinen Rauchschwaden durch einen kurzen, dunklen Korridor, an dessen Ende eine Schwingtür in ein Büro führte. Monsieur Charles machte es sich in einem wuchtigen Schreibtischsessel aus schwarzem Leder bequem. Seine kurzen Beine legte er über Kreuz auf die Schreibtischplatte vor ihm.
Da er mir keinen Platz anbot, beschloss ich, stehen zu bleiben.
»Nun«, Monsieur Charles zog kräftig an seiner Zigarette, »du glaubst also, dass du genug Talent hast, um bei uns zu tanzen?«
»Ja, klar«, antwortete ich und versuchte, dabei selbstbewusst zu klingen. Monsieur Charles musterte mich. Seine Augen huschten prüfend über meinen Körper. Irgendwie wirkte sein Blick kritisch – als wäre er nicht wirklich davon überzeugt, dass ich der richtige Kandidat für das Cocks sei.
»Weißt du, Callum«, brummte er, während er in einem großen Schwall Rauch ausblies, »du hast ein hübsches Gesicht. Wirklich hübsch. Meine Kunden wollen aber nicht nur hübsche Gesichter, sie wollen trainierte Körper sehen, und vor allen Dingen große, dicke, fleischige Schwänze!« Monsieur Charles grinste mir ins Gesicht. Ein Grinsen, das man getrost als schmierig bezeichnen konnte. »Je dicker, desto besser«, fügte er hinzu, wobei er sich in den Schritt griff.
Seine Augen fixierten mich unablässig. Es war ein eindringlicher Blick, an dem ich ablesen konnte, dass er gespannt war, wie ich auf diese provokante Geste reagieren würde. Ich beschloss, ruhig und gelassen zu bleiben.
»Klar«, erwiderte ich forsch, »das war mir schon bewusst!«
»Gut«, meinte der Boss des Cocks, und seine Gesichtszüge entspannten sich. »Dann lass mal sehen!«
Ich muss wohl ziemlich verdutzt ausgesehen haben, denn Monsieur Charles wiederholte seine Aufforderung mit Nachdruck. An seiner Mimik konnte ich ablesen, dass er langsam ungeduldig wurde.
»Hol ihn raus, Callum! Ich will sehen, ob dein Schwanz ein Moneymaker ist!«
Obwohl ich mir eigentlich sicher war, recht gut gebaut zu sein, begann ich nun doch, an meiner Tauglichkeit zu zweifeln. Irgendwie schüchterte mich dieses Boss-Gehabe ganz schön ein. Am liebsten hätte ich mich auf dem Absatz umgedreht und wäre aus dem Büro gerannt. Aber wo sollte ich hingehen? Nach Laval konnte ich nicht zurück, und mit den Ersparnissen meiner Mutter konnte ich höchstens einen Monat in einem Hostel unterkommen. Ich brauchte dringend Geld – ich brauchte dringend einen Job.
Langsam begann ich, meine Jeans aufzuknöpfen. Ich hatte meine Lieblingshose ausgewählt: stonewashed, mit Schlitzen über den Knien. Meine Beule kam darin gut zur Geltung. Als ich die Knöpfe geöffnet hatte, erschien mein weißer Calvin-Klein-Slip. Eine feine Linie blonder Härchen verlief vom breiten Gummibund zu meinem Nabel. Ich schob die Jeans bis zu den Knien hinunter. Mein Schwanz lag quer im Slip und drängte gegen den Stoff. Monsieur Charles fixierte mein Paket.
»Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus!«, meinte er zufrieden. Sein Gesicht bekam fast freundliche Züge. Beherzt streifte ich meinen Slip runter, sodass mein Schwanz frei zwischen meinen Beinen baumelte.
Monsieur Charles pfiff anerkennend.
»Das ist ein hübsches Teil. Alle Achtung, Callum! Damit wirst du bei uns ein Vermögen machen, wenn du dich nicht allzu ungeschickt anstellst.«
Ich war erleichtert. Das klang, als ob ich meinem Ziel, bald auf der Bühne des Cocks zu stehen, ein gutes Stück näher gekommen war.
»Jeder Auftritt bei uns besteht aus zwei Teilen«, erläuterte Monsieur Charles. »Im ersten Teil tanzen die Models zu einem aktuellen Song und ziehen sich das Oberteil aus und knöpfen ihre Hose auf. Dieser Teil ist wichtig, denn das Publikum soll scharf darauf werden, deinen Schwanz zu sehen. Du musst sie anfüttern. Sie sollen es gar nicht mehr aushalten bis zu deinem zweiten Auftritt – dem Slow Dance!«
»Und beim Slow Dance ziehe ich mich dann ganz aus?«, fragte ich.
»Du ziehst dich nicht aus. Du kommst nackt auf die Bühne …«, säuselte Monsieur Charles, »… und zwar mit einem Steifen! In der Zeit zwischen deinem ersten Auftritt und dem Slow Dance wichst du dir im Backstage-Bereich den Schwanz hart. Dann erscheinst du mit einem prallen Rohr im Scheinwerferlicht, und du wirst sehen, wie den Typen im Saal die Kinnlade runterklappt und die Latte in der Hose wächst. Wenn du es clever machst und nicht immer nur mit einem Halbschlaffi auftauchst, dann rennen sie dir anschließend die Bude ein und stehen für einen Private Dance Schlange! Meine besten Hengste machen am Abend lässig 600 Dollar!«
Wow. Ich hatte schon mit einem guten Verdienst gerechnet, aber niemals mit mehreren Hundertern pro Abend.
»Das ist ja, also …«, stammelte ich, »das ist eine ordentliche Stange Geld!«
»Ja«, grinste Monsieur Charles, »das kann man wohl sagen. Du kannst im Cocks eine ordentliche Stange Geld verdienen, wenn du selber eine ordentliche Stange zu bieten hast!«
»Und Sie glauben, dass mein Schwanz gut genug ist?«, fragte ich.
»Das kann ich dir erst beantworten, wenn ich ihn steif gesehen habe«, meinte Monsieur Charles in einem Ton, der an Überheblichkeit nichts zu wünschen übrig ließ.
Ich wusste nicht genau, wie ich diese Aussage interpretieren sollte. Erwartete mein Gegenüber etwa, dass ich mir einen hochwichste? Jetzt sofort? Ich schaute in sein Gesicht und versuchte, in seiner Mimik eine Antwort auf meine Frage zu finden. Monsieur Charles’ Augen stierten unablässig auf meinen Schwengel. Er hatte sogar vergessen, an seiner Zigarette zu ziehen, die fast komplett zu Asche geworden war und jeden Augenblick zu zerfallen drohte.
»Und«, sagte er schließlich, wobei er mir einen fragenden Blick zuwarf, »worauf wartest du?«
»Sie meinen, ich soll mir …«, begann ich, ohne den Satz überhaupt zu beenden.
Monsieur Charles nickte. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Erwartungsvoll blickte er abwechselnd in meine Augen und auf meinen Schwanz. Er bemerkte nicht, wie die Asche der mittlerweile erloschenen Zigarette auf seine Hose fiel.
Ich hatte keine Wahl. Ich musste ihm meinen Steifen präsentieren, um den Job zu bekommen. Also griff ich nach meinem Schwanz und schloss die Augen, denn der Anblick des dicklichen Bosses war nicht gerade förderlich, um eine Erektion zu bekommen. Langsam begann ich, meinen Schwengel zu kneten, und stimulierte dabei mit meinem Daumen durch die Vorhaut hindurch meine Eichel, die normalerweise so empfindsam war, dass schon eine kurze Berührung ausreichte, um Unmengen an Blut in meine Schwellkörper schießen zu lassen. Doch diesmal war alles anders. Sosehr ich mein bestes Stück auch massierte, an ihm rieb und daran zog, es tat sich nichts.
Schließlich öffnete ich die Augen. Ein merkwürdiges Grinsen lag auf Monsieur Charles’ Gesicht. Er schien meine verzweifelten Bemühungen, einen Steifen zu bekommen, sichtlich zu genießen. Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen, um nicht in diese feiste Visage schauen zu müssen. An der gegenüberliegenden Wand hingen zahlreiche Fotos nackter Jungs – vermutlich aus Bewerbungsschreiben – und Plakate, auf denen für Veranstaltungen geworben wurde, die längst in der Vergangenheit lagen.
Auf einem dieser Poster erkannte ich Yannick – nur mit einem Slip bekleidet, den er bis zur Schwanzwurzel hinuntergeschoben hatte. Die gestutzten Schamhaare waren vollständig sichtbar. Der blütenweiße Stoff des Slips verdeckte eine stattliche Erektion. Sein perfekter Oberkörper glänzte im Scheinwerferlicht – haarlos, pickellos, makellos! Yannicks stechende Augen schauten in die Linse, als wollten sie den bewundernden Betrachter direkt im Unterleib treffen. Dieser Blick verfehlte zumindest bei mir die gewünschte Wirkung nicht. Ich spürte einen Kitzel in meiner Eichel. Blut schoss in mein Rohr. Ich war erleichtert. Die Stressschwelle war überschritten – die Panik, keinen hochzubekommen, war der Geilheit gewichen.
Mein Rohr richtete sich zur vollen Pracht auf. Die Eichel schälte sich aus der Vorhaut, und Monsieur Charles schien zufrieden.
»Nicht schlecht, Callum«, keuchte er, während er sich mit seiner haarigen, dicken Pranke den Schritt rieb, »komm mal etwas näher. Ich will testen, ob er auch richtig hart ist!«
Ich fragte mich, wie Monsieur Charles an der Festigkeit meines Ständers zweifeln konnte, angesichts der kräftigen Adern, die sich wie Drahtseile um den prallen Schaft wanden. Ich beschloss, ein artiger Junge zu sein, und brachte mich vor meinem voraussichtlich neuen Boss in Position. Seine Hand schnellte nach meinem Riemen wie die Zunge eines Froschs nach der Beute.
»Der ist wirklich schön hart, mein Junge«, stöhnte er, »damit kannst du ein Vermögen machen!«
Seine Augen starrten auf meinen Bolzen, den er mit seinen erstaunlich weichen Handflächen fest umschlungen hatte.
Monsieur Charles wollte meinen Steifen offenbar gar nicht mehr loslassen und begann, ihn langsam zu wichsen. Ich spürte, wie der Kitzel in meiner Eichel stärker wurde.
»Da werden meine Kunden richtig scharf, wenn du ihnen dieses steinharte Teil präsentierst. Da fliegen die 20-Dollar-Scheinchen nur so aus den Taschen. So schnell kannst du gar nicht gucken!« Monsieur Charles lachte, wobei er sich vor nervöser Erregung verschluckte und husten musste.
Er erhöhte das Wichstempo. Wenn er so weitermachte, würde es nicht mehr allzu lange dauern, und er hätte meine Sahne in seinem feisten Gesicht.
»Oh, Callum«, säuselte er, »dein Bolzen zuckt aber schon ordentlich. Ich glaube, du bist bereit für den großen Auftritt!«
Ich wusste nicht, worauf Monsieur Charles hinauswollte. Das muss er mir angesehen haben, denn er fügte etwas genervt hinzu: »Ich will dich jetzt auf der Bühne sehen. Ich will sehen, wie du dich da oben machst. Ich will deinen Riemen im Scheinwerferlicht sehen, bevor ich dir einen Vertrag gebe!«
Also war ich noch nicht am Ziel – allerdings kurz davor, sofern mein Ständer steif blieb.
»Komm mit«, hastig erhob er sich, eilte zur Tür und winkte mir zu, »komm, Callum, ich zeige dir den Weg zu den Brettern, die die Welt bedeuten – vorausgesetzt, dein Brett macht nicht schlapp auf dem Weg dahin!«