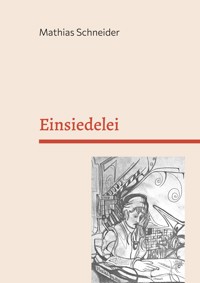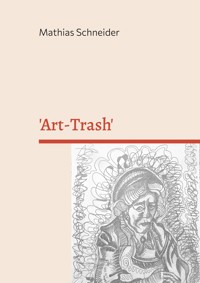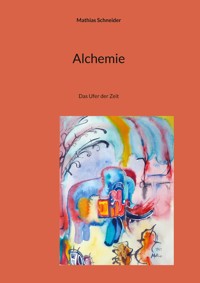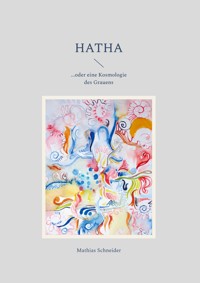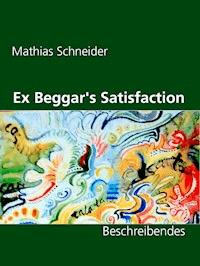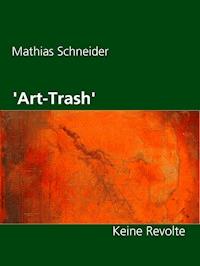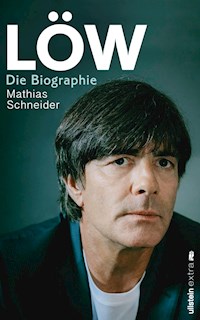
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
STERN-Reporter Mathias Schneider berichtet seit 2001 über die Nationalmannschaft. Er verfolgte Löws Weg beim DFB seit dessen erstem Spiel als Assistenztrainer 2004 in Österreich bis zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Russland aus nächster Nähe. Immer wieder traf sich Schneider in den vergangenen Jahren zu Interviews mit dem Bundestrainer. Nun hat er sich aufgemacht zu den Knotenpunkten in Löws Leben. Schneider zeichnet das spannende Psychogramm eines Weltmeister-Trainers, der sich in vielerlei Hinsicht treu geblieben ist. In seiner präzisen Rekonstruktion der WM 2018 zeichnet Schneider nach, warum Löw am Ende aber auch an sich selbst scheitern musste. Eine deutsche Geschichte über Loyalität und Loslassen, Aufstieg und Scheitern und die Frage, wann es an der Zeit ist, sich neu zu erfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Seit dem Weltmeistertitel 2014 steht Joachim Löw nicht nur für einen der größten Erfolge der deutschen Fußballgeschichte, sondern auch für ein neues Fußball-Deutschland: stilvoll, bescheiden, offen. Reibungslos verlief sein Aufstieg allerdings nicht. Mächtige Widerstände galt es für Löw zu überwinden. Erst der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann war es, der Löws Leben 2004 eine atemberaubende Wende verlieh.
STERN-Reporter Mathias Schneider berichtet seit 2001 über die Nationalmannschaft. Er verfolgte Löws Weg beim DFB von dessen erstem Spiel als Assistenztrainer 2004 in Österreich bis zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Moskau aus nächster Nähe. Immer wieder traf sich Schneider in den vergangenen Jahren zu Interviews mit dem Bundestrainer.
Nun hat er sich aufgemacht zu den Knotenpunkten in Löws Leben, um den Aufstieg eines der populärsten Deutschen noch besser zu verstehen. Er reiste in Löws Heimat nach Schönau, traf Förderer in Schaffhausen, frühere Mitspieler bei Löws erster Trainerstation im schweizerischen Frauenfeld und Freunde in Freiburg. In Stuttgart empfand Schneider mit alten Wegbegleitern Löws dessen Weg zum Pokalsieg nach. Dazu kamen Begegnungen mit aktuellen wie ehemaligen Nationalspielern sowie engsten Vertrauten.Schneider zeichnet das spannende Psychogramm eines Mannes, der sich in vielerlei Hinsicht treu geblieben ist — und sich für den ganz großen Wurf doch erst neu erfinden musste.
Der Autor
Mathias Schneider berichtet seit zehn Jahren als Sportreporter für den STERN, zuletzt auch für die Wissenschaft. Er ist Autor zahlreicher Titelgeschichten. Schneider traf in der Vergangenheit für Interviews wie Recherchen unter anderem internationale Topstars wie Roger Federer, Usain Bolt oder Maria Scharapowa. Er lebt mit Freundin und Tochter in Hamburg.
Mathias Schneider
LÖW
Die Biographie
ullstein extra
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1849-3
Copyright © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung: ZERO Media, MünchenUmschlagmotiv: © Gene Glover
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Prolog
1 Ganz enge Ballführung – eine Schwarzwälder Kindheit
2 Bundestrainer 2004–06: Statthalter der Revolution
3 Das dünne Eis der großen Welt – als Spieler in die Bundesliga
4 Bundestrainer 2006–08: Kampf der Kulturen
5 Freischaffender Künstler in Freiburg – die Rückkehr des Spielers
6 Bundestrainer 2008: Der Fall Ballack
7 Ein unauffälliger Deutscher – Lehrjahre in der Schweiz
8 Bundestrainer 2009–10: Flitterwochen
9 Rock ’n’ Roll in Schwaben – als Trainer beim VfB Stuttgart
10 Bundestrainer 2010–12: Evolution und Overcoaching
11 Auf und Ab im Garten des Leuchtturms – Trainer in Istanbul
12 Bundestrainer 2014: Siebenzueins
13 Missglückte und glückliche Gastspiele – von Karlsruhe nach Wien
14 Bundestrainer 2014: Die Nacht von Rio
15 Refugium – ein Weltmeister in der Provinz
16 Bundestrainer 2016–18: Selbstüberzeugung
17 Öffentlichkeit – der Weltmeister in Medien und Politik
18 Bundestrainer 2018: Der Aufprall
Epilog
Danksagung
Bildteil
Bildnachweis
Leseprobe: »Ich mag, wenn's kracht.«
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Prolog
Er sagt, er wisse, dass es jetzt Druck gebe. Aber das ist ja nicht mehr die Frage – ob es Druck gibt. Oder ob ihn dieser Druck belastet. Druck, dieses Zauberwort des Fußballs, das immer die Erwartungen der anderen umschließt. Ihre Forderungen, nicht seine.
Joachim Löw hat aufgehört, die Klippen zu zählen, von denen er in den letzten zwölf Jahren als Bundestrainer beinahe gestürzt wäre. In so ziemlich jedem seiner großen Turniere gab es ja Momente, in denen er gefährlich nahe am Rand wandelte, selbst 2014 im Achtelfinale gegen diese widerspenstigen Algerier. Nun ist er tatsächlich doch noch gefallen. Der übliche Kreislauf des Sports. Nicht alles lässt sich planen, schon gar nicht diese wundersamen letzten zehn Prozent, die entscheiden, ob am Ende der Titel oder ein schmachvolles Aus steht, so sieht er das.
What goes up, must come down.
Der Aufschlag hätte kaum härter sein können. Watutinki, das ist schon jetzt zur Chiffre geworden für einen historischen Crash des deutschen Fußballs. Aus in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2018. Als befände sich knapp vierzig Kilometer vor den Toren Moskaus nicht ein von schmucklosen Hochhäusern umstelltes früheres Teamquartier, sondern die Absturzstelle einer einstmals ruhmreichen Elf.
Was drei Fußballspiele alles bewirken können.
Alles wackelt jetzt, jeder wankt. Bloß kein falsches Wort verlieren. Krisenmanager und Spin-Doktoren haben die Regie in den Führungsetagen des Deutschen Fußball-Bundes übernommen. Doch Löw spricht bei diesem Telefonat im September ohne jeden Argwohn. Kein Grübeln, nicht einmal leiser Trotz in seiner Stimme, wie dies früher oft bei ähnlichen, nun ja, Unannehmlichkeiten der Fall war.
Schmerzt ihn der rapide Statusverlust der letzten Monate nicht?
»Mein Status? Ist jetzt eben so«, antwortet Löw und zieht seine Worte in die Länge, wie er das immer tut, wenn er einerseits überzeugen will, andererseits eine Frage für ihn selbst keine mehr ist. »Ich setze mich auch mit negativen Dingen auseinander. Ich bin in dieser Hinsicht schon lange in meinem Gleichgewicht.« Beinahe klingt er wie ein Pädagoge seiner selbst, als er hinzufügt: »Natürlich will man das nicht erleben. Aber so ist das manchmal, dass es richtig wehtut. Trotzdem kann man etwas mitnehmen, daraus lernen.«
Ein paar Tage zuvor hat er der Nation live im großen Pressesaal der Münchner Allianz-Arena seine sogenannte WM-Analyse vorgetragen, optisch ganz der alte Löw, hauchdünner schwarzer Pullover, Slim Fit natürlich, V-Ausschnitt, dazu eine Anzughose. Viel zu spät, sagten seine Kritiker. Genau zum richtigen Zeitpunkt, sagt er selbst.
Erst wollte er mit seinen Spielern sprechen, mit seinen Vertrauten. Keine billigen Schuldzuweisungen über die Medien, kein Aufkündigen alter Loyalitäten im Auge der Krise. Keine Sündenböcke. Nicht sein Stil. Wie immer bei solchen Anlässen war er gut vorbereitet. Alles genau abgewogen. Sachlich und distanziert wie ein Gutachter, der die Absturzursache eines anderen zu rekonstruieren hat, trug er vor. Ein paar große Linien seiner zwölfjährigen Amtszeit zog er zunächst beiläufig in den Saal, die eine Hand leicht erhoben wie ein Dirigent, ein Löw’sches Merkmal, wenn er in den Vortragsmodus übergeht. Fast wirkte es, als spielte er mit der eigenen Vergangenheit Doppelpass. Der deutsche Fußball sollte ruhig daran erinnert werden, was er ihm zu verdanken hat, bevor er gleich sein Schuldeingeständnis ablegen würde. Die aufregende WM2010. Acht Jahre her, da wurde die Weltmeistermannschaft geboren. Seine Mannschaft.
Von der »goldenen Mitte« 2014 aus Angriff und Abwehr berichtete Löw. 2014, das Jahr des Weltmeistertitels. Nicht zu viel Risiko, nicht zu wenig. Nicht zu viel Absicherung in der Verteidigung, nicht zu wenig. Er hat es damals hinbekommen und auch danach bis zu diesem vermaledeiten 2018 die richtigen Maßnahmen ergriffen, da ist er sich sicher: »Das Spiel weiterentwickeln, das ist uns vier Jahre hervorragend gelungen, wir waren Vorbild für viele in der Welt, wir waren Benchmark, was unsere Spielweise betraf.«
Vorbild. Benchmark. Er scheut sich nicht, sich noch immer oben einzusortieren. Sein Selbstverständnis. Er ist noch immer stolz auf das Erreichte, die Nation sollte das ruhig wissen. Dann der zentrale Satz, der so viel über den Löw von heute aussagt: »Das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen.«
Damit bloß niemand denkt, er suche die Schuld bei einem anderen, schob er seinen Ausführungen noch ein Signalwort nach: »Das war fast schon arrogant, ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren.«
Arrogant.
Hat es je einen Fußballtrainer gegeben, der so vernichtend über seine Arbeit geurteilt hätte – und trotzdem weitermacht? Hat es je einen Trainer gegeben, der sich so desinteressiert an den Mechanismen der Branche gezeigt hätte?
Soll keiner glauben, er schone sich. Versuche gar zu relativieren. Lange vorbei, dass er in dieser Hinsicht empfindlich gewesen ist. Sollen sie schreiben, er habe sich aus Überheblichkeit verzockt. Was für eine Rolle spielt das noch, nach vierzehn Jahren als Trainer dieser Elf, zwölf davon als Bundestrainer, zwei als Assistent? Keine Charmeoffensiven mehr, zumindest nicht jetzt. Schon lange ist der »Bundestrainer« für ihn zu einem zweiten Vornamen geworden in einem Geschäft, das im Alltag oftmals eher in Monaten als in Jahren rechnet. Auf die nächsten Länderspiele kommt es an, er sieht das heute ohne jede falsche Sentimentalität. Lieber greift er zu hoch als zu niedrig, um einen Misserfolg einzuordnen, den am Ende vor allem er zu verantworten hat. Beiläufig, fast lakonisch streut er ein, Russland sei »ein Debakel« gewesen.
Debakel.
Kostbar sind die Momente für den Beobachter, in denen Löw die Tür zu seinem Wesen einen Spaltbreit öffnet. Bis zuletzt ist dies so geblieben. Unbekannte Facetten seiner Persönlichkeit kommen dann zum Vorschein. Schalk schimmert plötzlich durch die Fassade, eingehüllt in ein kehliges Lachen, das man nicht erwartet hätte. Der junge Jogi im fast sechzig Jahre alten Bundestrainer wird in solchen Momenten kurz sichtbar. Dann gibt ein kompromissloser Satz plötzlich einen kurzen Moment den Blick auf eine innere Härte frei, die er sonst unter seiner verbindlichen Unverbindlichkeit gut unter Verschluss zu halten versteht.
Sein Leben teilt sich in zwei Phasen. Sie mögen von ungleicher Länge sein, und doch scheinen die vergangenen zwölf Jahre als Bundestrainer so viel heller aus Löws Vita heraus, dass sie getrost Löws langen Jahren des Suchens gegenübergestellt werden können.
Wer ihn heute erlebt, ausgehärtet, auch sich selbst gegenüber, der könnte fast glauben, der Suchende aus früheren Zeiten müsste ein anderer gewesen sein. Tatsächlich wird man den frühen Löw mit dem Bundestrainer Löw gemeinsam auf eine bislang achtundfünfzig Jahre währende Reise schicken müssen, will man verstehen, wie aus dem selbstbewussten, doch oftmals zaudernden Sohn eines Ofensetzers ein Mann wurde, der erst tief in seiner Bundestrainerzeit wirklich seine Selbstgewissheit erlangen konnte.
Eine Selbstgewissheit, nach der er lange strebte.
Eine Selbstgewissheit, die im Sommer 2018 zur Falle wurde.
Wie konnte es nur so weit kommen?
1
Ganz enge Ballführung – eine Schwarzwälder Kindheit
Manchmal, meist kurz vor den Ferien, die Verheißung langer Tage schon so nahe, keine Schule, keine Verpflichtungen, nur sie und dieses Spiel, das sie so liebten, manchmal also kratzten sie ihr Geld zusammen und beschlossen, aus ihrer kleinen Welt eine große werden zu lassen. Und sei es nur in ihrer Fantasie. Also gab jeder von ihnen fünfzig Pfennig, das war schon was an Geld Anfang der Siebzigerjahre. Sie kauften einen Pokal, wie sie ihn kannten, von Weltmeisterschaften, von Europameisterschaften, von deutschen Meisterschaften. Um diesen Pokal sollte es gehen bei der inoffiziellen Stadtmeisterschaft von Schönau.
Sie teilten ihren Ort in zwei Hälften, hier die Schönauer, wohnhaft mitten im Ort, dort die Jungs aus Brand, einer einen Kilometer entfernten Siedlung. Sie kauften sich unterschiedliche Trikots, um die Mannschaften besser unterscheiden zu können, und unterschiedliche Stutzen, auch das ihren Vorbildern nachempfunden – die Spenden der Omas und Opas machten es möglich. Dann traten sie in den Ferien täglich gegeneinander an, mal in Brand auf einer Wiese mit zwei Toren, ohne Netz, mal in Schönau auf einer Wiese in der Stadt. Zwei Wochen lang ging das so, bis der Sieger feststand. »Und glauben Sie nicht, dass das alles friedlich war, nur weil wir im Verein alle zusammen beim TuS Schönau gespielt haben. Von wegen. Da gab es Krach, Ärger, wie bei den großen Jungs«, sagt Werner Hornig, fester Händedruck, Konstantin-Wecker-Figur, kahler Schädel. »Der Jogi«, wie sie hier sagen, als wäre der bestimmte Artikel ein Teil des Namens, der sei natürlich mittendrin gewesen damals, als sie acht, neun Jahre alt waren.
Hornig, wie Löw schon immer der Fraktion der, nun ja, Städter zugehörig, hat an einem Mittwochnachmittag im März des Jahres 2018 in sein Reisebüro im Zentrum Schönaus geladen. Um auf dem Weg zurück in die Vergangenheit nicht gestört zu werden, hat er das Schild noch schnell auf »geschlossen« gedreht. Neben ihm hat Dietmar Krumm, Bürstenschnitt, Hemd, offener Blick, Platz genommen, einer der Burschen aus Brand von damals. Es scheint, dass selbst fünfzig Jahre nach den Schlachten um den Schönauer Dorfpokal der Kleinen die Kräfteverhältnisse gewahrt bleiben müssen.
Krumm, wie Hornig hier geboren und aufgewachsen, arbeitet heute als Hauptamtsleiter im Rathaus. Dort kommt ihm neben seiner Tätigkeit im Dienste der Stadt ein ähnlich bedeutsames Amt zu: Dietmar Krumm ist der inoffizielle offizielle Joachim-Löw-Beauftragte der Stadt Schönau. Wer etwas vor Ort über den jungen Jogi erfahren will, wird früher oder später seinen Weg kreuzen.
Krumm und Hornig kennen den jungen Jogi nicht nur von den sommerlichen Titanen-Kämpfen auf den Plätzen des Ortes. Sie wuchsen mit ihm heran. Sie spielten mit ihm auf dem sandbeschichteten Hartplatz vor der Löw’schen Ofensetzerei, direkt neben einer Schreinerei, ausgerüstet mit mächtigen Scheiben, unglücklicherweise direkt hinter dem Tor platziert. Nicht nur einmal klirrte das Glas. Vor allem aber stritten Krumm wie Hornig vor fast fünfzig Jahren Seite an Seite mit dem Stürmer Löw in der D-Jugend des ortsansässigen TuS Schönau.
Wie darf man sich das Spiel des jungen Jogi vorstellen?
»Kommen Sie um den Tisch herum, und schauen Sie es sich an«, antwortet Krumm und reicht eine CD an Hornig, die sogleich ins Laufwerk eines Computers wandert. Kurz darauf taucht eine Turnhalle auf, wie sie so auch heute noch zu Tausenden in deutschen Kleinstädten zu finden ist: heller Schwingboden, bestehend aus diesem seltsamen, wie stumpfen Gummi-Mix. Man sieht junge Buben, kaum älter als zehn, elf Jahre, und unter ihnen einen Steppke, den sie schon mitspielen lassen, weil sie jeden brauchen, vor allem, wenn er so viel besser ist als der Rest.
Der junge Steppke führt den Ball eng am Fuß, eng an beiden Füßen, um genau zu sein. Der Oberkörper verharrt ruhig – ein leichter Rundrücken –, als balancierte er einen Tennisball zwischen den Schulterblättern. Menschen, die den Steppke von damals heute als achtundfünfzigjährigen Senior in einer Soccerhalle bei Freiburg erleben, einmal die Woche, werden sein Spiel mit ähnlichen Worten beschreiben.
Der Junge lamentiert nicht auf dem Video, still läuft er ohne Pause durch die Halle, als triebe ihn eine Batterie an. Dann ist da noch die Frisur des Buben, er trägt die Haare zu einem schier unvergleichlichen Pilzkopf drapiert. Kein Zweifel, wen man da vor sich hat: Joachim Löw, voll in Aktion.
Er hat ja nie etwas anderes gewollt, als zu kicken, zunächst ohne Schuhe lief er dem Leder vor dem Haus hinterher, aufgerieben die Kinderfüße. Zwei Kilometer lagen zwischen seinem Elternhaus und dem offiziellen Vereinssportplatz am Ortsende. Mit dem Ball am Fuß dribbelte der kleine Jogi täglich hinüber und zurück, später die legendären Copa Mundial von adidas an den Füßen. Er trägt das Modell bis heute, ganz klassisch.
Immer wieder spielte Löw Doppelpass mit den an den Gehsteig angrenzenden Hauswänden. Wenn er selbst davon erzählt, wird sein Badisch etwas breiter, sein Ton weicher, wie man vor ein paar Jahren in einem Konferenzraum des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt hören konnte: »Schon als ich ganz klein war, habe ich unbedingt mit dem Ball spielen wollen, stundenlang. Ich kam aus der Schule, der Ranzen flog ins Eck, essen, ganz schnell Hausaufgaben machen, dann raus – kicken. Der Ball hatte schon immer eine besondere Anziehungskraft auf mich. Wenn ich an den Ball denke, denke ich an Tore. Für mich war es immer ein unglaubliches Glücksgefühl, ein Tor zu schießen.« Er hat diesen Sport geliebt, wie es wohl nur Kinder tun können, die sich nicht wie heute täglich zwischen Tausenden Optionen auf Konsolen, Tablets und iPhones entscheiden müssen. Und Schönau, dieses 2500-Einwohner-Städtchen, das war sein Refugium.
Ein Refugium, das sich zumindest äußerlich kaum geändert hat. Das holzgetäfelte Ortsschild »Luftkurort Schönau – Schöne Au – komm und schau« begrüßt noch heute den Besucher. Nicht ohne Stolz prangt darunter der Zusatz: »Solarhauptstadt in Deutschland«. Wer das Dörfchen durchstreift, findet ein durchaus imposantes historisches Rathaus, in dem sich noch immer die Stadtverwaltung befindet. Der neunzig Meter hohe Glockenturm der römisch-katholischen Pfarrkirche ragt wie eine mächtige Lanzenspitze in den Himmel. Ein Freibad, ein Golfplatz, natürlich der sich im Tal am Ortsausgang an eine Böschung schmiegende Kunstrasenfußballplatz, dazu ein paar Gaststätten – doch all dies nährt nicht dauerhaft die Erinnerung. Es ist die zeitlose Ruhe, die sich eingräbt. Als schluckten die bewaldeten Hügel, an denen das Örtchen rund um den Dorfkern hinaufwächst, bis heute jeden Lärm einer fernen Zivilisation.
Kaum Arbeitslosigkeit, keine Drogen, viel Zufriedenheit, das muss der Humus für Löws Kindheit gewesen sein. Sie rücken hier, wo Winter noch wirkliche Winter sind, voller Eis und Schnee, zusammen. Man schwätzt miteinander, selbst dann, wenn man sich nicht ausstehen kann. Ein Viertele geht immer. Sie mögen beengt leben, doch engstirnig sind sie nicht, das Elsass mit seinem Weinanbau so nah. Sie arbeiten hier und wissen doch zu leben. Fleißig, akribisch, wie ein Bundestrainer namens Löw viel später immer wieder in seiner Arbeit betonen wird, das sind die Alemannen. Und stolz, auch das. Sie wissen, dass sie einen guten Deal mit dem Schicksal geschlossen haben, auch das macht sie in den Tiefen des Schwarzwaldes so gelassen.
So ist es immer gewesen, schon 1970. Seine erste WM erlebte der zehnjährige Jogi damals. Mexiko. Der späte Pelé! Der Hinterkopf von Uwe Seeler. Ausgerechnet Schnellinger! Nicht im elterlichen Wohnzimmer bestaunte der kleine Jogi seine Helden, dort stand damals noch kein Fernseher, sondern bei Verwandten der Mutter. Er stammt ja aus einer anderen Zeit, man sollte sich das gelegentlich vor Augen führen, wenn er heute in seinen taillierten Hemden über die Hightech-Welt des modernen Fußballs referiert, als wäre er schon als Projekttrainer auf die Welt gekommen.
Deutschland gegen England, Deutschland gegen Italien, das schauten sie damals alle gemeinsam, die Kinder vorn auf dem Boden, die Erwachsenen dahinter. Aus dem Joachim war da schon längst der Jogi geworden, nicht nur die drei jüngeren Brüder Markus, Christoph und Peter riefen ihn so, sondern das ganze Dorf, später ganz Freiburg und heute die ganze Nation. Nur für die Mutter Hildegard ist er immer »der Joachim« geblieben.
Der Vater Hans genoss das, was man in den Sechzigerjahren in einem Örtchen wie Schönau noch Ansehen nannte. Nicht irgendein Ofensetzer war er, vielmehr entstammte er einer Kachelofendynastie, das Unternehmen aus Oos, seit 1928 Stadtteil von Baden-Baden, war damals schon mehr als hundert Jahre alt. Öfen bauen, das lag Hans Löw in den Genen. Schnell gehörte er auch in Schönau mit seiner Frau Hildegard, geborene Lais, zu den so wohlhabenden wie respektierten Bewohnern des Ortes. Der Betrieb wuchs rasch, zwölf Angestellte führte er, denn Löw Senior verstand sich nicht nur auf sein Handwerk, er konnte auch hart arbeiten.
In den Krieg hatte er ziehen müssen und zählte nun zu jenen, die dem Land einen ungeahnten Aufstieg bescheren würden. Sich selbst gönnte er in all den Jahren nicht viel, eine Zigarre am Sonntag, ein ordentliches Essen und ein Viertele, mehr aber auch nicht. Das Geld wurde zusammengehalten, wie es sich gehörte, und den Betrieb für Wochen zu schließen, gar für ausgedehnte Urlaubsreisen ins Ausland, das gab es nicht.
Löw war ein guter Arbeitgeber, einer der besten des Ortes. So sollte es lange bleiben, bis sich jene, die er einst ausbildete, von ihm lösten. Sie eröffneten eigene Betriebe und machten ihm im eigenen Ort Konkurrenz. Denn sie bauten nicht nur Kachelöfen in die Häuser, sie fliesten auch gleich noch Bäder, ein Preiskampf entstand. Doch Hans Löw klagte nicht. Er kämpfte. Er schaffte weiter und sorgte still für seine Familie, wie es sich für einen Mann mit Frau und vier Kindern gehörte. Außerdem engagierte er sich im Vorstand des Vereins seiner vier Söhne, doch in den Vordergrund drängte es ihn nie. »Der Hans wollte nicht im Mittelpunkt stehen, mal saß er im Café Huber, hat dort sein Viertele getrunken, mal ein bisschen Karten gespielt. Vor allem wollte er seine Ruhe haben«, erinnert sich Schönaus Löw-Beauftragter Krumm.
Sein Ältester, der Jogi, mochte schon damals eine kleine lokale Größe gewesen sein, doch das riss den Senior nicht zu Begeisterungsstürmen hin. Er definierte sich nicht über den Erfolg seiner Burschen, was durchaus bemerkenswert war, denn neben Joachim sollte später auch der Zweitälteste, Markus – von allen nur Maggie genannt –, es bis in den Profikader des SC Freiburg schaffen. Doch Hans Löw ließ den Dingen ihren Lauf, er reiste nicht zu Auswärtsspielen seiner Jungs, und das in einer Zeit, in der das Phänomen der ehrgeizigen Väter, die ihren Nachwuchs zur Karriere zu treiben versuchen, gar nicht so selten vorkam. Nicht Hans Löw. Nur am Sonntag machte er sich mit seinen Söhnen zum Kicken auf. Doch wo genau das Talent im Hause Löw nun herstammt, ob vom Vater oder von der Mutter, darüber rätseln sie bis heute in Schönau. Jogi Löw selbst ist dem Geheimnis nie auf die Spur gekommen. »Meine Eltern waren beide keine Ballsportler.«
Wer die Löw-Buben nicht kannte, konnte nicht vermuten, dass sie dieselben Eltern hatten, zu unterschiedlich waren Aussehen und Naturell. Sicher, alle vier spielten Fußball, allen vieren war ungezügelter Jähzorn auf dem Platz fremd, doch sie glichen sich nicht. Eher teilten die Löws sich in zwei Paare auf. Jogi und Christoph, der Drittälteste, bilden bis heute am ehesten eine optische Einheit, noch heute bezeichnet Jogi ihn als den Talentiertesten aller Brüder. Den Ehrgeiz des großen Bruders besaß Christoph Löw allerdings nicht. Der Familie der Mutter kommen Joachim wie Christoph Löw nach, schon des Haarschopfes wegen. Zwar verfügte Mutter Löw über eine blonde Haarpracht, doch beim Rest ihrer Verwandtschaft sind auf dem Haupte eher dunkle Töne angesagt. Den eigenen Cousins sieht Joachim Löw deshalb ähnlicher als zweien seiner Brüder, auch was die schlanke Statur angeht.
Dagegen dürften die Brüder Markus und Peter, den jeder rund um Schönau nur Pit nennt, eher vom Gemüt des Vaters geprägt sein. Am wohlsten fühlen sie sich bis heute in ihrer abgesteckten Wohlfühlzone, Markus in Basel, Pit in der Vereinsgaststätte Schönau, die er seit Jahren betreibt. Bis heute empfinden sie das öffentliche Interesse auch an ihrer Person eher als Last denn als Lust. Sich über den Bundestrainer-Bruder zu profilieren, gar zu definieren, ist beiden völlig fremd. Ihr eigenes Leben wollen sie führen, unbehelligt. Wo den Bundestrainer heute Heerscharen von Bewunderern und Schulterklopfern umschwärmen, vor allem, wenn eine Kamera in der Nähe ist, halten sich beide lieber im Hintergrund.
Besucht man den Jüngsten Pit in seiner Vereinskneipe, an deren Rückseite seit 2014 das Schild »Jogi-Löw-Stadion« prangt, trifft man auf einen zugewandten stämmigen Mann mit kurz geschorenen Haaren, der nicht mehr im Sinn hat, als seinen Job ordentlich zu erledigen. Während des WM-Finales 2014 hat er einfach weiter bedient, Geschäft ist Geschäft. Ein flüchtiger Blick zum Fernseher, ein kurzer Ruck, der seinen Körper durchfährt, wenn ein Gegenspieler der Deutschen doch übers Tor schießt, mehr Gefühlsregungen gestattet er sich nicht, wenn der Bruder in großen Spielen an der Seitenlinie steht.
Zur Pilgerstätte für Löw-Touristen soll sein zweites Wohnzimmer eher nicht werden. Deshalb hat er es den Kamerateams, die zu Weltmeisterschaften so sicher im Gastraum eintreffen wie die nächste Bierbestellung, erst einmal verboten, in seinem Reich zu filmen. Die Jugendmannschaften gehen dagegen ein und aus. Ihre Spieler lagern ihre Schlüssel hinter dem Tresen, ein beiläufiger Plausch hier, eine kurze Umarmung da und immer mittendrin der Pit, lautlos, freundlich, einem Herbergsvater gleich. Auf zwei Fernsehern läuft Sky, ein abgetrennter Nebenraum dient als Rückzugsort für Mannschaften und Cliquen. Man könnte glauben, das Deutschland der Achtzigerjahre habe sich hierhin zurückgezogen. Fußballvereine glichen damals noch Stätten der Begegnung, ihre Mitglieder verabschiedeten sich nach dem Training nicht sogleich in virtuelle Welten.
Ein kleines Bild des großen Bruders findet sich dann doch an der Wand. Es zeigt den Bundestrainer von hinten. Dafür ist das Gesicht der Kanzlerin zu sehen. Sie steht vor ihm und lächelt ihn an wie eine Verliebte. Es ist nicht ganz klar, ob das Bild aus Stolz über so viel Nähe des Bruders zur ersten Frau im Staate da hängt oder nicht doch eher als subtile, lieb gemeinte Ironie zu verstehen ist: Da schau einer an, da hat unser Jogi aber eine Verehrerin von Rang.
Bis vor ein paar Jahren hat auch die Mutter Hildegard noch kräftig mitgeholfen in der Küche, Bundestrainer hin oder her, die Arbeit musste gemacht werden, und all die Schnitzel klopften sich ja nicht von selbst. Als wollte sie einen stummen Beweis erbringen, dass kein Bundestrainer der Welt, kein Millionengehalt ihrer Bodenständigkeit und ihrer bürgerlichen Ehre etwas anhaben konnte.
Noch heute, mit fünfundachtzig, lebt die Mutter allein in einer Wohnung im Ortskern, ihr Mann Hans verstarb im Frühjahr 1997 an einem Schlaganfall. Doch in die Knie zwang Hildegard Löw selbst dieses Schicksal nicht, genauso wenig wie zwei schwere Knieoperationen zuletzt. Nicht jammern. Stattdessen das Beste aus den Möglichkeiten machen, bis heute schmeißt sie ihren Haushalt allein.
Eine selbstbestimmte Frau, das ist Frau Löw immer gewesen, nicht nur weil sie neben der Erziehung der Söhne auch noch im Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern mit anpackte. Bis heute lässt sie ihre Jungs schon mal wissen, wenn ihr etwas missfällt, und sei es nur die Frisur oder der zu lang gewachsene Bart. Das Verhältnis bleibt herzlich und innig. Sie hat ihre Buben immer zusammengehalten, bis die es selbst untereinander taten.
Allzu viel Anlass zur Kritik bot sich der Mutter dann auch nicht, zumindest nicht beim Ältesten Joachim. Brav kam er seinen Pflichten als Ministrant nach, mit dem Großvater fuhr er am Wochenende nach Freiburg, um fünf Uhr in der Früh war Aufbruch, ein großes Abenteuer war all das für den kleinen Jogi. »Es war dunkel, kalt, wir sind mit einem alten VW-Bus über den Pass gefahren, der Notschrei heißt«, erzählt Löw Jahre später. »Besonders auf die Bratwurst, die es auf dem Markt dann gab, habe ich mich gefreut.«
Es hat nicht »gerauscht«, wie sie hier sagen, wenn daheim die Kinder nichts zu lachen haben, weil die Hand des Vaters züchtigt. Verständnisvoll gingen die Eltern mit ihrem Ältesten um, ohne ihn zu verhätscheln, verständnisvoll wird dieser später mit seinen Spielern umgehen. Disziplin und Respekt, die er heute von seinen Profis fordert, hat er früh gelernt. Immer war klar im Hause Löw, wer das Sagen hat. Im Gegenzug durften die Söhne ihre Kindheit genießen, wenn daheim nichts mehr zu erledigen war. Es sollte nicht allzu lange dauern, bis eine Leidenschaft die Löw’schen Jungs fesselte: die Zockerei. »Wenn du verlierst, dann bekomme ich dein Zimmer. Solche Sachen wurden da verhandelt«, erzählt Dietmar Krumm. Auch um die Fußballschuhe eines Bruders ging es schon mal.
Doch all dies verblasste, wenn es um die wahre Leidenschaft der Buben ging – das Kicken. Und der Jogi war schließlich nicht irgendein Talent. Mit seinen zehn Jahren spielte er als Jüngster in einer der besten D-Jugendmannschaften Südbadens der frühen Siebzigerjahre. Die Bezirksmeisterschaft holten sie gemeinsam, 1970, es war der erste Titel überhaupt für den kleinen TuS Schönau. Sechzehn Tore schoss der junge Jogi in einem Spiel, 116:1 lautete das Torverhältnis des TuS in der ersten D-Jugend-Saison.
Aus den Jahrgängen von 1957 bis 1960 bestand diese Wunder-D-Jugend, und der Jogi war wahrlich nicht ihr einziges Talent. Neben ihm und seinem Bruder Markus (SC Freiburg) würde auch Hans-Peter Schulzke (Eintracht Braunschweig) den Sprung zu den Profis packen, später sollte noch Wolfgang Becker (Karlsruher SC) folgen. Eine atemberaubende Quote, die heute manchen Bundesligisten vor Neid erblassen ließe.
Angeleitet wurden die jungen Talente von einem Mann, der selbst noch keine dreißig war. Man kann ihn ohne Übertreibung als einen der Pioniere der Nachwuchsarbeit in jenen Jahren bezeichnen. Der ehemalige Mitspieler Krumm nennt den Mann »Vaterersatz, Trainer und so etwas wie der erste Manager in einer Person für Jogi«. Ohne diesen Mann kein Spitzenspieler Löw. Ohne diesen Mann kein Trainer Löw. Ohne diesen Mann kein Weltmeister Löw.
Vermutlich wäre alles anders gekommen ohne Wolfgang Keller.
Um Keller zu erreichen, geht man von Hornigs Reisebüro ein paar Hundert Meter quer durchs Städtchen, steigt eine steile Stiege hinauf, um schließlich im ersten Stock vor einer kleinen, aber gemütlichen Wohnung anzukommen. Kellers Frau Erika öffnet die Tür und bittet herein. In einem Regal über der Eckbank im Esszimmer steht ein kleiner Bilderrahmen, darin ein Foto, das junge Nachwuchskicker in gelben Glanztrainingsanzügen zeigt, die für heutige Betrachter an die Trainingsanzüge der Los Angeles Lakers erinnern, tatsächlich aber von irgendeinem Sponsor aus der Region sein sollen, so genau weiß das heute keiner mehr. Zweiter von rechts, mit einem schelmischen Grinsen und jenem langen Scheitel quer über den Kopf, der in einem gewaltigen Wirbel seinen Ursprung findet: der kleine Jogi.
Wolfgang Keller, 75, lässt sich noch einen Moment entschuldigen, ein Herzinfarkt hat ihn vor zwei Jahren heimgesucht und fesselt ihn länger ans Bett, als ihm lieb ist. Doch nach wenigen Minuten blicken zwei wache Augen über den Esstisch. Schnell wird klar, dass Keller nicht nur über vorzüglichen Fußballsachverstand verfügen muss, sondern auch über ein Gedächtnis mit unbegrenzter Speicherkapazität. Mühelos springt er in den Epochen zwischen dem frühen und späten Löw hin und her, als wäre das Ganze nicht fünfzig Jahre, sondern fünfzig Wochen her.
»Mit einem alten Opel Rekord bin ich damals mit meiner D-Jugend herumgefahren, da waren vierzehn Kinder drin, absolut unverantwortlich«, beginnt Keller zu erzählen, er will nichts beschönigen, nichts weglassen. Ehrlich und direkt, das war er früher zu seinen Jungs, so soll es bleiben, auch jetzt. Was er nicht sagt, was aber immer wieder durchschimmert in den folgenden Stunden, bei aller Ehrlichkeit, er muss seine Jungs geliebt haben wie seinen eigenen Sohn. Vor allem diesen Löw, so talentiert.
Als die Buben der D-Jugend entwuchsen, hat er sie selbstverständlich nicht übergeben, an wen denn auch? Er blieb ihr Trainer, in der C-, B-, und A-Jugend. Er wollte etwas erreichen, und diese Jungs, die waren sein Ticket, da war er sich sicher. Keller war kein hauptamtlicher Trainer, zusammen mit seiner Frau betrieb er ein Schuhgeschäft in Schönau, wobei zusammen in seinem Fall offenbar ein dehnbarer Begriff war. »Meine Frau hat das vor allem gemacht.« Er selbst war dem Fußball verfallen, ehrgeiziger Autodidakt, heute würde man sagen: ein sogenannter junger Wilder der Trainergilde zu einer Zeit, als es noch keine Nachwuchsleistungszentren gab, in denen sich später sogenannte Konzepttrainer wie die heutigen Bundesligatrainer Thomas Tuchel, Domenico Tedesco oder Julian Nagelsmann den letzten Schliff holen würden.
Wo hat er sein Handwerk gelernt?
»Das habe ich mir selbst mit Fachliteratur angeeignet«, antwortet Keller. Es folgt eine kurze Pause, er kramt in seinem Gehirn, als durchkämmte er eine Bibliothek. Schließlich, wie sollte es anders sein, kommt der Titel jenes Standardwerks zum Vorschein, dem er damals seine Methodik entnahm: Studerer / Wolf, Fußballtraining, erschienen in der Deutschen Demokratischen Republik. »Sehr verständlich war das, man konnte das eins zu eins in die Praxis übersetzen«, sagt Keller. Er hat dann Lehrgang auf Lehrgang besucht, »so kam ich an immer mehr Literatur«. Passen, gehen, Kurzpässe, schnelles Umschalten bei Ballgewinn – er hat seine Kleinen schon jene taktischen Prinzipien eigebimst, die heute noch zum Standardprogramm jedes Trainers gehören.
Jogi Löw mochte das Spiel von Kellers D-Jugend in der Offensive geprägt haben, ein Anführer war er nicht, schon allein deshalb, weil er einer der Jüngeren war. Der spätere Profi Hansi Schulzke, der im Mittelfeld spielte, sei eher ein Leader gewesen, sagt Dietmar Krumm heute. Keller drückt es, ganz der alte Trainer, noch ein bisschen direkter aus: »Der Jogi ist nicht aufgefallen, er wäre nie ein Kapitän gewesen, nicht bei mir in der Jugend. Das gab ja selbst bei den Kleinen schon so was wie Führungsansprüche, die Jungs haben ja schon in Auswahl-Mannschaften gespielt.«
Was war der Jogi für ein Talent, damals?
Wolfgang Keller macht eine kurze Pause, er muss einmal durchschnaufen. Dann beginnt er zu berichten. Von einem aufgeweckten Jungen. Der Junge lässt sich keinen Blödsinn vormachen. Er bewundert Günter Netzer, will sein wie der Mönchengladbacher, ein Techniker, ein bisschen exzentrisch, ohne wirklich anzuecken. Der Junge ist ein bisschen empfindlich, was seinen Körper anbelangt. Er hört schon damals viel in sich hinein, ein Charakterzug, der ihn nie verlassen wird, bis heute nicht. Der Junge macht so gut wie nie Ärger. Er kommt nicht zu spät zum Training, er hampelt nicht herum, wenn der Trainer etwas erklären will. Ein guter Gradmesser für die Arbeit eines Coaches. Wer es sich mit dem Jungen verscherzt, hat selbst ein Problem.
Bittet der Trainer den Jungen, nach dem Training noch Freistöße zu üben, übt der Junge Freistöße. Er übt dann so lange, bis der Trainer ihm sagt, dass es nun genug sei. Niemals wagt der Junge, vorher aufzuhören. Der Junge ist sehr gewissenhaft, verbissen ist er nicht. Er mag talentiert sein, doch den Traum, einmal Profi zu werden, den traut sich der Junge nicht zu träumen. Noch nicht. Er lebt vielmehr von seinem Talent. Waldläufe in der Freizeit? Braucht er nicht. Er gewinnt auch so jedes Spiel mit seinen Kameraden. Warum sich das Leben unnötig schwer machen? Eher ist er ein bisschen bequem, jedoch ohne faul zu sein. Aber wer mit einem Örtchen, mehr Dorf als Städtchen, die Konkurrenz in der C-Jugend aus den Latschen ballert, der kann auch so nicht auf dem Holzweg sein.
Manchmal, wenn der Junge doch einmal das rechte Maß verliert – nicht buchstäblich, das passiert eher selten –, wenn er aber doch mal gestört hat, selten genug, dann schickt ihn sein Trainer unwirsch vom Platz, denn der Trainer kann durchaus autoritär sein, auch laut. Am Zaun stehen dann Junge und Alte, sie wohnen wie der Junge in Schönau, sie flüstern wie die Sirenen: Komm zu uns, da wirst du nicht vom Trainer angebrüllt.
Um das Flüstern der Menschen am Zaun zu verstehen, muss man wissen, dass in den Jahren vor 1974 nur bedingt von einer Dorfgemeinschaft die Rede sein konnte. Denn das Dorf des Jungen ist geteilt, nicht in Ost und West, aber doch was die Fußballvereine anbelangte. Es ist also etwas Ernstes. Auf der einen Seite ist da der TuS, sportliche Heimat des Jungen, auf der anderen Seite der FC Schönau. Beide Vereine spielen auf dem gleichen Sportplatz, doch da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Erst 1974 werden sie fusionieren, noch ein Jahr wird der Junge dann in der B-Jugend für den neuen FC Schönau spielen, bevor er weiterziehen wird.
Wenn die beiden Stämme vor der Fusion 1974 gegeneinander antreten bei den Männern – der FC verfügt über keine allzu erfolgreiche Jugendarbeit – , versammelt sich fast die Hälfte der 2500 Einwohner um den Sportplatz. Schalke gegen Dortmund, nachgespielt als Kammerspiel im Hochschwarzwald. Die Rivalität ist also groß, so groß, dass mancher aus dem Stamm der FCler sich weigert, im ortsansässigen Schuhgeschäft einzukaufen. Einen TuSler unterstützt man nicht.
Der Junge bekommt von alldem nicht viel mit, doch eins weiß er: Nicht im Traum denkt er daran, seinen Coach zu verlassen. Keiner von ihnen verlässt diesen Trainer. Wer würde sonst zweimal pro Woche mit ihnen trainieren? Wer würde sie abholen und bringen, von der Schule, vom Elternhaus? Wer würde sie begleiten zu all den Lehrgängen? Mit ihnen in Trainingslager fahren, bis nach Frankreich?
Wolfgang Keller muss in jenen Jahren einem Streichholz geglichen haben, das an beiden Enden brennt. Keine Zeit für nix. Wie sonst ist zu verstehen, was man in alten Zeitungsartikeln unter der Überschrift »Talentsucher bei der Fußball-Jugend« findet. »Rund sechs Mannschaften« betreue Keller beim TuS Schönau gleichzeitig, steht dort geschrieben. Der in den Siebzigerjahren gerade in der Jugend gar nicht so große SC Freiburg wurde von dem Städtchen auf der anderen Seite des Notschreis ein ums andere Mal vorgeführt. Selbst der stolze Freiburger FC, unumschränkte Nummer eins in jenen Jahren im Breisgau, zog schon einmal mit einer Niederlage ab. Auf Hartplatz mussten die verwöhnten Freiburger spielen, sie waren das nicht gewohnt und auch nicht, dass da plötzlich schon einmal ein paar Hundert Zuschauer um den restlos gefüllten Dorfplatz standen.
Keller übernahm außerdem die Fördergruppenleitung im Bezirk Oberrhein, er war jetzt also nicht nur Trainer diverser Schönauer Jugendmannschaften, er war auch Bezirkstrainer. Die besten Jungs der Region versuchte er fit zu machen für eine Berufung in die südbadische Auswahl. Von dort war ein jeder von ihnen dann nur noch einen Sprung entfernt von den Jugend-Nationalmannschaften. Doch dabei wollte es der ehrgeizige Trainer nicht belassen. Keller begleitete die südbadische Auswahl schon mal zu den Turnieren nach Duisburg, in jener Zeit legendäre Stätte für große Turniere der Landesverbände um die deutsche Meisterschaft. Er fungierte als rechte Hand des Verbandsjugendwartes Dieter Meister.
1985, das Schönauer Talent Löw ist längst weitergezogen, werden die Siege seiner Jungs Keller selbst zum Objekt der Begierde werden lassen. Der Freiburger FC wird anfragen, ob Keller nicht ab sofort den Nachwuchs übernehmen könne. Doch Keller wird sich lieber an den kauzigen Oberfinanzdirektor Achim Stocker halten, mindestens so überzeugend wie er selbst, wenn es um seinen Verein geht. Und Stockers Verein ist der SC Freiburg. Am Notschrei, jenem Pass, ziemlich genau zwischen Freiburg und Schönau gelegen, quasi auf neutralem Terrain, wird ihn dieser Stocker in einem Restaurant in einem eineinhalbstündigen Gespräch überzeugen. Siebenundzwanzig Jahre wird Keller beim SC bleiben, die Nachwuchsabteilung zu einer der führenden des Landes aufbauen, Spieler scouten und irgendwann seine A-Jugend an einen gewissen Christian Streich übergeben. Jenem Streich, der heute zu den profiliertesten Trainern des Landes gehört.
Doch noch lag all dies für Keller in ferner Zukunft. Das Projekt Löw, sein Projekt, ging Mitte der Siebziger gerade erst in die entscheidende Phase. Sein Schützling war fünfzehn Jahre alt. Er brauchte Betreuung, also wachte dieser Keller über seinen Jogi wie über eine seltene Blume, die er unbedingt zur Blüte bringen wollte. Der Jogi quälte sich mittlerweile durch das Gymnasium in Schönau, vor allem die Naturwissenschaften machten ihm das Leben schwer. In die B-Jugend war Löw aufgestiegen, ein junger Dachs, arglos, noch immer verspielt. Doch niemand konnte ihn stoppen, sobald er den Ball am Fuß führte. Niemand.
Außer einem sanftpfötigen Gegner, den Keller nicht kommen sah. Der aber die Karriere seines Schützlings gefährlich ins Wanken bringen sollte.
Der erste Verdacht, dass etwas nicht stimmte, kam Keller in Günzburg. Er begleitete seinen Jogi zur südbadischen Auswahl, die dort um die Süddeutsche Meisterschaft spielte. Er tat dies, wie so oft, quasi privat, er wollte Löw nicht allein lassen. Denn ein noch größeres Ereignis warf Mitte der Siebzigerjahre bereits seine Schatten voraus: Kellers beste Schützlinge, Löw und Schulzke, waren zu einem DFB-Lehrgang eingeladen worden. In vierzehn Tagen würden sie zunächst in Duisburg zwei Trainingstage absolvieren, bevor sie zu einem Turnier von einer der Jugendnationalmannschaften des Verbandes in Monaco aufbrechen sollten, für volle zwei Wochen. Was für eine Auszeichnung, war Jogi doch auch hier jünger als alle anderen. Keller erinnert sich: »In Günzburg hieß es dann: Du musst mit Jogi in ein Zimmer, ich war ja quasi privat dabei und hatte keinen Anspruch auf ein Zimmer. Das war kein Problem. Aber Jogi ist immer unlustiger geworden, und der Tag der Abreise nach Monaco kam immer näher. Und die Jungs haben alle plötzlich in Rätseln gesprochen: Der Jogi geht nicht, der geht nicht.« Kurz darauf erhielt Keller die Diagnose der unheilbaren Krankheit, unter der Löw neuerdings litt: Er war verliebt. Die erste Liebe hatte in das noch unerfahrene Löw’sche Herz eingeschlagen wie ein Vollspannstoß in den Winkel; und wenn man Keller so zuhört, wie die Stimme sich hebt, offenbar nicht nur dort: »Ich sage Ihnen, das war ein Drama hoch drei. Die Abfahrt ein paar Tage später aus Freiburg rückte dann immer näher, und er hat mir versprochen: Wolfgang, ich fahre. Am Donnerstag vor der Abreise habe ich ihn noch mit meinem Sohn Hausaufgaben machen lassen, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe ihn dann zum Bahnhof in Freiburg gebracht, seine Freundin musste dabei sein, sonst wäre er nicht gefahren.«
Löw fuhr, und doch war es ein Pyrrhussieg für Keller, wie sich schnell herausstellen sollte. Elend erging es dem Jogi in der Fremde, in der Schule lief es nicht rund. Er fühlte sich allein, ein Jüngling unter angehenden Männern. Die Freundin fehlte.
Es dauerte genau zwei Tage, da erreichte Keller die Kunde: Der Jogi war wieder daheim! Doch nicht nur das. Er wollte jetzt gar nichts mehr vom Fußball wissen. »Ich hatte ein gutes Verhältnis zum südbadischen Verband. Wir haben dann dem DFB gegenüber erst einmal gesagt, dass er wegen der Krankheit seines Vaters zurückmusste, was natürlich nicht stimmte. Aber so hatte er Zeit gewonnen. Doch das Problem war: Er wurde ja weiter in die Jugend-Nationalmannschaft berufen, und dann mussten wir irgendwann einmal Farbe bekennen und sagen, dass er im Moment nicht spielt.« Keller atmet noch einmal schwer aus. »Das war eine ausgewachsene menschliche Krise, das ging ja fast ein ganzes Jahr. Ich sag es ja ganz ehrlich, für mich war es wegen der ganzen Kickerei das Schlimmste.«
Die erste Liebe hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck bei Löw. Noch fünfunddreißig Jahre später wird er in einem Interview mit der Welt am Sonntag sagen: »Ich glaube, wenn du als Junge das erste Mal das Gefühl hast, dass da irgendetwas gut duftet, dann war das eine Frau.«
Die Keller’sche Erlösung erfolgte gerade noch rechtzeitig, bevor es für die große Karriere zu spät gewesen wäre: »Das Mädel ist nach Todtmoos gezogen, nicht weit weg von hier, samt Mutter. Und kurz darauf war Schluss.«
Der Fußballspieler Löw war zurück. Und doch würde er nie wieder das Trikot seines Dorfes überstreifen. Gar aus dem Verein wollten sie Löw ausschließen, erzählt Keller und klingt noch heute ehrlich empört. »Die beiden Klubs in Schönau hatten ja fusioniert. Und nun stellten FCler den Vorstand, aber der Jogi war ja ein TuSler, wie alle Spieler von mir. Also wollten ihn einige aus dem Verein ausschließen, weil er sich angeblich nicht vereinskonform verhalten hatte in Monaco.«
Doch so weit sollte es nicht kommen. Kaum hatte Löw sich zurückgemeldet, erreichte Keller ein Anruf aus Freiburg, der Löws Leben schlagartig eine neue Wendung geben sollte. Am Hörer war ein Mann, der in den folgenden Jahren genauso wichtig für Löw werden sollte wie Keller zuvor. Der Mann fragte den Schönauer Trainer, was der davon hielte, wenn er diesen jungen Löw nach Freiburg holte. Nicht zum SC. Nicht zum FC. Sondern zur im Jugendfußball aufstrebenden Eintracht. Keller zögerte nicht lange: »Ich habe dann gesagt: Sofort. Hier bekommt der Jogi kein Bein mehr auf den Boden.«
Er vertraute dem Mann.
Er vertraute Pit Zick.
2
Bundestrainer 2004–06: Statthalter der Revolution
Wer hat den Bundestrainer Löw nun auf den Weg gebracht?
Natürlich ist da Jürgen Klinsmann zu nennen, er wird in der Löw’schen Gründungsgeschichte eine zentrale Rolle spielen; er wird es sein, der diesen Löw aufs Gleis setzt. Doch wer wirklich die Keimzelle für all das, was sich ab 2004 im deutschen Fußball abspielen wird, finden will, der muss noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen, bis zum Donnerstag, den 24. Juni 2004.
Um genau 9.28 Uhr eröffnete der damalige Teamchef Rudi Völler die Pressekonferenz am Tag nach der Partie gegen Tschechien in einem schmucklosen Saal in Almancil an Portugals Algarve. Gerade eine Nacht lag die 1:2-Niederlage der Nationalmannschaft gegen Tschechien im José-Alvalade-Stadion von Lissabon zurück. EM-Aus in der Vorrunde, zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Wenn das kein unheilvoller Vorbote war. Öffentlichen Druck hatte Völler freilich kaum zu befürchten. Niemand wollte ihn aus dem Amt jagen, zwei Jahre war es erst her, dass er eine moderat begabte Elf ins Finale der Weltmeisterschaft geführt hatte. Die Deutschen liebten ihre Tante Käthe noch immer.
Und doch sah dieser Völler selbst seine Zeit gekommen, er wollte keine Hypothek sein. Schon in den Minuten nach dem Schlusspfiff war seine Entscheidung gereift: Er würde zurücktreten.
Man könnte in der Rückschau glauben, er habe bereits gewusst, wer ihm da nachfolgen würde. Über jenen Mann, dessen Namen sie alle noch nicht kannten, erklärte er also: »Der muss ein bisschen, ja, machen können, was er will. Das ist ganz wichtig, dass du wirklich die Freiheiten hast, auch mal ein Spiel zu verlieren oder mal Dinge zu machen, die nicht jedem gefallen. Das ist wichtig in diesem Geschäft: Dass er trotzdem die Rückendeckung hat und auch Ruhe bewahrt und genau weiß, ich mach es nur diese zwei Jahre, und dann nach mir die Sintflut.«
Kurz darauf bestieg er den Mannschaftsbus. Ein paar Minuten nach elf rollte das Gefährt die steile Hoteleinfahrt hinauf, zum Flughafen nach Faro.
Die letzte Fahrt des Teamchefs Rudi Völler hatte begonnen.
Der Weg war frei.
Einen Monat später fuhr Berti Vogts mit seinem Sohn Justin im Camper die amerikanische Westküste entlang. Nahe Huntington Beach, Kalifornien, klingelte das Telefon. Am Apparat war André Gross, der Berater eines Freundes, der ganz in der Nähe lebte. »Willst du nicht wenigstens mal Hallo sagen«, sagte Gross mehr, als er fragte. »Aber ich bin doch hier mit meinem Sohn im Camper unterwegs«, antwortete Vogts. »Der Jürgen ist stinksauer, wenn du nicht kommst«, gab Gross zurück.
Kurz darauf saßen Berti und sein Sohn im Beachhouse des Auswanderers Jürgen Klinsmann. Eine gemeinsame Geschichte verband sie, 1996 war der Stürmer Klinsmann unter dem Bundestrainer Berti Vogts Europameister in England geworden.
Doch das war acht Jahre her, und im Sommer des Jahres 2004 hatte der deutsche Fußball mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Der Deutsche Fußball-Bund brauchte mal wieder einen neuen Bundestrainer, und der Verband verschwendete nicht viel Zeit, sich bei seiner Suche nach Kräften zu blamieren. Schnell fing sich der DFB zwei Absagen ein, zunächst von Ottmar Hitzfeld, kurz darauf vom sensationell mit Griechenland zum Europameister gewordenen Otto Rehhagel. Eine sogenannte Trainerfindungskommission wurde ins Leben gerufen. Sie bestand aus dem Organisationschef der Weltmeisterschaft 2006 Franz Beckenbauer, Liga-Präsident Werner Hackmann, DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder. Die Lage spitzte sich zu, ein tragfähiges Ergebnis musste her. Um die Philosophie des Neuen ging es eher weniger. Erst in der Rückschau wird man all das, was da bald kommen sollte, als bewussten progressiven Schritt in die Zukunft umdeuten.
Im Amerika ließen es sich Vogts und Klinsmann derweil gut gehen, und natürlich dauerte es nicht lange, bis die beiden Herren dort angelangt waren, wo Fußballer immer eher früher als später im Gespräch ankommen: bei ihrem Sport.
Berti Vogts, Jeans, Hemd unter dem Pullover, lehnt sich vierzehn Jahre später, an einem Donnerstag im April 2018, mit einem schelmischen Grinsen in der Lobby eines Hotels in Düsseldorf zurück. Zeit, den geschichtsträchtigen Abend von 2004 zu rekonstruieren: »Ich sage zu Jürgen: Was machst du eigentlich? Warum willst du nicht mal Trainer werden? Willst du nicht Trainer beim DFB werden? Die haben nichts.« Klinsmanns Antwort sei gewesen: »Nee, da ist alles zu.«
Doch ganz ohne eigene Ambition schien der blonde Stürmer damals nicht gewesen zu sein. Heftig hatte er den Verband öffentlich bereits für sein Krisenmanagement kritisiert, die EM in Portugal lief noch. Eine eingehende Strukturreform rund um die Nationalmannschaft mahnte er an. Klinsmann forderte einen Mann wie Klinsmann, ohne den eigenen Namen zu nennen.
Vogts fährt fort: »Dann haben wir geredet, und dann hat er mir alles so aufgezeichnet.« Die Konversation zwischen den beiden habe sich etwa wie folgt abgespielt:
Klinsmann: »Es braucht einen Teammanager wie Oliver Bierhoff, es braucht Fitnesscoaches.«
Vogts: »Das alles willst du machen?«
Klinsmann: »Klar.«
Vogts: »Aber setzt du das auch durch?«
Klinsmann: »Ja klar, warum nicht? Und mein Co-Trainer wird Joachim Löw. Kennst du den?«
Vogts: »Nein, ich weiß nur, wie er als Spieler war. Als Trainer nicht.«
Lange saßen die beiden Herren wach an jenem Abend, und weil die Zeitverschiebung nach Deutschland neun Stunden beträgt, wurde es in Frankfurt bereits wieder hell. »Da habe ich gesagt: Der Horst R. Schmidt ist immer früh beim DFB. Ich kann mal anrufen und fragen, ob die schon einen Trainer haben«, erzählt Vogts, um dann auch den Dialog mit dem Generalsekretär, ganz der frohgemute Rheinländer, der er sein kann, noch einmal durchzuspielen:
Schmidt: »Wo bist du denn?«
Vogts: »Hier bei Jürgen. Habt Ihr schon einen neuen Trainer?«
Schmidt: »Jetzt sag nicht Jürgen Klinsmann!«
Vogts: »Ich würde mir den mal angucken. Was der für Vorstellungen hat, ich finde das toll!«
Schmidt: »Jürgen Klinsmann?«
Vogts: »Vielleicht denkt ihr mal darüber nach. Was er durchsetzen will, finde ich überragend. Ihr findet keinen Besseren. Er kennt die Abläufe. Kommt doch mal rüber.«
Drei Tage später, Vogts war mit dem Sohn längst weitergezogen, klingelte plötzlich sein Telefon. »Der Jürgen rief mich an. Ob ich zu einem Gespräch in New York dazukommen könnte. Ich sage zu ihm: Ich bin in San Diego mit meinem Sohn. Das musst du jetzt allein machen.« Ganz der alte Kämpe, riet Vogts Klinsmann, er solle in den Verhandlungen bloß standhaft bleiben. Lieber mehr als weniger sollte Klinsmann im Sinne der Ernennung fordern, erst einmal stur bleiben; nachgeben konnte er am Ende ja immer noch. Wer Klinsmann kannte, wusste, dass dies eine seiner leichtesten Übungen sein würde.
Man schrieb Dienstag, den 20. Juli 2004, als Klinsmann sich in New York mit Generalsekretär Schmidt und dem damaligen Präsidenten Mayer-Vorfelder traf. Es sollte nicht lange dauern, bis bei Vogts erneut das Telefon klingelte. Und wieder war es Klinsmann, der anrief: »Du Berti, ich bin der neue Bundestrainer.«
Schon einen Tag später vermeldeten erste Medien die neue Führungstroika: Sie bestand aus Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, Teammanager Oliver Bierhoff und einem neuen Assistenten, der genau genommen so neu gar nicht war, diente er doch bereits 1990 beim WM-Sieg unter Franz Beckenbauer in gleicher Funktion. Beckenbauer war es auch gewesen, der Holger Osieck erneut ins Spiel gebracht hatte.
Entschieden war dies freilich noch lange nicht. Denn Jürgen Klinsmann war angetreten, den Muff unter den Talaren der DFB-Oberen zu entfernen. Sich bei seiner Revolution vom Establishment die Bedingungen diktieren zu lassen, war dabei eher nicht vorgesehen. Schon gar nicht mochte er sich einen Mann an seine Seite stellen lassen, der in den folgenden zwei Jahren sein wichtigster Begleiter werden sollte. Also brach er Ende Juli nach Singen am Bodensee auf, um dort persönlich mit Osieck zu sprechen, doch es sollte nicht um die gemeinsame Zukunft gehen. Es war Osieck selbst vorbehalten, den Posten abzusagen.
Joachim Löw joggte gerade durch den Schwarzwald, als das Telefon klingelte, es war noch früh am Morgen. Er mochte nicht mit dem Gespräch gerechnet haben, gänzlich verwundert war er nicht. Wochen zuvor hatte es bereits in Stuttgart eine wenn nicht wegweisende, so doch vieldeutige Begegnung gegeben. »Der erste unmittelbare Kontakt kam durch Schickhardt und Bierhoff. Die saßen in Stuttgart zusammen, und ich kam zufällig dazu. Ich lebte damals noch in Stuttgart. Der Jürgen war da schon als Trainer bestellt«, berichtet Löw Jahre später über die Zeit, als sich die neuen Zirkel rund um die Nationalmannschaft zu formieren begannen, er selbst aber noch nicht dazugehörte. Der Sportanwalt Christoph Schickhardt galt in jenen Tagen als einer der einflussreichsten Köpfe im deutschen Sport. Wie Jürgen Klinsmanns PR-Berater Roland Eitel, der lange auch für Löw tätig sein würde, stammte er aus Ludwigsburg. Auch Bierhoff vertraute bei Vertragsverhandlungen Schickhardts Diensten, wie Löw, wie so viele im deutschen Spitzenfußball. Ein kurzes beiläufiges Gespräch war damals entstanden, dann war Löw seiner Wege gegangen. Bierhoff dagegen hatte sogleich seinem neuen Bundestrainer seine neueste Idee mitgeteilt und erfahren, dass sie so neu gar nicht mehr gewesen war.