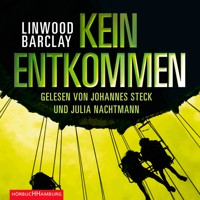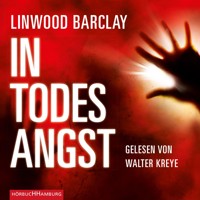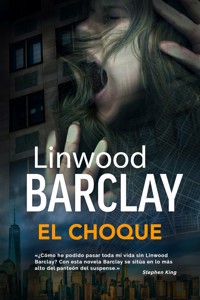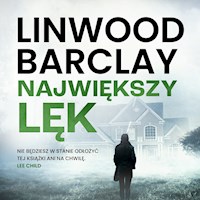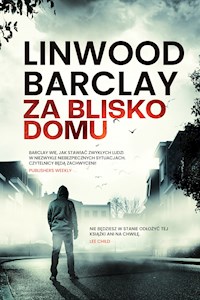9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Promise Falls
- Sprache: Deutsch
Der dritte Teil der spannenden "Trilogie der Lügen" von Bestseller-Autor Linwood Barclay Am Memorial-Day-Wochenende kommt es in der Kleinstadt Promise Falls (New York) zur Katastrophe. Hunderte Menschen müssen mit grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus - Dutzende sind bereits gestorben. Schnell machen die Ermittler das Trinkwasser als Ursache aus. Aber natürlich stellt sich für viele, nicht zuletzt für Privatdetektiv Cal Weaver, die Frage: Wer hat eigentlich etwas davon, das Trinkwasser zu vergiften? Detective Barry Duckworth hat unterdessen noch ein ganz anderes Problem: Eine College-Studentin ist ermordet worden, und die Handschrift des Killers war zuvor bereits bei zwei weiteren rätselhaften Fällen zu erkennen. Die Morde an den beiden Frauen konnten nicht aufgeklärt, der Täter nicht gefasst werden. Dennoch ergeben die ganzen seltsamen Vorkommnisse während der letzten Wochen plötzlich einen Sinn. "Hervorragend. Kann man einfach nicht aus der Hand legen." Stephen King
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Linwood Barclay
Lügenfalle
Promise Falls III Thriller
Aus dem Englischen von Silvia Visintini
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Am Memorial-Day-Wochenende kommt es in der Kleinstadt Promise Falls (New York) zur Katastrophe. Hunderte Menschen müssen mit grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus – Dutzende sind bereits gestorben. Schnell machen die Ermittler das Trinkwasser als Ursache aus. Aber natürlich stellt sich für viele, nicht zuletzt für Privatdetektiv Cal Weaver, die Frage: Wer hat eigentlich etwas davon, das Trinkwasser zu vergiften?
Detective Barry Duckworth hat unterdessen noch ein ganz anderes Problem: Eine College-Studentin ist ermordet worden, und die Handschrift des Killers war zuvor bereits bei zwei weiteren rätselhaften Fällen zu erkennen. Die Morde an den beiden Frauen konnten nicht aufgeklärt, der Täter nicht gefasst werden. Dennoch ergeben die ganzen seltsamen Vorkommnisse während der letzten Wochen plötzlich einen Sinn …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
TAG EINS
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
TAG ZWEI
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Danksagung
Für Neetha
1
Ich weiß, ich werde sie nicht alle kriegen. Aber ich hoffe, ich krieg so viele wie möglich.
TAG EINS
2
Patricia Henderson, einundvierzig, geschieden, Computerbibliothekarin in der Filiale Weston Street der öffentlichen Bibliothek von Promise Falls, war am Samstagmorgen des langen Wochenendes im Mai eine der ersten Toten.
Sie war zum Dienst eingeteilt. Es ärgerte Patricia, dass auf Beschluss des Bibliotheksvorstands sämtliche Filialen in der Stadt geöffnet zu sein hatten, während sie am Sonntag und am Montag, dem Memorial Day, geschlossen bleiben sollten. Wenn schon Sonntag und Montag zu war, warum dann nicht gleich auch Samstag, damit alle Bibliotheksangestellten freinehmen konnten?
Aber nein.
Nicht, dass Patricia etwas Besonderes vorgehabt hätte.
Trotzdem. Sie fand es lächerlich. Sie wusste, dass an einem langen Wochenende in der Bibliothek kaum etwas los war. Die Stadt steckte doch angeblich mitten in einer Finanzkrise. Warum dann öffnen? Zugegeben, am Freitag herrschte größerer Andrang, weil manche Bibliotheksbenutzer, insbesondere die, die übers lange Wochenende wegfuhren, sich noch mit Büchern eindeckten. Den Rest des Wochenendes würde Patricia Däumchen drehen.
Die Bibliothek öffnete um neun Uhr. Für Patricia hieß das, dass sie Viertel vor neun da sein musste. Sie brauchte Zeit, um alle Computer hochzufahren. Sie wurden allabendlich heruntergefahren, um Strom zu sparen, obwohl der nächtliche Verbrauch der dreißig Computer äußerst gering war. Der Vorstand war allerdings auf dem Ökotrip, weshalb nicht nur Strom gespart, sondern auch der Müll getrennt werden musste. Außerdem hingen an sämtlichen Anschlagtafeln Hinweise, dass der Konsum von in Flaschen abgefülltem Wasser zu vermeiden sei. Eines der Vorstandsmitglieder betrachtete die Trinkwasserindustrie, die tonnenweise Müll in Form von Plastikflaschen produzierte, als eines der großen Übel der modernen Gesellschaft, das es aus allen Filialen in Promise Falls zu verbannen galt. »Stellen Sie Pappbecher zur Verfügung, die man an den Trinkwasserspendern füllen kann«, hatte dieses Vorstandsmitglied gesagt; weshalb jetzt in der Bibliothek statt der Plastikbehälter die Papierbehälter der Abfallsammler überquollen.
Und wem passte das so gar nicht in den Kram? Diesem, wie hieß er noch mal? Diesem Finley, der mal Bürgermeister gewesen war und jetzt eine Wasserabfüllanlage betrieb. Patricia war ihm erst vor kurzem zum ersten – und, wie sie hoffte, auch letzten – Mal begegnet. An dem verhängnisvollen Abend im Constellation-Autokino. Sie war mit ihrer kleinen Nichte Kaylie und deren Freundin Alicia zur Abschiedsvorstellung gefahren. Gott, was für eine Schnapsidee! Zuerst war die Leinwand eingestürzt, was die Mädchen fast zu Tode erschreckt hatte. Dann war auch noch dieser Finley aufgetaucht, um sich als Helfer in der Not zu produzieren und dabei fotografieren zu lassen.
Politiker, dachte Patricia. Wie sie Politik hasste, und alles, was damit zu tun hatte.
Apropos Politik. Um vier Uhr morgens hatte Patricia wach gelegen und an die Decke gestarrt, weil ihr die bevorstehende öffentliche Versammlung nicht aus dem Kopf ging, bei der das Thema Internet-Filter diskutiert werden sollte. Die Debatte wurde schon seit Jahren geführt, doch stets ohne abschließendes Ergebnis. Sollte die Bibliothek auf ihren Computern Filter installieren, die den Zugang zu bestimmten Webseiten blockierten? Damit sollten Minderjährige daran gehindert werden, auf pornographische Inhalte zuzugreifen. Doch das Dilemma bestand darin, dass Filter oft nicht die Inhalte aussiebten, für die sie gedachten waren. Sie blockierten Seiten, die durchaus jugendfrei waren, und erlaubten den Zugriff auf andere, die es nicht waren. Und darüber hinaus ging es auch noch um Rede- und Lesefreiheit.
Wie alle Veranstaltungen dieser Art würde auch diese ausarten – zu einem Schreiduell zwischen den Ultrakonservativen, die einen homosexuellen Subtext bei den Teletubbies erkannten und Computer ohnehin für Teufelszeug hielten, und den Ultralinken, die auch damit leben konnten, wenn Portnoys Beschwerden als Kindergartenlektüre herangezogen würde.
Um zehn nach fünf fand Patricia sich damit ab, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war. Sie schlug die Decke zurück und startete in ihren Tag.
Im Bad schaltete sie das Licht ein und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel.
»Ihh«, sagte sie und rieb sich mit den Fingerspitzen die Wangen. »IST.«
Das war das Mantra von Charlene, ihrer privaten Fitnesstrainerin.
Immer Schön Trinken. Im Klartext: Sieben volle Gläser Wasser pro Tag.
Patricia ergriff das Glas neben dem Waschbecken, drehte das Wasser auf und ließ es laufen, bis es kalt war. Sie füllte das Glas und trank es in einem Zug leer. Dann drehte sie den Hahn in der Dusche auf, hielt die Hand unter den Strahl, bis er warm genug war, zog sich das lange weiße T-Shirt, in dem sie schlief, über den Kopf und stellte sich unter die Brause, wo sie so lange blieb, bis sie merkte, dass das warme Wasser langsam zu Ende ging. Sie tat sich Shampoo ins Haar und seifte sich ein, spülte sich ab und ließ sich den Wasserstrahl übers Gesicht regnen.
Trocknete sich ab.
Zog sich an.
Spürte – eigenartigerweise – ein Jucken am ganzen Körper.
Machte sich das Haar und schminkte sich.
Als sie die Küche betrat, war es halb sieben. Noch immer jede Menge Zeit, bis sie aus dem Haus musste. Mit dem Auto waren es zehn Minuten bis zur Bibliothek. Fünfundzwanzig, sollte sie sich entschließen, das Rad zu nehmen.
Patricia holte eine kleine Metalldose aus dem Schrank, in der sie mehr als ein Dutzend verschiedener Pillen- und Vitamindosen aufbewahrte. Vier davon öffnete sie und schüttelte jeweils eine Tablette heraus. Kalzium, niedrig dosiertes Aspirin und Vitamin D. Dazu noch eine Multivitamintablette, die zwar auch Vitamin D enthielt, aber nach Patricias Gefühl nicht genug.
Sie steckte sich alle Tabletten auf einmal in den Mund und spülte sie mit einem kleinen Glas Wasser aus dem Hahn in der Küche hinunter. Sie wand sich voller Unbehagen in ihrer Bluse, als sei diese aus Wolle.
Patricia öffnete den Kühlschrank und stierte hinein. Wollte sie ein Ei? Hartgekocht? Gebraten? Klang nach ziemlich viel Aufwand. Sie schloss die Tür, kehrte zum Schrank zurück und holte eine Packung Special K heraus.
»Boah«, sagte sie.
Er erfasste sie wie eine Welle. Schwindel. Fühlte sich an, als kämpfe sie gegen einen heftigen Wind, der sie umzuwehen drohte. Sie stützte sich mit beiden Händen auf der Theke ab. Geht gleich wieder vorbei, sagte sie sich. Vermutlich nicht der Rede wert. Einfach zu früh aufgestanden.
So, anscheinend war’s das. Sie nahm eine Schale aus dem Schrank, schüttete Getreideflocken hinein.
Blinzelte.
Blinzelte noch einmal.
Das »K« auf der Packung konnte sie klar erkennen, doch das »Special« war an den Rändern ausgefranst. Sehr merkwürdig, denn es war nicht gerade klein gedruckt. Nicht wie die Buchstaben in einer Zeitung, sondern gut zweieinhalb Zentimeter hoch.
Patricia kniff die Augen zusammen.
»Special«, sagte sie.
Sie schloss die Augen und schüttelte den Kopf in der Erwartung, gleich wieder normal zu sehen. Doch als sie die Augen öffnete, war ihr wieder schwindlig.
»Was zum Teufel?«
Ich muss mich hinsetzen.
Sie ließ die Müslischale stehen, tastete sich zum Tisch und zog einen Stuhl darunter hervor. Drehte sich der Raum? Ein ganz klein wenig?
Es war schon ewig her, seit sie zuletzt einen Brummschädel gehabt hatte. Mit ihrem Ex, Stanley, hatte sie im Lauf der Jahre ziemlich oft einen über den Durst getrunken. Doch selbst damals nie so viel, dass sich alles um sie gedreht hätte. Um eine Erinnerung dieser Art zu wecken, musste sie schon in ihre Zeit als Studentin am Thackeray College zurückgehen.
Aber Patricia hatte nicht getrunken. Und was sie jetzt spürte, war etwas ganz anderes als damals.
Jetzt fing nämlich ihr Herz an zu rasen.
Sie legte eine Hand auf die Brust, direkt über dem Ansatz ihrer Brüste, um festzustellen, ob wirklich zu fühlen war, was sie ja bereits spürte.
Da-dam. Da-dam. Da-da-dam.
Ihr Herzschlag hatte sich nicht nur beschleunigt. Er kam auch ganz unregelmäßig.
Patricias Hand wanderte von der Brust zur Stirn. Ihre Haut war kalt und feucht.
Konnte das ein Herzinfarkt sein? Aber so alt war sie doch noch nicht. Oder? Und sie war gut in Form. Sie trieb Sport. Sie radelte oft zur Arbeit. Herrgott, sie hatte eine private Fitnesstrainerin.
Die Tabletten.
Irgendwie musste sie die falschen Tabletten erwischt haben. Aber war in diesen Dosen irgendetwas, das solche Beschwerden hervorrufen konnte?
Nein.
Sie stand auf, spürte, wie sich der Fußboden unter ihr bewegte, als werde Promise Falls gerade von einem Erdbeben erschüttert. Allerdings ein nicht gerade häufiges Ereignis im Staat New York.
Vielleicht sollte ich meinen Arsch doch ins Krankenhaus schwingen.
Gill Pickens stand bereits an der Kücheninsel, trank seine dritte Tasse Kaffee und las auf seinem Laptop die New York Times. Er war nicht besonders überrascht, als seine Tochter Marla mit Matthew, seinem zehn Monate alten Enkel, auf dem Arm in die Küche kam.
»Er hört einfach nicht auf zu quengeln«, sagte Marla. »Da dachte ich, ich steh auf und geb ihm was zu essen. Oh, Gott sei Dank, du hast schon Kaffee gemacht.«
Gill zuckte zusammen. »Die erste Kanne ist schon alle. Ich mach gleich frischen.«
»Schon gut, ich kann –«
»Nein, lass mich. Kümmer du dich um Matthew.«
»Du bist aber früh auf«, sagte Marla zu ihrem Vater, während sie Matthew in seinem Hochstuhl festschnallte.
»Konnte nicht schlafen«, sagte er.
»Noch immer nicht?«
Gill Pickens zuckte die Achseln. »Mensch, Marla, es ist doch gerade mal zwei Wochen her. Und davor hab ich auch schon nicht besonders gut geschlafen. Soll das heißen, dass du gut schläfst?«
»Manchmal«, sagte Marla. »Sie haben mir was gegeben.«
Natürlich. Man hatte ihr Medikamente verschrieben, die ihr helfen sollten, den Schock über den Tod ihrer Mutter besser zu bewältigen. Und über die Nachricht, dass Marlas Baby, das angeblich bei der Geburt gestorben war, in Wirklichkeit lebte.
Matthew.
Doch auch wenn die Medikamente ihr in manchen Nächten halfen, besser zu schlafen als ihr Vater, so hing über dem Haus dennoch eine Wolke, die nicht so aussah, als würde sie bald weiterziehen. Gill hatte noch nicht wieder zu arbeiten begonnen. Einerseits, weil er sich dieser Herausforderung einfach noch nicht gewachsen fühlte, und andererseits, weil die Behörden Marla das Sorgerecht für Matthew nur unter der Bedingung übertragen hatten, dass sie mit ihrem Vater unter einem Dach lebte.
Gill hielt es für seine Pflicht, anwesend zu sein, obwohl er sich fragte, wie lange das tatsächlich noch notwendig war. Allem Anschein nach war Marla eine hingebungsvolle Mutter. Und es gab noch eine zweite erfreuliche Entwicklung. Marla hatte sich mit den Tatsachen abgefunden. In den ersten Tagen nach Agnes’ Sprung in den Wasserfall hatte Marla behauptet, ihre Mutter sei noch am Leben und werde zurückkehren, um ihr mit dem Kleinen zu helfen.
Marla verstand jetzt, dass das nicht geschehen würde. Sie füllte einen Topf mit heißem Wasser aus dem Hahn, nahm eines der Fläschchen mit Fertigmilch aus dem Kühlschrank, die sie am Vortag zubereitet hatte, und stellte es in den Topf.
Matthew hatte sich auf seinem Stuhl so gedreht, dass er beobachten konnte, was vor sich ging. Sein Blick fiel auf das Fläschchen. Der Kleine zeigte darauf.
»Gah«, sagte er.
»Kommt gleich«, erwiderte Marla. »Ich wärm’s nur ein bisschen auf. Aber inzwischen hab ich was anderes für dich.«
Sie drehte einen Küchenstuhl herum, setzte sich Matthew direkt gegenüber und schraubte den Deckel von einem Gläschen pürierter Aprikosen. Mit einem Plastiklöffelchen nahm sie ein wenig Püree aus dem Glas und hielt es dem Baby an den Mund.
»Das schmeckt dir, was?«, sagte sie und sah hinüber zu ihrem Vater, dessen Blick über den Bildschirm des Laptops glitt. Er schien die Augen zusammenzukneifen.
»Brauchst du eine Brille, Dad?«
Gill blickte auf. Er kam ihr plötzlich sehr blass vor. »Was ist?«
»Es sah gerade so aus, als könntest du nicht richtig lesen, was auf dem Bildschirm steht.«
»Warum machst du das?«, fragte er sie.
Matthew schlug nach dem Löffel und kleckerte Aprikosenpüree auf seinen Stuhl.
»Warum mach ich was?«, fragte Marla.
»So rumwackeln.«
»Ich sitz doch ganz ruhig«, sagte sie und löffelte noch etwas Püree aus dem Gläschen. »Kannst du mir das Fläschchen bringen?«
Der Topf mit dem Fläschchen stand gleich rechts neben dem Laptop, doch Gill schien nicht in der Lage, seinen Blick darauf zu fokussieren. »Irgendwie komisch hier drin, nicht?«, sagte er und stellte seinen Kaffeebecher so nah an den Rand der Arbeitsplatte, dass er kippte, zu Boden fiel und zerbrach. Doch Gill sah nicht nach unten.
»Dad?«
Marla stand auf und ging schnell zu ihrem Vater. »Was ist mit dir?«
»Muss Matthew ins Krankenhaus bringen«, sagte er.
»Matthew? Warum soll Matthew denn ins Krankenhaus?«
Gill blickte seiner Tochter ins Gesicht. »Stimmt was nicht mit Matthew? Glaubst du, er hat, was ich hab?«
»Dad?« Es fiel Marla schwer, sich die aufsteigende Panik nicht anhören zu lassen. »Was ist denn mit dir? Du atmest so schnell. Warum tust du das?«
Gill legte eine Hand auf die Brust, fühlte durch den Morgenmantel, wie sein Herz hämmerte.
»Ich glaub, ich muss mich übergeben«, sagte er.
Das tat er nicht. Stattdessen sank er zu Boden.
Hillary und Josh Lydecker hatten vier Tage voller Angst hinter sich.
Sie hatten ihren zweiundzwanzigjährigen Sohn George seit Dienstagabend nicht mehr gesehen. Jetzt war es Samstagmorgen, und sie hatten noch immer nichts von ihm gehört.
Früh am Mittwochmorgen hätte die Familie nach Vancouver fliegen sollen, um Joshs Verwandte zu besuchen. Als George Dienstagabend weggegangen war, hatte er versprochen, früh nach Hause zu kommen, damit er noch ein paar Stunden schlafen konnte, ehe das Taxi die Familie abholte.
Seine Eltern nahmen es gelassen, als George nicht zu einer vernünftigen Uhrzeit nach Hause kam. Sie waren allerdings erstaunt, dass er überhaupt nicht heimkam. Andererseits hätte es George durchaus ähnlich gesehen, erst anzutorkeln, wenn der Rest der Familie das Gepäck bereits im Taxi verstaute, und mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht zu verkünden: »Hab doch gesagt, ich bin da.« Oder etwas in der Art.
Doch das war nicht geschehen.
Im Gegensatz zu seiner sechzehnjährigen Schwester Cassandra, die, wenigstens bis jetzt, ein Engel war, hatte George sich als Sorgenkind der Familie immer wieder Ärger eingehandelt, zuletzt am Thackeray College, wo er, unter anderem, den Smart eines Professors umgeworfen und auf dem Dach hatte liegen lassen (es war kein großer Schaden entstanden, aber trotzdem). Außerdem hatte er einen jungen Alligator im College-Teich ausgesetzt.
George trank zu viel, selbst für College-Verhältnisse, und handelte oft impulsiv, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Er liebte den Nervenkitzel. Als Teenager wurde er zweimal erwischt, als er nachts durch die Flure seiner Highschool streifte, obwohl die Türen angeblich alle abgeschlossen waren.
»Was hat er angestellt?«, fragte Hillary ihren Mann immer wieder. »Was hat der verdammte Idiot bloß wieder angestellt?«
Josh Lydecker schüttelte immer nur den Kopf. »Er wird schon auftauchen. Bestimmt. Der Dumpfbeutel schläft nur irgendwo seinen Rausch aus. Ganz einfach.«
Doch am dritten Tag war auch Josh allmählich überzeugt davon, dass etwas passiert sein musste.
Am Morgen des ersten Tages hatte Hillary alle Freunde von George angerufen, um sich zu erkundigen, ob irgendwer ihn gesehen hatte. Sie hatte seine Schwester Cassandra beauftragt, über die sozialen Medien die Nachricht zu verbreiten, dass George vermisst wird.
Nichts.
Am Nachmittag wollte Hillary die Polizei von Promise Falls einschalten, doch Josh erhob Einspruch. Er glaubte immer noch, dass George von selbst wieder auftauchen würde. Außerdem befürchtete er, die Polizei könne sich allzu sehr dafür interessieren, was George daran hinderte, nach Hause zu kommen. Ein Gedanke, den Josh jedoch vor seiner Frau geheim hielt, kreiste um die Möglichkeit, dass George und seine Kumpel das Ende ihrer College-Zeit mit Prostituierten feierten. Vielleicht waren sie nach Albany gefahren und trieben dort Gott weiß was.
Hillary rief trotzdem bei der Polizei an.
Dort nahm man alle Angaben zu Protokoll. Doch das Verschwinden eines jungen Mannes, der es gern krachen ließ und bekannt dafür war, allerlei Unfug anzustellen, hatte keine hohe Priorität bei polizeilichen Ermittlungen. Und die örtliche Polizei hatte auch so schon genug zu tun. Eben erst hatte es eine wilde Schießerei in einer Münzwäscherei gegeben, und es war noch nicht einmal eine Woche her, seit ein Irrer das Autokino am Stadtrand von Promise Falls in die Luft gejagt und vier Menschen getötet hatte.
Dieser Irre war noch immer auf freiem Fuß.
Die Lydeckers saßen in diesen vier Tagen nicht untätig herum. Sie hatten das Gefühl, sie müssten etwas unternehmen. Jeden Tag fuhren sie kreuz und quer durch die Stadt und hinaus zum College, klapperten die Kneipen der Stadt ab und fragten immer wieder bei Georges Freunden nach.
Auch bei der Polizei meldeten sie sich wieder, die Georges Verschwinden allmählich ernst zu nehmen begann. Am Donnerstag erschien ein Detective namens Angus Carlson, befragte die Eltern und Cassandra, machte sich Notizen. Er nahm Cassandra später sogar beiseite und fragte sie, ob sie vielleicht etwas über ihren Bruder wisse, was die Eltern nicht erfahren sollten. Etwas, was ihm helfen könnte, George zu finden.
»Na ja«, sagte sie. »Er bricht gern in Garagen ein und schaut, ob er was Brauchbares findet.«
»Wissen deine Eltern das?«
Cassandra schüttelte den Kopf. Und meinte, dass sie es ihnen vielleicht sagen sollte.
Carlson hatte es sich notiert.
Und jetzt war Samstagmorgen. Hillary und Josh saßen unten in der Küche, Cassandra war noch oben im Bett. Hillary war schon seit fünf in der Küche, hatte eine Kanne Tee gemacht und aufgeschrieben, was sie heute unternehmen sollten, um George zu finden.
Die Liste umfasste bis jetzt folgende Punkte:
Detective Carlson anrufen; Neuigkeiten?
noch mal Freunde anrufen.
Orte abfahren, wo George vllt. rumstöbert: stillgelegte Fabriken, Freizeitpark, Autokino
Flugblätter mit Foto von George, Druckerei anrufen, in der Stadt aufhängen
Als Josh herunterkam, war Hillary gerade dabei, frischen Tee zu machen. Sie zeigte ihm die Liste.
»Gut«, sagte er resigniert. »An den Freizeitpark hab ich auch gedacht. Kann mir gut vorstellen, wie er da rumschnüffelt, jetzt wo die dichtgemacht haben. Wird bestimmt alles abgesperrt sein. Ich könnte bei den Betreibern anrufen oder den Detective bitten, dass er’s tut.«
»George würde da reinkommen, auch wenn alles verrammelt ist. Du weißt ja, wie er ist. Er kommt überall rein.«
Josh zögerte. »Was das angeht … Cassie hat mir da was erzählt. Gestern Abend.«
»Was denn?«
»Manchmal … manchmal bricht George wo ein. Nicht richtig, nicht in eine Schule oder so, nur zum Spaß. Er sucht sich unversperrte Garagen, geht rein, lässt Sachen mitgehen.«
»Tut er nicht«, sagte Hillary wütend. Ihr Gesicht war gerötet, und Schweißperlen standen ihr auf der Stirn.
»Ich sag dir nur, was sie mir erzählt hat. Ich glaube … eigentlich wollte ich die Polizei nicht einschalten, für den Fall, dass George Dummheiten gemacht hat, aber das ist mir jetzt egal. Wir sollten nachfragen, ob es Einbrüche gegeben hat. In Garagen. Vielleicht wäre das ein wichtiger Hinweis, um rauszufinden, was – Hillary, geht’s dir gut?«
»Ist das dein Ernst?«, fragte Hillary. »Ich hab diese Woche vielleicht drei Stunden geschlafen, jetzt erzählst du mir, mein Sohn ist ein Dieb, und dann fragst du mich, ob’s mir gutgeht?«
»Ich sag ja nur, du siehst nicht gut aus.«
»Ich kann nicht schlafen, weil ich mir solche Sorgen um mein Baby mache. Ich hab das Gefühl, ich krieg gleich einen Herzinfarkt, und –«
Hillarys Handy, das neben ihrer Teetasse auf dem Tisch lag, vibrierte. Eine SMS.
»O mein Gott, vielleicht ist es George!«, sagte sie, packte das Handy und sah entgeistert auf das Display. »Von Cassie.«
»Cassie?«, wiederholte Josh. »Die ist doch oben.« Er hielt inne. »Oder?«
Hillary, den Tränen nah, zeigte ihrem Mann das Handy.
Die SMS lautete:
Ich glaube, ich sterbe.
»Durchhalten, Audrey«, sagte Ali Brunson. »Nicht schlappmachen. Wir sind gleich da. Alles wird gut.«
Ali hatte das während seiner Zeit als Rettungssanitäter natürlich schon unzählige Male gesagt, oft genug, ohne selbst auch nur eine Sekunde daran zu glauben. Auch dieses Mal hatte er keine große Hoffnung.
Bei Audrey McMichael, dreiundfünfzig, knapp 80 Kilo schwer, schwarz, Schadenreguliererin, mit ihrem Ehemann Clifford seit zweiundzwanzig Jahren wohnhaft in der Forsythe Avenue 21, wies alles darauf hin, dass sie drauf und dran war, die Waffen zu strecken.
Ali trieb Tammy Fairweather, die am Steuer des Rettungswagens saß, zu noch mehr Eile an. Glücklicherweise war es noch früh am Samstagmorgen, und die Straßen waren fast leer. Unglücklicherweise würde das keinen Unterschied machen. Audreys Blutdruck fiel und fiel wie ein Aufzug mit durchschnittenen Kabeln. Im Moment betrug er kaum sechzig zu vierzig.
Als Ali und Tammy bei den McMichaels eingetroffen waren, hatte Audrey sich gerade übergeben. Davor hatte sie nach Angaben ihres Mannes beinahe eine Stunde über Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen geklagt. Ihre Atmung war zunehmend schneller und flacher geworden. Mehrmals hatte sie gesagt, sie könne nichts sehen.
Ihr Zustand verschlechterte sich, nachdem sie sie in den Rettungswagen geladen hatten.
»Wie geht’s uns da hinten?«, rief Tammy.
»Mach dir keine Sorgen um mich. Aber sieh zu, dass wir rechtzeitig vor den Altar kommen«, sagte Ali mit größtmöglicher Gelassenheit.
»Und scheiß auf den Strafzettel«, sagte Tammy über das Heulen der Sirene hinweg. Sie bemühte sich, die Stimmung ein wenig aufzulockern. »Ich hab da so meine Beziehungen.«
Das Funkgerät knackte. Die Notrufleitstelle.
»Gebt sofort Bescheid, wenn ihr das Krankenhaus verlasst«, sagte die männliche Stimme am anderen Ende.
»Sind noch nicht mal da«, funkte Tammy zurück. »Melde mich.«
»Ich brauch euch so schnell wie möglich woanders.«
»Was ist los?«, fragte Tammy. »Machen die anderen alle blau oder was? Sind die alle übers Wochenende beim Angeln?«
»Negativ. Alle im Einsatz.«
»Was?«
»Als ob in der ganzen Stadt die Grippe ausgebrochen wär«, sagte der Funker. »Sag sofort Bescheid, wenn ihr frei seid.« Die Verbindung brach ab.
»Was hat er gesagt?«, fragte Ali.
Tammy schlug das Lenkrad voll ein. In der Ferne sah sie schon das blaue H auf dem Promise Falls General Hospital. Höchstens noch anderthalb Kilometer bis dahin.
»Da geht was rum«, sagte Tammy. »Nicht das, was ich mir unter einem Samstagmorgen vorstelle.«
Normalerweise begann für Tammy und Ali die Frühschicht an einem Wochenende mit einer entspannten Runde Kaffee bei Dunkin Donut.
Heute hatten sie keine Zeit für Kaffee gehabt. Audrey McMichael war schon ihr zweiter Einsatz. Ihr erster hatte sie in den Breckonwood Drive geführt, zu Terrence Whitely, einem achtundachtzigjährigen pensionierten Statistiker, der wegen Schwindelanfällen und Schmerzen in der Brust den Notruf gewählt hatte. Tammy hatte Ali darauf aufmerksam gemacht, dass er der Nachbar von Rosemary Gaynor war, die vor wenigen Wochen ermordet worden war.
Als Terrence in der Notaufnahme eingeliefert wurde, kam jede Hilfe zu spät.
Hypotonie, dachte Ali. Niedriger Blutdruck.
Und jetzt hatten sie schon wieder eine Patientin mit gefährlich niedrigem Blutdruck, obwohl das nicht das einzige Symptom war.
Ali hob gerade den Kopf, um aus dem vorderen Fenster zu sehen, als Tammy die Bremse durchtrat und »Herrgott!« schrie.
Ein Mann stand mitten auf der Straße. Stehen war nicht der richtige Ausdruck. Eine Hand auf die Brust gepresst, die andere erhoben, um den Wagen aufzuhalten, hielt er sich gerade noch auf den Beinen. Eine Sekunde später klappte er zusammen und erbrach sich.
»Verdammt!«, fluchte Tammy und packte das Funkgerät. »Ich brauch Hilfe!«
»Fahr um ihn rum!«, forderte Ali sie auf. »Wir haben keine Zeit, irgendwelchen Tattergreisen über die Straße zu helfen.«
»Ich kann doch nicht – er liegt auf den Knien, Ali. Herrgott, verdammt!«
Tammy stellte den Schalthebel auf Parken, sagte »Bin gleich wieder da!« und sprang aus dem Rettungswagen.
Der Funker in der Leitstelle fragte: »Was ist los?«
Ali konnte Audrey McMichael nicht allein lassen, um ihm zu antworten.
»Sir!«, sagte Tammy, als sie schnellen Schrittes auf den knienden Mann zuging. »Was ist mit Ihnen, Sir?«
»Helfen Sie mir«, flüsterte er.
»Wie heißen Sie, Sir?«
Der Mann, er war wohl Ende fünfzig, Anfang sechzig, murmelte etwas.
»Wie bitte?«
»Fisher«, sagte er. »Walden Fisher. Mir ist … irgendwie … nicht gut. Mein Magen … musste mich grad übergeben.«
Tammy legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Mr. Fisher, haben Sie noch andere Beschwerden?« Der Mann atmete schnell und flach, genau wie Audrey McMichael und Terrence Whitely.
Das ist vielleicht eine Scheiße, dachte Tammy. Was für eine Riesenscheiße.
»Schwindlig ist mir. Und speiübel. Irgendwas stimmt da nicht.« Er sah die Sanitäterin angsterfüllt an. »Mein Herz, ich glaube, mit meinem Herzen stimmt was nicht.«
»Kommen Sie mit, Sir«, sagte Tammy und führte ihn zur Hintertür des Rettungswagens. Sie würde ihn zu Audrey setzen.
Dabei sein ist alles, dachte sie und schüttelte den Kopf. Bin gespannt, wie’s weitergeht.
In diesem Augenblick hörte sie die Explosion.
Emily Townsend trank den ersten Schluck Kaffee und fand, dass er nicht wie frisch gebrüht schmeckte.
Also schüttete sie die fast volle Kanne – ganze sechs Tassen – samt dem Filter mit dem Kaffeesatz weg und machte neuen.
Ließ das Wasser eine halbe Minute laufen, damit es wirklich frisch war, und goss es erst dann in die Maschine. Setzte einen neuen Filter ein und füllte ihn mit sechs Löffeln Kaffee aus der Dose.
Drückte auf den Knopf.
Wartete.
Als die Maschine piepste, schenkte Emily sich eine Tasse ein – eine saubere, denn die erste hatte sie bereits in den Geschirrspüler gestellt –, fügte einen Löffel Zucker und einen Tropfen Sahne hinzu und rührte um.
Führte den warmen Becher zum Mund und probierte.
Wahrscheinlich hatte sie sich alles nur eingebildet. Der hier schmeckte gut.
Lag vielleicht an ihrer Zahnpasta, dass die erste Tasse komisch geschmeckt hatte.
Cal Weaver frühstückte – wenn man es so nennen konnte – in einem Raum gleich neben der Eingangshalle des BestBet Inn, das auf halber Strecke zwischen Promise Falls und Albany an der Route 9 lag, nur ein paar hundert Meter von der Kreuzung mit der Interstate 87 entfernt.
Er wohnte da schon fast eine Woche.
Weder ein Beobachtungsauftrag noch ein anderer beruflicher Einsatz hatte dem Privatdetektiv den Aufenthalt in dieser lauschigen Unterkunft (Gratis WiFi!) beschert. Es war schlicht und einfach die einzige Bleibe in der Nähe von Promise Falls, die er sich leisten konnte und die noch Zimmer frei hatte. Er hatte sich hier eingemietet, solange er auf der Suche nach einer neuen Wohnung war. Seine alte lag über einem Buchladen, in den eine Brandbombe geworfen worden war. Das Haus war zwar nicht abgebrannt, aber aufgrund des beißenden Rauchgeruchs und der unterbrochenen Stromversorgung unbewohnbar geworden.
Bei seiner Schwester Celeste und ihrem Mann Dwayne konnte er nicht wohnen. Das hätte die gespannte Atmosphäre, die in deren Haus ohnehin schon herrschte, noch weiter verschärft. Dwayne reparierte Straßen für die Stadt und bekam wegen der jüngsten Sparmaßnahmen kaum noch Aufträge.
Also hatte Cal sich ein Hotel gesucht.
Das BestBet warb mit einem Gratis-Frühstück. Und wieder einmal bestätigte sich der Spruch: Man kriegt, was man zahlt. Am ersten Morgen hatte Cal noch ein Schinken-Käse-Omelett mit Bratkartoffeln und Toast erwartet. Zu seiner großen Enttäuschung bekam er jedoch nur in Plastik verschweißte Portionspackungen Müsli, hartgekochte Eier (die – was für ein Luxus! – immerhin bereits geschält waren), Muffins und Donuts vom Vortag sowie Bananen, Orangen, Joghurt und – lobet den Herrn! – Kaffee.
Ein einziges Mal tauchte ein Hotelangestellter auf. Das aber auch nur, um sich zu vergewissern, dass der Kaffeespender aus Aluminium gefüllt war.
Und der Kaffee – Wunder über Wunder – war sogar genießbar.
Cal saß an einem Fenstertisch mit Ausblick auf den Verkehr auf der Route 9 und blätterte in dem Freiexemplar der Zeitung aus Albany, das er sich genommen hatte. Den trockenen Blaubeer-Muffin spülte er mit dem Kaffee aus seinem Pappbecher hinunter, den er schon zweimal nachgefüllt hatte.
Er hatte nicht damit gerechnet, in der Zeitung Inserate für Mietwohnungen in Promise Falls zu finden, und er wurde nicht enttäuscht. Da es den Promise Falls Standard ja nicht mehr gab, würde er sich nach dem Frühstück im Internet umsehen, ob es neue Angebote gab.
Sein Handy klingelte.
Er zog es aus der Tasche und sah nach, wer ihn anrief.
Lucy Brighton.
Das war nicht ihr erster Versuch seit ihrer letzten Begegnung Anfang der Woche. Zweimal hatte er geantwortet, aber die letzten Anrufe hatte er ignoriert. Er wusste, was Lucy sagen, was sie ihn fragen würde. Genau das, was sie ihn schon davor gefragt hatte.
Was würde er tun?
Er wusste es noch immer nicht.
Sollte er zur Polizei gehen und sagen, was er wusste? Sollte er seinen alten Freund, Detective Barry Duckworth von der Polizei in Promise Falls, anrufen und ihm sagen, dass er wusste, wer Miriam Chalmers ermordet hatte?
Cal wusste, dass er das eigentlich tun sollte. Aber er war nicht überzeugt, dass er damit das Richtige tat.
Wegen Crystal, Lucys elfjähriger Tochter. Lucy musste sie allein großziehen, weil ihr Mann Gerald sich nach San Francisco verdrückt hatte und sich nur höchst selten blicken ließ.
Cal wusste nicht, was aus Crystal werden würde, wenn ihre Mutter ins Gefängnis musste. Lucys Vater war bei der Bombenexplosion im Autokino ums Leben gekommen. Ihre Mutter war schon lange tot.
Wurde der Gerechtigkeit Genüge getan, wenn ein Mädchen auf einmal ohne Mutter dastand?
War das sein Problem? Hätte nicht Lucy sich darüber Gedanken machen sollen, bevor sie –
Das Handy hörte nicht auf zu klingeln.
Es waren nicht viele Frühstücksgäste im sogenannten Speisesaal des BestBet, doch die wenigen Anwesenden blickten verstohlen in Cals Richtung und fragten sich, wann er diesem nervigen Klingeln ein Ende bereiten würde.
Er tippte auf das Display, lehnte den Anruf ab.
Na endlich.
Cal widmete sich wieder seiner Zeitung, die ziemlich ausführlich über die jüngsten Ereignisse in Promise Falls berichtete. Die Polizei tappte auf der Suche nach dem Bombenleger im Autokino noch immer im Dunkeln. Duckworth wurde mit den Worten zitiert, dass man verschiedenen Hinweisen nachgehe und mit einer baldigen Verhaftung rechne.
Sie waren also keinen Schritt vorangekommen. So las sich das für Cal.
Das Handy klingelte. Wieder Lucy.
Er konnte es nicht noch einmal ewig klingeln lassen. Entweder lehnte er den Anruf sofort ab, oder er ging ran.
Cal tippte auf das Display und hielt sich das Handy ans Ohr.
»Hey, Lucy«, sagte er.
»Ich bin nicht Lucy«, sagte eine junge Stimme.
»Crystal?«, fragte Cal.
»Ist da Mr. Weaver?«
»Ja. Bist du das, Crystal?«
»Ja«, sagte sie knapp.
Crystal war ein sonderbares, aber unglaublich begabtes Kind. Das hatte Cal schnellt bemerkt. Sie lebte in ihrer eigenen Phantasiewelt und arbeitete ständig an ihren Graphic Novels. Sie war zögerlich und unbeholfen im Umgang mit anderen, ihre Mutter ausgenommen. Aber zu Cal, der sich offenbar für ihre Arbeit interessierte, hatte sie rasch Vertrauen gefasst.
Benutzte Lucy jetzt ihre eigene Tochter, um ihn davon abzuhalten, zur Polizei zu gehen? Um Mitgefühl zu erwecken? Hatte sie ihre Tochter zu diesem Anruf angestiftet?
»Was gibt’s, Crystal?«, fragte Cal. »Hat deine Mutter gesagt, du sollst mich anrufen?«
»Nein«, sagte Crystal. »Sie ist krank.«
»Das tut mir aber leid. Ist sie erkältet?«
»Ich weiß nicht. Aber ich glaube, sie ist richtig krank.«
»Ich hoffe, sie ist bald wieder gesund. Warum rufst du an, Crystal?«
»Weil sie krank ist.«
Cal schauderte. »Wie krank ist sie, Crystal?«
»Sie bewegt sich nicht.«
Cal stand abrupt auf und ging mit dem Handy am Ohr hinaus zu seinem Wagen. »Wo ist sie?«
»In der Küche. Auf dem Boden.«
»Du musst sofort 911 anrufen, Crystal. Weißt du, wie das geht?«
»Ja. Weiß doch jeder. Hab ich auch gemacht. Da geht aber niemand ran. Ihre Nummer war auf ihrem Handy, deswegen hab ich Sie angerufen.«
»Hat deine Mutter gesagt, was sie hat?«
»Sie sagt gar nichts.«
»Bin schon unterwegs«, sagte Cal. »Aber wähl weiter die 911, ja?«
»Ja«, sagte Crystal. »Wiedersehen.«
Ehe Patricia Henderson sich entschloss, sich auf den Weg ins Krankenhaus zu machen, wählte sie die 911.
Wer den Notruf wählt, erwartet, dass sofort jemand antwortet. Gleich beim erstem Klingeln. Aber 911 antwortete nicht. Nicht beim ersten und nicht beim zweiten Klingeln.
Auch nicht beim dritten.
Beim vierten Klingeln dachte Patricia, dass sie so nicht weiterkam.
Doch dann ging jemand ran.
»Bitte bleiben Sie dran!«, sagte dieser Jemand hastig. Es folgte – Stille.
Selbst in ihrem zunehmend verwirrten Zustand war Patricia eines klar: Sie konnte nicht darauf warten, dass die Notrufzentrale sich wieder meldete.
Sie legte den Hörer hin, ohne sich die Mühe zu machen, richtig aufzulegen. Sah sich nach ihrer Handtasche um. Lag sie da drüben, da gaaanz weit drüben, auf dem Tischchen neben der Wohnungstür?
Patricia kniff die Augen zusammen. Jetzt konnte sie sie erkennen.
Sie taumelte darauf zu und fasste hinein. Zehn Sekunden vergingen, und sie hatte ihre Autoschlüssel noch immer nicht gefunden. Da drehte sie die Tasche um, wollte den Inhalt auf das Tischchen leeren. Das meiste fiel zu Boden.
Sie konnte nicht scharf sehen, deshalb blinzelte sie mehrmals. Es fühlte sich an, als käme sie gerade aus der Dusche und zwinkere sich das Wasser aus den Augen. Sie bückte sich, um den Gegenstand aufzuheben, den sie für den Schlüsselbund hielt, griff aber in die Luft, gut fünf Zentimeter über der Stelle, an der er tatsächlich lag.
»Was soll das, hört auf«, sagte Patricia zu den Schlüsseln. »Schluss damit.«
Sie beugte sich noch ein wenig weiter vor, erwischte den Schlüsselbund, taumelte vorwärts. Als sie sich hinknien wollte, wurde ihr speiübel, und sie musste sich übergeben.
»Krankenhaus«, flüsterte sie.
Mühsam kam sie wieder auf die Beine, öffnete die Tür, ließ sie offen stehen und wankte, mit einer Hand an der Wand Halt suchend, den Hausflur entlang zu den Aufzügen. Sie besaß noch genügend Verstand, einzusehen, dass sie die Treppen von ihrer Wohnung im zweiten Stock hinaus auf die Straße unmöglich schaffen würde.
Patricia blinzelte ein paar Mal, um nicht den Aufwärts- statt den Abwärtsknopf neben der Aufzugstür zu erwischen. Zehn Sekunden später ging die Tür auf. In Patricias Wahrnehmung hätten es auch anderthalb Stunden sein können. Sie stolperte in den Lift, suchte den Knopf fürs Erdgeschoss und drückte darauf. Sie beugte sich vor und lehnte den Kopf an die Stelle, wo die beiden Schiebetüren zusammenstießen, weshalb sie, als die Türen sich wenige Sekunden später im Erdgeschoss öffneten, in die Eingangshalle stürzte.
Es war niemand da, der sie hätte sehen können. Das hieß aber nicht, dass gar niemand da war. Da war jemand.
Trotz ihrer Verwirrtheit glaubte Patricia, in der Frau, die mit dem Gesicht nach unten in ihrem eigenen Erbrochenen lag, Mrs. Gwynn von 3B zu erkennen.
Es gelang Patricia, die Eingangshalle zu durchqueren und das Haus zu verlassen. Sie hatte einen der besten Parkplätze, gleich den ersten nach den Behindertenplätzen.
Eigentlich steht mir heute einer von denen zu, dachte Patricia.
Sie richtete den Autoschlüssel auf ihren Hyundai und drückte auf einen Knopf. Der Kofferraumdeckel schwang auf. Hoppla. Bei der Fahrertür angekommen, drückte sie auf einen anderen Knopf und stieg ein. Sie brauchte eine Weile, um den Schlüssel ins Zündschloss zu bekommen. Als der Motor lief, nahm sie sich einen Augenblick Zeit, um sich vorzubereiten. Legte den Kopf kurz aufs Lenkrad.
Und fragte sich: Wo will ich eigentlich hin?
Ins Krankenhaus. Ja! Ins Krankenhaus. Brillante Idee.
Sie drehte sich um, um rückwärts aus dem Parkplatz zu fahren. Doch der offene Kofferraumdeckel versperrte ihr die Sicht. Kein Problem. Sie stieg aufs Gas und fuhr in den Volvo, der Mr. Lewis gehörte, einem pensionierten Sozialversicherungsangestellten, der wie sie im zweiten Stock wohnte, drei Türen weiter.
Ein Scheinwerfer ging zu Bruch, aber Patricia hörte es nicht.
Sie legte den Gang ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz. Der Hyundai schlingerte, weil sie das Lenkrad viel zu stark einschlug, wie jemand, der mehrere über den Durst getrunken hatte. Oder SMS schrieb.
In kürzester Zeit schoss der Wagen mit fast 100 durch eine 50er-Zone. Was Patricia nicht mitbekam, war, dass sie die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Sie fuhr nicht zum Krankenhaus, das, Ironie des Schicksals, nur einen Kilometer entfernt war, sondern war auf dem Weg zur Filiale Weston Street der Stadtbibliothek von Promise Falls.
Ihr letzter Gedanke, bevor sie das Bewusstsein verlor und ihr Herz zu schlagen aufhörte, galt der Versammlung zum Thema Internet-Filter. Sie würde diesen engstirnigen puritanischen Armleuchtern, die alles, was man auf einem Bibliothekscomputer zu sehen bekam, strengstens zensieren wollten, sagen, dass sie sie am Arsch lecken konnten.
Leider sollte sie dazu nicht mehr kommen. Ihr Hyundai war nämlich gerade quer über drei Fahrspuren und eine Gehsteigkante in eine Tankstelle gerast und mit 100 in eine SB-Zapfsäule gedonnert.
Die Explosion war noch kilometerweit weg zu hören.
Seit er als Pressesprecher und Wahlkampfmanager für Randall Finley, Eigentümer der Finley-Quelle sowie ehemaliger und – wie er selbst hoffte – zukünftiger Bürgermeister von Promise Falls arbeitete, brachte David Harwood jeden Tag literweise und gratis in Flaschen abgefülltes Wasser mit. Das Zeug kam schneller ins Haus, als er und seine Mitbewohner es verbrauchen konnten.
Seinem Sohn Ethan, der eigentlich hauptsächlich Milch trank, steckte David trotzdem jeden Tag eine Flasche Wasser in sein Lunchpaket. Seine Eltern, die bei ihm und Ethan wohnten, bis ihre Küche fertig renoviert war, waren hin- und hergerissen, was das Gratiswasser und dessen Spender betraf. Davids Mutter Arlene verschmähte inzwischen Leitungswasser und trank nur noch das aus den Flaschen. Damit wollte sie ihrem Sohn zeigen, dass sie mittlerweile hinter seiner Entscheidung, für Finley zu arbeiten, stand, auch wenn ihre Meinung über Davids neuen Arbeitgeber getrübt war. Denn vor ein paar Jahren hatte dieser in mindestens einem Fall ein ausgeprägtes Interesse an einer minderjährigen Prostituierten an den Tag gelegt.
Davids Vater Don hingegen teilte die Abneigung seiner Frau gegen den Ex-Bürgermeister nicht. Vielmehr vertrat auch er die Ansicht, die Finley David gegenüber geäußert hatte: Wenn alle Welt sich weigerte für Arschlöcher zu arbeiten, läge die Arbeitslosenquote wohl bei fast hundert Prozent. Und es gab noch viel größere Arschlöcher als Finley.
Dons Wohlwollen für Finley erstreckte sich jedoch nicht auf dessen Produkt. Für ihn war in Flaschen abgefülltes Wasser die ultimative Abzocke. Allein den Gedanken, teures Geld für etwas zu zahlen, was man beinahe gratis aus dem Wasserhahn haben konnte, hielt er für absurd.
David widersprach ihm da keineswegs.
»Jetzt knöpfen sie uns schon Geld fürs Fernsehen ab«, schimpfte Don. »Als ich Kind war, gab’s das noch gratis. Und dann diese Luxusradiosender, für die man ein Abonnement braucht. Mir reicht die gute alte Mittelwelle. Meine Güte, was werden die sich noch einfallen lassen? Bezahlklos für zu Hause?«
Als David in die Küche kam und den Kühlschrank öffnete, war darin mehr Platz, als er erwartet hatte. »Du schlabberst das Zeug ja in rauhen Mengen«, sagte er zu seiner Mutter, die bereits das Frühstück für seinen Vater zubereitete. David hätte schwören können, dass die beiden schon um drei Uhr morgens aufstanden. Er hatte es noch nie vor ihnen in die Küche geschafft.
»Ich nehm’s zum Kaffeemachen«, sagte sie.
Don, der sich mit dem Finger um den Becherhenkel abmühte, die Nachrichten auf dem Tablet zu lesen, blickte auf: »Was machst du?«
Arlene sah ihn kurz an. »Nichts.«
»Du hast den mit dem Zeug aus der Flasche gemacht?«
»Ich versuch ja nur, es zu verbrauchen.«
Don schob den Becher von sich. »Den trink ich nicht.«
Arlene drehte sich um und stemmte eine Hand in die Hüfte. »Tatsächlich?«
»Tatsächlich«, bestätigte Don.
»Hab aber nicht gehört, dass du dich über den Geschmack beschwert hättest.«
»Darum geht’s nicht«, sagte er.
Arlene zeigte auf die Kaffeemaschine. »Na gut, dann schütt den weg und mach dir einen neuen.«
Don Harwood blinzelte. »Ich mach nie Kaffee. Du machst den doch immer. Ich erwische nie die richtige Menge.«
»Dann hast du jetzt Gelegenheit, es zu lernen.«
Sie starrten einander sekundenlang an. Dann zog Don seinen Becher wieder zu sich heran. »Na gut. Aber ich bin dagegen. Nur fürs Protokoll.«
»Ich werd’s CNN twittern«, sagte seine Frau.
»Jetzt glaub ich’s aber«, sagte David.
»Lieber nicht«, sagte Arlene. »Was blüht dir heute mit unserem, Gott bewahre!, möglichen zukünftigen Bürgermeister?«
»Nicht viel«, sagte David. »Sieht nach einem ruhigen Tag aus.«
Plötzlich hob sein Vater den Kopf wie ein Hirsch, der den sich anpirschenden Jäger erlauscht. »Hört ihr das? Da muss irgendwo ein Großbrand wüten. Diese Sirenen heulen schon den ganzen Morgen.«
Diese Sirenen weckten Victor Rooney.
Einige Minuten nach acht schlug er die Augen auf. Warf einen Blick auf den Radiowecker neben seinem Bett, die halbleere Bierflasche daneben. Er hatte gut geschlafen, trotz allem, und fühlte sich gar nicht so schlecht, obwohl es schon fast zwei gewesen war, als er ins Bett fiel. Aber kaum hatte sein Kopf das Kissen berührt, war er weg gewesen.
Seine Hand kam unter der Decke hervor und schaltete das Radio ein. Vielleicht erwischte er noch die Nachrichten. Doch die Acht-Uhr-Nachrichten des Senders aus Albany waren gerade zu Ende gegangen, und jetzt gab es Musik. Bruce Springsteen. »Streets of Philadelphia«. Ein Lied über die Stadt, in der die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde. Schon irgendwie angemessen für den Samstag eines Memorial-Day-Wochenendes, an dem der Männer und Frauen gedacht wurde, die im Kampf für ihr Land ihr Leben geopfert hatten.
Passend.
Victor hatte Springsteen immer gern gehört, aber dieser Song machte ihn traurig. Er und Olivia hatten einmal davon gesprochen, in ein Springsteen-Konzert zu gehen.
Olivia hatte Musik geliebt.
Sie war nicht so wild auf Bruce gewesen wie Victor, hatte aber ihre eigenen Favoriten gehabt, insbesondere Bands aus den sechziger und siebziger Jahren. Simon und Garfunkel. Creedence Clearwater Revival. Die Beatles selbstverständlich. Einmal hatte sie »So Happy Together« gesungen, und er hatte sie gefragt, von wem das denn wieder sei. Von den Turtles hatte sie gesagt.
»Jetzt verarschst du mich aber«, hatte er erwidert. »Es hat wirklich Typen gegeben, die sich Turtles nannten? So was Lahmes? Schildkröten?«
»Die Turtles«, hatte sie ihn verbessert. »Wie die Beatles. Niemand sagt einfach nur Beatles. Und wenn du Beatles mit zwei ee schreibst, werden Käfer draus. Warum dann nicht auch Schildkröten?«
»So happy together«, hatte er gesagt und sie fest an sich gezogen. Damals waren sie noch Studenten und auf dem Gelände des Thackeray College unterwegs gewesen.
Fast ein Jahr bevor es geschehen war.
Diese Woche vor drei Jahren.
Die Sirenen heulten.
Victor lag da und regte sich nicht. Hörte nur zu. Eine der Sirenen klang, als käme sie aus dem Osten der Stadt, eine andere wie aus dem Norden. Streifen- oder Rettungswagen höchstwahrscheinlich. Die Feuerwehr hörte sich anders an. Deren Sirenen klangen tiefer, heiserer. Jede Menge Bass.
Wenn es die Rettung war, dann waren die Wagen wahrscheinlich auf dem Weg ins Promise Falls General Hospital.
Ganz schön viel Betrieb auf den Straßen heute Morgen.
Was da wohl los war?
Ausnahmsweise hatte er mal keinen Kater. An diesem Morgen hatte er einen ziemlich klaren Kopf. Er war letzte Nacht nicht auf Sauftour gewesen. Doch als er heimkam, hatte er sich mit einem Bier belohnt.
Leise hatte er den Kühlschrank geöffnet und sich eine Flasche Bud herausgeholt. Er wollte seine Vermieterin nicht wecken, Emily Townsend. Sie hatte das Haus nach dem Tod ihres Mannes behalten und ihm ein Zimmer im ersten Stock vermietet. Er hatte sich die Flasche mitgenommen und sie auf dem Weg nach oben schon halb leer getrunken. Dann war er eingeschlafen, noch ehe er sie hatte austrinken können.
Jetzt war sie bestimmt warm.
Victor griff trotzdem danach und trank einen Schluck. Er verzog das Gesicht und stellte die Flasche wieder auf den Nachttisch, doch zu nahe an die Kante. Sie fiel zu Boden, Bier ergoss sich über Victors Socken und den Bettvorleger.
»Ach, du Scheiße«, sagte er und packte die Flasche, bevor sie vollends auslief.
Er schwang die Beine aus dem Bett und stand auf, wobei er darauf achtete, nicht in die Pfütze zu steigen. Nur mit seinen blauen Boxershorts bekleidet, öffnete er seine Zimmertür und trat hinaus auf den Flur. Mit fünf Schritten hatte er das Bad erreicht. Es war frei, und er holte sich ein Handtuch von einem der Halter.
Auf dem Rückweg blieb er am Treppenabsatz stehen.
Es duftete nach frisch gebrühtem Kaffee, doch im Haus war es ungewöhnlich still. Emily war Frühaufsteherin und stellte als Erstes immer gleich Kaffee auf. Sie trank mindestens zwanzig Tassen pro Tag und hatte die Maschine fast durchgehend an.
Victor hörte nichts von ihr. Weder aus der Küche noch sonst wo im Haus.
»Emily?«, rief er.
Er erhielt keine Antwort. Da kehrte er in sein Zimmer zurück, ließ das Handtuch dort auf den Boden fallen, wo er das Bier verschüttet hatte, und trat mit vollem Einsatz barfuß darauf herum, bis er das Gefühl hatte, das Handtuch habe aufgesaugt, was möglich war. Er hob es auf und steckte es in einen Korb in der kleinen Wäschekammer am Ende des Flurs.
In seinem Zimmer zog er sich seine Jeans und ein frisches T-Shirt an. Auch ein frisches Paar Socken trieb er auf.
Ohne Schuhe stieg er die Treppe hinab.
Emily Townsend war nicht in der Küche.
Victor stellte fest, dass noch etwas Kaffee in der Kanne war, hatte aber an diesem Morgen keine Lust auf Kaffee. Er ging zum Kühlschrank und überlegte, ob es um acht Uhr fünfzehn noch zu früh für eine Flasche Bier war.
Vielleicht.
Die Sirenen heulten noch immer.
Er holte einen Karton Orangensaft heraus und schenkte sich ein Glas ein. Trank es in einem Zug leer.
Spielte mit dem Gedanken, zu frühstücken.
Meistens aß er Müsli, ließ sich jedoch nicht lange bitten, wenn Emily etwas Aufwendiges machte – Eier mit Speck oder Pfannkuchen oder Arme Ritter. Danach sah es heute allerdings nicht aus.
»Emily?«, rief er noch einmal.
Es gab eine Tür, die von der Küche in den hinteren Garten führte. Zwei, wenn man die Insektenschutztür mitzählte. Die innere Tür stand einen Spaltbreit offen, was Victor Anlass zu der Vermutung gab, Emily sei hinausgegangen.
Victor schenkte sich Orangensaft nach und zog die Tür weiter auf. Durch die Schutztür konnte er in den Garten sehen.
Und da war Emily auch.
Mit dem Gesicht nach unten lag sie in der Einfahrt, etwa drei Meter entfernt von ihrem putzigen blauen Toyota, die Autoschlüssel in einer Hand. In der anderen hatte sie wahrscheinlich ihre Handtasche gehabt, doch die lag nun am Rand der Einfahrt, wo sie sie wahrscheinlich hatte fallen lassen. Emilys Geldbörse und das kleine Etui, in dem sie ihre Lesebrille aufbewahrte, waren herausgefallen.
Emily rührte sich nicht. Von da, wo Victor stand, konnte er nicht einmal erkennen, ob ihr Rücken sich hob und senkte, was immerhin ein Anzeichen dafür gewesen wäre, dass sie lebte.
Er stellte sein Glas ab.
War vielleicht keine schlechte Idee, hinauszugehen und nachzusehen.
3
Duckworth
Zu meinem täglichen Morgenprogramm gehört das Besteigen der Waage.
Dazu muss ich vor allen Dingen allein im Bad sein. Ich kann’s nicht haben, wenn Maureen dabei ist und mir zusieht, neugierig auf die Anzeige schielt und fragt: »Na, tut sich was?« Oder so.
Ich hätte ja nichts dagegen, dass sie hinguckt, wenn sich was täte, aber leider ist das eher unwahrscheinlich.
Außerdem muss ich nackt sein. Wenn ich auch nur ein Handtuch um die Hüften habe, dann sag ich mir beim Blick auf die Anzeige, dass ich schon mal mindestens zwei Kilo abrechnen kann, weil dieses Handtuch doch sehr dick ist.
Und gegessen haben darf ich auch noch nichts. Gelegentlich kommt es vor, dass ich schon ein bisschen was gefrühstückt habe, bevor ich mein Morgengeschäft verrichte. An solchen Tagen steige ich erst gar nicht auf die Waage.
Erst wenn die drei Voraussetzungen erfüllt sind, lasse ich mich auf das Waagnis ein.
Und hetzen lasse ich mich dabei auch nicht. Das Besteigen muss ganz langsam erfolgen, weil der Zeiger sonst womöglich zu schnell nach oben schießt und da steckenbleibt. Und weil Maureen dann später reinkommt und mich fragt, ob ich wirklich schon die 140er-Marke gesprengt habe.
Was nicht der Fall ist.
Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich mich langsam dem 125-kg-Limit nähere. Na gut, das stimmt nicht ganz. Ich hab’s bereits überschritten. Um zwei Kilo.
Egal. Wenn ich auf die Waage steige, halte ich mich mit einer Hand am Handtuchhalter fest. Nicht nur um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, sondern auch um ihr eine Chance zu geben, sich auf das vorzubereiten, was jetzt kommt. Sobald ich mit beiden Füßen fest auf der Waage stehe, lasse ich vorsichtig den Handtuchhalter los.
Und stelle mich den Tatsachen.
Maureen versucht schon seit einiger Zeit, mir beim Abnehmen zu helfen. Sehr liebevoll. Nie ist ihr ein Wort der Missbilligung über mein Aussehen über die Lippen gekommen. Sie behauptet, dass sie mich noch genauso liebt wie früher. Dass ich noch immer der attraktivste Mann bin, den sie kennt.
Ich bin ihr dankbar für ihre Lügen.
Aber sie sagt, dass mir mehr Obst, Gemüse und Getreide und dafür weniger Donuts, Eis und Kuchen guttäten.
Sie hat ja keine Ahnung.
Ich war beim Arzt. Bei unserer Hausärztin, Clara Moorehouse. Dr. Moorehouse sagt, dass ich Grenzdiabetiker bin. Dass mein Blutdruck gefährlich hoch ist. Dass ich mein Übergewicht an der schlimmsten Stelle überhaupt mit mir herumschleppe – am Bauch.
Unlängst ist mir das so richtig bewusst geworden. Eine Frau, die drüben im Irak Bomben entschärft hat, war da und hat uns geholfen zu rekonstruieren, wie die Sprengsätze an der Kinoleinwand befestigt gewesen sein müssen, um sie in die Luft zu jagen. Sie lief über die Schuttberge, wie eine Bergziege einen Felsrücken hochläuft, und ich konnte nur mit größter Mühe mit ihr Schritt halten.
Ich war völlig außer Atem. Mein Herz raste.
Was ich Dr. Moorehouse gestern auch gesagt habe.
»Sie müssen eine Entscheidung treffen«, sagte sie. »Und die kann Ihnen niemand abnehmen.«
»Ich weiß«, sagte ich.
»Wissen Sie, warum Sie’s tun?«, fragte sie.
»Es schmeckt mir halt«, sagte ich. »Und ich hatte ziemlich viel Stress in letzter Zeit.«
Da musste sie lächeln. »In letzter Zeit?«, fragte sie und sah mich an. »Haben Sie das etwa erst seit einer Woche?«
Was sollte ich darauf sagen?
Ich hatte in letzter Zeit wirklich ziemlich viel Stress. Was natürlich nichts mit meinem Essverhalten zu tun hat. Aber in meinen zwanzig Jahren bei der Polizei von Promise Falls – mein Jubiläum diesen Monat war weitgehend unbeachtet vorbeigegangen – hatte ich noch keinen Monat wie diesen erlebt.
Alles hatte mit dem grauenhaften Mord an Rosemary Gaynor begonnen. Und dann waren diese sonderbaren Vorfälle in der Stadt dazugekommen. Alles Mögliche, von toten Eichhörnchen über ein Riesenrad, das sich plötzlich von allein in Bewegung setzte, bis hin zu einem Sextäter am College und einem brennenden Bus.
Und als ob das noch nicht reichte, dieser Bombenanschlag auf das Autokino.
Und nicht zu vergessen: Randall Finley, dieses Schwein.
Er kandidierte wieder als Bürgermeister und schnüffelte nach Dreck, den verschiedene Leute vielleicht am Stecken haben. Die jetzige Bürgermeisterin, die Polizeichefin, egal wer. Sogar meinen eigenen Sohn Trevor, der in Flaschen abgefülltes Wasser aus Finleys Anlage ausliefert, hatte er erpresst, damit der ihm weitersagte, worüber Trevor mich zu Hause hatte reden hören.
Am liebsten hätt ich das Arschloch umgebracht.
Ich überlegte, ob ich mit dem ganzen Scheiß vielleicht besser zurechtkäme, wenn ich nicht so viel Übergewicht mit mir herumschleppte.
Heute war der Tag der Tage.
Nachdem ich mich gewogen hatte, rasierte ich mich. Samstags schwänze ich schon mal, aber heute wollte ich mir die Mühe machen. Entweder war die Klinge nicht mehr scharf genug oder die Rasiercreme zu mentholhaltig, jedenfalls brannten meine Wangen und mein Hals wie die Hölle. Ich tupfte mir die Wangen gründlich mit dem Handtuch ab. Das half. Aus einer Schublade kramte ich ein riesiges rotes T-Shirt und aus einer anderen eine alte lila Trainingshose, die ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr getragen hatte. Dann holte ich meine Laufschuhe aus dem Schrank. Als Maureen ins Schlafzimmer kam und mich sah, sagte sie: »Was treibst du denn? Du siehst aus wie ein abgehalfterter Superheld.«
»Ich geh heute spazieren«, sagte ich. »Zwei, drei Kilometer. Ich muss heute nicht rein. Hab mir einen Tag freigenommen.«
Was ich brauchte, war ein Monat.
»Ich hab grad Kaffee gemacht«, sagte Maureen.
»Den trink ich, wenn ich zurückkomme. Und Frühstück brauchst du mir auch keins zu machen. Ich ess nur eine Banane oder so.«
Sie sah mich listig an. »So geht das nicht.«
»So geht was nicht?«
»Ich meine, das mit dem Spaziergang ist eine gute Idee. Aber du brauchst mehr als eine Banane. Wenn du jetzt nicht mehr isst, dann ziehst du dir um zehn sechs McMuffin Eggs rein. Ich kann dir helfen. Ich kann –«
»Ich weiß schon, was ich tu«, sagte ich.
»Is’ ja gut, aber wenn du versuchst, zu viel auf einmal zu machen, dann bist du schnell frustriert. Du musst es langsam angehen.«
»Für langsam hab ich keine Zeit«, sagte ich. Es war mir herausgerutscht.
»Was soll das heißen?«, fragte Maureen.
»Nur, dass ich was ändern muss. Da kann ich ja gleich damit anfangen.«
»Was ist zwischen gestern und heute passiert?«
»Nichts.«
»Nein, da ist was passiert.«
Wie durch Osmose war im Laufe der Jahre etwas von meiner Fähigkeit, Lügen auf Anhieb zu wittern, von mir auf Maureen übergegangen.
»Wenn ich doch sag, es ist nichts passiert«, sagte ich und sah dabei weg.
»Warst du bei Dr. Moorehouse?«
»Wo soll ich gewesen sein?« Herrgott, war ich schlecht bei so was.
»Was hat sie gesagt?«
Ich zögerte. »Nicht viel. Nur, na ja, ein, zwei Sachen.«
»Warum warst du bei ihr? Was war der Auslöser?«
»Ich … vor ein paar Tagen, da – also, da ist mir ein bisschen die Puste ausgegangen. Im Autokino. Beim Rumklettern.« Und später auch im Burger King, aber ich sah nicht ein, warum ich diesen Vorfall jetzt auch noch erwähnen sollte.
»Aha«, sagte Maureen langsam.
»Und sie hat gesagt, dass ich mir vielleicht langsam Gedanken machen sollte, ob ich nicht … vielleicht überlegen soll … ein bisschen was an meinem, also an meinem Lebensstil zu ändern, ganz allgemein.«
»Ganz allgemein«, wiederholte Maureen.
»Ja.« Ich zuckte die Achseln. »Und das mach ich halt jetzt.«
Maureen nickte langsam. »Gut. Toll.« Sie musterte mich von Kopf bis Fuß. »Aber so gehst du mir nicht aus dem Haus.«
»So? Wie?«
»Mit dieser Hose. Mein Gott, du siehst aus, als hättest du eine Kugel abgekriegt und in einem Fass voller Trauben dein Leben ausgehaucht.«
Ich sah an mir hinunter. »Ist halt ein bisschen sehr lila.«
»Das kann doch nicht die einzige sein. Lass mich mal nachsehen.« Sie drängte sich an mir vorbei in den begehbaren Kleiderschrank. Ich hörte sie herumrumoren. »Was ist – nein, die nicht. Vielleicht –«
Da klingelte mein Handy. Es hing neben meinem Bett an der Steckdose, wo ich es zum Laden angeschlossen hatte. Ich ging hin und sah nach, wer da anrief, hängte es ab und hielt es mir ans Ohr.
»Duckworth.«
»Carlson.«
Angus Carlson. Unser neuer Ermittler. Eigentlich ein Streifenpolizist, der aber hochgestuft worden war, weil wir zu wenige Leute hatten. Mir fiel wieder ein, dass er heute Dienst hatte.
»Ja«, sagte ich.
Maureen kam mit einer grauen Trainingshose aus dem Schrank. Wie hatte ich die übersehen können?
»Sie müssen reinkommen«, sagte Carlson. »Alle müssen antanzen. Die ganze Truppe.«
»Was ist denn los?«, fragte ich.
»Weltuntergang«, sagte Carlson. »Mehr oder weniger.«
4
Wenn Don Harwood ein seltsames Klappern unter der Motorhaube von Davids Wagen vernahm, brachte sein Sohn es in die Werkstatt. Vor Jahren, als David noch ein Kind war, hatte Don ein Geräusch von der Zimmerdecke gehört, das sonst niemandem aufgefallen war. Prompt hatte sich herausgestellt, dass sich auf dem Dachboden Waschbären eingenistet hatten. Jedes Mal, wenn David Harwood etwas nicht beachtet hatte, was sein Vater hörte, hatte er es später bereut.
Deshalb verließ David die Küche und trat vor die Haustür, als Don sagte, er höre dauernd Sirenen.
Tatsächlich war in der Ferne Sirenengeheul zu hören. Es waren mindestens zwei, vielleicht drei. Vielleicht sogar mehr als drei.
David blickte nach oben, ob Rauch zu sehen war. Doch er wohnte in einem älteren Teil der Stadt, und hier waren die Bäume bereits so hoch gewachsen, dass er nicht sehr weit sehen konnte. Aber irgendetwas war los. David arbeitete zwar nicht mehr bei der Zeitung, seinen Reporterinstinkt hatte er jedoch noch nicht verloren. Er musste wissen, was los war.
Er eilte ins Haus zurück und holte seine Autoschlüssel. Seine Mutter sah ihn und fragte: »Wo willst du hin?«
»Raus«, sagte er.
Bevor er in seinen Mazda stieg, blieb er stehen und lauschte, um festzustellen, wo genau das Sirenengeheul herkam. Eine hörte sich an, als käme sie aus dem Osten, aber eine zweite klang, als käme sie aus dem Westen.
Irgendwie passte das nicht ins Bild. Wenn es ein schweres Unglück gegeben hatte, würden dann nicht alle Sirenen aus einer Richtung heulen? Hatte es vielleicht in mehreren Teilen der Stadt gleichzeitig einen Unfall gegeben? Andererseits konnten natürlich Rettungswagen aus verschiedenen Richtungen zur selben Unglücksstelle fahren.
War ja auch egal. Wenn es sich tatsächlich um die Sirenen von Rettungswagen handelte, dann hatten sie ein gemeinsames Ziel: das Promise Falls General.
Und dort würde er hinfahren.
Ein kurzer Blick nach links und rechts, dann fuhr er rückwärts aus der Einfahrt. Der Mazda stand schon mit den Hinterreifen auf der Straße, als David eine Hupe plärren hörte. Aus heiterem Himmel tauchte ein blauer Lieferwagen auf und schlingerte mit quietschenden Reifen die Straße entlang. Nach Davids Schätzung raste er mit weit über hundert Stundenkilometern durch ein Wohngebiet, in dem nur fünfzig erlaubt waren.
Der Lieferwagen fuhr in dieselbe Richtung, die auch David einschlug. An der nächsten Kreuzung bog er so schnell links ab, dass beinahe nur mehr zwei Räder die Straße berührten.
Auch David gab Gas. Er ließ sein Viertel hinter sich, bis zum Krankenhaus waren es vielleicht noch drei Kilometer. Da sah er den Rauch. Als er um die nächste Ecke bog, sah er drei Feuerwehrwagen mit blinkenden Lichtern an einer brennenden Tankstelle stehen. Quer über der Insel mit den Zapfsäulen entdeckte er die ausgebrannten Überreste eines Pkw.
David hatte den Eindruck, der Wagen sei frontal in eine der Säulen gerast. War das der Grund für den ganzen Wirbel? Eine Explosion an einer Tankstelle?
Er hörte eine Sirene, die sich von hinten näherte. Ein Blick in den Rückspiegel sagte ihm, dass es sich um einen Rettungswagen handelte. Wahrscheinlich würde er in sicherer Entfernung von der Tankstelle stehen bleiben. David hielt mit quietschenden Reifen am Straßenrand.
Doch die Ambulanz fuhr weiter.
David nahm die Verfolgung auf.
Als der Krankenhauskomplex in Sichtweite kam, sah David, dass sich vor dem Eingang der Notaufnahme mindestens ein Dutzend Rettungswagen drängten. Das wilde Geflacker der Rundumleuchten war durchaus dazu angetan, bei fotosensiblen Epileptikern einen Anfall auszulösen. David stellte den Mazda im Halteverbot einer an das Krankenhausgelände grenzenden Straße ab und rannte los.
In früheren Zeiten hätte er in der einen Hand einen Notizblock und in der anderen höchstwahrscheinlich eine Kamera gehabt. Jetzt fühlte er sich irgendwie nackt. Auch wenn ihm sein Handwerkszeug fehlte, so blieb ihm doch seine Beobachtungsgabe, und deshalb fiel es ihm sofort auf.
Normalerweise brachten die Sanitäter die Patienten in die Notaufnahme, sprachen mit dem Aufnahmepersonal und sorgten dafür, dass jemand sich um die Patienten kümmerte, ehe sie wieder losfuhren.