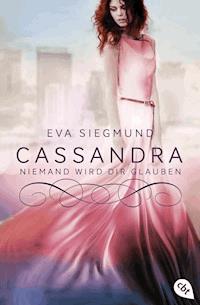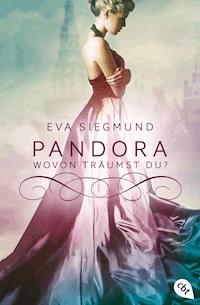13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Wenn dein Schicksal zu groß für dich scheint
In der Trümmerstadt Adeva entscheidet sich für alle 15-Jährigen in der Nacht der Mantai, welche Gabe sie haben. Ein Mal, das auf dem Handgelenk erscheint, zeigt an, ob man telepathisch kommunizieren, unsichtbar werden oder in die Zukunft sehen kann. Doch bei Meleike, deren Großmutter eine große Seherin war, zeigt sich nach der Mantai – nichts. Erst ein schreckliches Unglück bringt ihre Gabe hervor, die anders und größer ist als alles bisher. Als Meleikes Visionen ihr von einem Inferno in ihrem geliebten Adeva künden, weiß sie: Nur sie kann die Stadt retten. Und dass da jenseits der Wälder, in der technisch-kalten Welt von Lúm, jemand ist, dessen Schicksal mit ihrem untrennbar verknüpft ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Ähnliche
EVASIEGMUND
LÚM
ZWEIWIELICHT
UNDDUNKEL
Vorwort zum Völkerauflösungsvertrag
Wir, die Überlebenden des Dritten Weltkrieges, haben uns im Bewusstsein der historischen Bedeutung und der Verantwortung für alle Menschen am heutigen Tage versammelt, um die verbleibenden Staaten aufzulösen und eine neue Gesellschaft zu erschaffen.
Staaten, Religionen und Überzeugungen haben der Menschheit in der Vergangenheit nur Nachteile gebracht. Drei Weltkriege überzogen unsere Erde. Nur ein Bruchteil der gesamten Menschheit hat diese furchtbare Zeit überlebt. Wir mussten uns gemeinsam auf die westliche Halbkugel zurückziehen, da das ehemalige Asien, Russland und weite Teile Europas radioaktiv verseucht und nunmehr unbewohnbar geworden sind.
Viele Menschen mussten ihre Heimat verlassen in dem Wissen, dass sie nie mehr zurückkehren können. Nun werden wir in Zukunft nur noch Nord- und Südamerika bewohnen und versuchen, für unsere Kinder wieder ein gutes und menschenwürdiges Leben aufzubauen.
Gemeinsam sind wir darin übereingekommen, dass die Neubildung von Staaten zwangsläufig erneut in Chaos und Krieg enden würde. Keiner von uns besteht auf Staatsgrenzen, verschiedenen Sprachen oder politischen Führern. All das hat uns erst an diesen Punkt gebracht.
Doch ganz ohne Richtung, ohne Führung und Ziel kann menschliches Miteinander nicht funktionieren.
Wir kommen aus allen Staaten der Erde, sind unterschiedlicher Herkunft und haben unterschiedliche Erziehungen genossen, und uns eint ein Bestreben: Nie wieder darf ein solch vernichtender Krieg ausbrechen wie jener, der nun endlich hinter uns liegt. Unsere Kinder sollen froh und unbeschwert aufwachsen, die Welt soll wieder ins Gleichgewicht kommen, und ein jeder soll in dem Bewusstsein leben, dass wir uns nun eine Erde teilen.
Daher sind wir uns einig, dass von nun an Vernunft und das Streben nach Wissen unser Denken und Handeln leiten soll. Unser Tun soll stets durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gelenkt und unser Handeln an beweisbaren Prinzipien gemessen werden. Die Sprache von Wissenschaft und Forschung ist uns allen vertraut und einleuchtend. Sie ist die Grundlage der Vernunft, des Wachstums und des Wohlstandes. Das Streben nach Wissen soll von nun an die einzige Kraft sein, die unser Handeln bestimmt. Damit ein friedliches Miteinander auf der verbleibenden Welt für alle Zukunft garantiert werden kann.
Und da seit alters her Licht das Symbol des Wissens ist, soll unser neuer, allumfassender Weltenstaat den Namen Unionsstaat des Lichts (UdL) tragen.
Dies bestimmen heute, zum Wohle aller,
die Überlebenden
Es dämmerte bereits, als sie die Lichtung betraten. Schweigend und voller Erwartung waren sie die ganze Nacht gelaufen, um dorthin zu gelangen. Adeva, ihre Stadt, war riesig und erstreckte sich von Horizont zu Horizont, innerhalb ihrer Grenzen gab es keine Wälder, keine Lichtungen. Doch diesen Ort brauchten die Pekuu jedes Jahr ein Mal, in dieser einen Nacht.
Tirese Mey schob ihre Tochter mit sanfter, aber unerbittlicher Entschlossenheit seit Stunden voran. Ihre dunkle, sehnige Hand lag dabei auf Meleikes Schulter, und diese war froh, dass Tirese hinter ihr war. Auch wenn sie sich innig wünschte, auch ihr Vater könne nun bei ihr sein. Doch er war fort.
Zum wiederholten Male blickte sie in das Gesicht ihrer Mutter und versuchte ein Lächeln. Es geriet schief und fühlte sich unangemessen an. Meleike war zu nervös, um aufrichtig lächeln zu können. Heute sollte es endlich so weit sein. Jahrelang hatte sie sich, wie jede Peku, auf diesen Tag gefreut und ihn zugleich gefürchtet. Denn heute würde sich ihr Schicksal entscheiden. Es würde offenbaren, wer Meleike im Innersten war und welche Aufgabe ihr in ihrer Gesellschaft zukommen sollte. Von der heutigen Nacht an würde nichts mehr so sein, wie es vorher war.
Sie fror ein wenig in dem dünnen weißen Hemd, das ihr an den Schultern zu eng war. Sie war nicht so schmal und feingliedrig wie ihre Mutter, von der sie es übernommen hatte. Von der Arbeit in den Ruinen waren ihre Arme und Beine kräftiger, als es Tireses jemals sein würden. Doch einen so starken Griff und unerschütterlichen Stolz wie ihre Mutter hatte Meleike nie besessen.
Langsam und vorsichtig ging sie durch die ungewohnte Umgebung, immer darauf bedacht, sich die nackten Füße nicht an Wurzeln oder Steinen zu verletzen. Oder an den Glassplittern, die überall herumlagen, sogar hier im Wald. Er barg nichts Gutes, und viele Pekuu waren schon hineingegangen, ohne je wieder herauszukommen. Doch in einer so großen Gruppe konnte ihnen nichts geschehen, Meleike wusste das. Sie ließ ihren Blick noch eine Weile auf ihrem kleinen Bruder Koda ruhen, dem es sichtlich immer schwerer fiel, still zu bleiben. Für ihn schien diese Nacht ein einziges großes Abenteuer zu sein. Er tippelte unruhig neben ihr her und holte zwischendurch immer wieder tief Luft, als wolle er etwas Wichtiges sagen, klappte den Mund dann aber folgsam wieder zu. Tirese sorgte mit einem strengen Blick jedes Mal aufs Neue dafür. Dies war Meleikes Nacht. Zumindest sollte sie es werden. Aber in jenem Augenblick beneidete sie ihren Bruder darum, dass er erst neun Jahre alt war. Sechs unbeschwerte Jahre blieben ihm noch bis zu seinem eigenen Mantai-Fest. Er war vergnügt und strahlte Meleike in regelmäßigen Abständen an, als wollte er ihr zeigen, dass er sich für sie freute. Von der Aufregung, die in ihrem Herzen tobte, von ihrer bitteren Angst ahnte er nichts. Auch, weil sie sehr gut darin war, sich nichts anmerken zu lassen. Ihr Gang war aufrecht und ihr Blick fest geradeaus gerichtet. Doch kostete sie diese Körperhaltung gewaltige Mühen.
Alle anderen standen schon Reihe an Reihe auf der Lichtung und blickten stumm nach vorne, als sie ankamen. Jeder hatte seine Kapuze aufgesetzt, sodass Meleike keinen ihrer Freunde von hinten erkennen konnte. Gerade wollte sie nach ihrer eigenen Kapuze greifen, als sie fühlte, dass Tireses Hände auch diese Aufgabe übernahmen.
Gerne hätte sie ihre Mutter in diesem Augenblick angefaucht, dass sie kein Kind mehr sei und es auch alleine machen könne. Nach dieser Nacht würde sie endlich von jedermann anerkannt werden. Das Mantaifest markierte das Übertreten der Schwelle in die Welt der erwachsenen Pekuu.
Gemeinsam schritt die Familie Mey die Gasse entlang, die die anderen für sie gebildet hatten. Ihnen gebührte von jeher die Ehre der ersten Reihe und dieses feierlichen Einzuges, als letzte Familie vor dem Eintreffen des Fürsten. Als sie ungefähr die Mitte des Ganges erreicht hatten, ließ Tirese ihre Tochter endlich los und entfernte sich von deren Seite. Meleike musste den Impuls, sich die schmerzende Schulter zu reiben, unterdrücken.
Auch Koda fiel nun zurück. Meleike schritt als älteste Tochter der Familie Mey voran, gefolgt von ihrem kleinen Bruder und hinter ihm die Mutter. Tirese ging leicht versetzt, um allen zu zeigen, dass an ihrer Seite eine Lücke klaffte, dort, wo vor ein paar Jahren noch Meleikes Vater Yaris ihr Leben flankiert und die Rücken ihrer gemeinsamen Kinder gestärkt hatte. Darauf folgten, ähnlich versetzt, Vater Sabida, der Vater von Meleikes Vater, und schließlich Mama Maela, Tireses Mutter.
Wann immer die Leute Mama Maela erblickten, verstummten sie. Nun hatte in dieser Nacht schon seit den Mitternachtstrommeln kein Mensch mehr auch nur ein Wort gesagt. Dennoch bildete sich Meleike ein, das Schweigen sei noch vollkommener. Als hielte der Wald selbst den Atem an. Alle Pekuu verehrten Mama Maela und das hatte Meleike immer mit Stolz erfüllt. Maela war die größte Seherin von Adeva, die weiseste und stolzeste Frau, eine Legende schon zu Lebzeiten. Ihr Wesen war gütig, und das Wissen, das sie preisgab, war unfehlbar. Doch wählte sie mit Bedacht, wovon sie berichtete und was sie verbarg. Denn eine Voraussicht konnte auch zerstören, und Maela tat alles, ihre Gabe immer nur zum Wohl der Leute einzusetzen und ihnen keinesfalls Schaden zuzufügen. Davon abgesehen war Mama Maela eine etwas schrullige und sehr kleine alte Frau, die sich auch manchmal einen Spaß daraus machte, Dinge von sich zu geben, die zwar weise klangen, aber unter dem Strich nicht den geringsten Sinn ergaben.
Ihre Tochter Tirese schlug mit ihren Fähigkeiten ganz nach der Mutter. Auch ihre Voraussagen waren von meisterhafter Präzision. Tochter einer solchen Seherin zu sein war für Meleike selbst nicht immer leicht, doch sie hatte sich daran gewöhnt, vor ihrer Mutter kaum etwas verbergen zu können, und Tirese wiederum spürte ihrer Tochter nur selten nach.
Alle schienen zu erwarten, dass Meleike ebenfalls das Auge besäße, es lag schließlich in der Familie. Oder dass sie ein Hypne wie Vater Sabida werden und in Zukunft Pekuu hypnotisieren würde, denen Kummer auf der Seele lag. Seit Wochen wurde in der Schule hinter vorgehaltener Hand spekuliert, welche Gabe sich bei Meleike wohl zeigen würde, und auch Koda hatte über kaum etwas anderes gesprochen. Keiner in ihrer Familie, keiner in dieser riesigen Stadt, ihrer ganzen Welt schien die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie keine dieser Fähigkeiten besitzen könnte, dass sie nichts weiter war als eine gewöhnliche Kema. Das war der Grund, warum ihr das Herz bis zum Halse schlug, in dieser Nacht, bei ihrer Mantai. Heute sollte sich zeigen, ob sie mit einer Gabe gesegnet war oder nicht. Und die Selbstverständlichkeit, mit der alle Anwesenden davon ausgingen, dass Meleike Mey alle übertreffen würde, machte sie beinahe wahnsinnig. Doch das schien keinen sonderlich zu interessieren. Das Vertrauen aller war grenzenlos. Dabei stürzte es Meleike in kleinen kurzen und stichelnden Momenten in tiefste Verzweiflung, wenn sie sich fragte: was, wenn nicht?
Meleike selbst wäre am liebsten ein Obskurant wie ihr Vater. Obskuranten konnten mit ihrem Willen steuern, ob sie von anderen wahrgenommen wurden oder nicht. Doch Yaris hatte seine Fähigkeit nur selten eingesetzt, was Meleike nie verstanden hatte. Schließlich erlaubte sie demjenigen, der sie besaß, sich überall aufzuhalten, jeden Raum unbemerkt betreten oder verlassen zu können. Aber die Obskura war eine sehr seltene Gabe, und Tirese hatte gesagt, Meleike solle sich den Gedanken besser gleich aus dem Kopf schlagen. Außerdem hatten die meisten Leute Vorbehalte gegen Obskuranten, weshalb ihr niemand die Obskura von Herzen wünschen mochte. Im Gegenteil.
Als Meleike sich nun an ihren Platz stellen wollte, fühlte sie erneut eine Hand auf ihrer Schulter, eine kleinere, leichtere Hand diesmal. Sie blickte sich um und sah in die schwarzen Augen ihrer Großmutter, schwärzer noch als die Schatten der Bäume, die zitternd nach den Pekuu auf der Lichtung zu greifen schienen. Maela tätschelte wortlos Meleikes Wange und spuckte dann dreimal über deren linke Schulter, ohne sich darum zu kümmern, ob jemand getroffen wurde. Dann lächelte sie ihrer Enkeltochter noch einmal aufmunternd zu und stellte sich an ihren angestammten Platz.
Meleikes Herz pochte wild und hart in ihrer Brust, und es gelang ihr kaum noch, den Atem unter Kontrolle zu halten. Nach wenigen Augenblicken begannen die hinteren Reihen, mit den Füßen zu stampfen und leise zu summen. Dann kamen die Fackelträger durch die Gasse gelaufen, mit festen, entschlossenen Schritten. Sie bildeten die Vorhut.
Und obwohl sich Meleike plötzlich im Innersten wünschte, er käme niemals in die Mitte des nun leuchtenden Halbkreises aus Flammen und Leibern, und sie sich fortwünschte, ihn fortwünschte, folgte er den Fackelträgern doch auf dem Fuße. Mit schnellen, gut gelaunten und zentnerschweren Schritten.
Ihr Fürst, ihr Meister.
Er kam und sie fühlte seinen Atem; sein dunkler Umhang streifte ihre Wange, als er an den Wartenden vorbei zu seinem Platz schritt. Und augenblicklich schoss ein Gefühl in Meleikes Herz, das sie nie zuvor gekannt hatte. Doch sie begriff sofort, was es war: das Gefühl drohenden Unheils. Beinahe war es ihr, als habe der Fürst etwas Dunkles mit auf die Lichtung gebracht, das er durch sein breites Lächeln zu verbergen suchte. Meleike fühlte sich seltsam schuldig bei diesem Gedanken. Sie war froh, dass der Meister, falls er ihre Angst erkennen konnte, sie als Empfindung anerkennen würde, die der Besonderheit des Moments geschuldet war. Seine verstörend hellen Augen blieben unangenehm lange auf ihrem Gesicht liegen. Doch sie hielt seinem Blick stand. Er war ihr Meister, sie durfte nicht an ihm zweifeln. Er führte sie, war ihr Kompass und Steuermann. Er war Ben-Di.
Ben-Di nahm den Platz in der Mitte der Lichtung ein, das große Gesicht der Menge zugewandt, die handzahme Gepardendame Kaia an seiner rechten Seite. Die Augen des Fürsten waren so gelb wie die Augen der Katze, zusammen leuchteten sie im Schein der Fackeln um die Wette. Meleike glaubte fast, die Spannung in ihrem Innern nicht mehr ertragen zu können, ganz so, als drohte etwas Wichtiges in ihrer Brust entzweizureißen, als er die Stimme erhob.
»Pekuu! Es ist so weit. Die nächste Generation von Adeva steht nun aufgereiht vor mir und erfüllt mich und uns alle mit großem Stolz. Ihr alle habt eure Söhne und Töchter großgezogen – und ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier stehen Adevas Kinder! Heute Nacht sollen sie Erwachsene werden. Nun wollen wir sehen, was das Schicksal für sie alle bereithält. Die Zeit ist nahe. Lasst uns beginnen!« Ben-Di breitete die Arme aus und trat ein paar Schritte zurück, bis er im Zentrum der großen Freifläche stand. Die Gepardin indes trottete an den Rand der Lichtung und ließ sich mit gelangweiltem Blick neben einem der Bäume nieder.
Meleike schluckte trocken. Nun begann es also. Sie trat nach vorne und stand bald an Ben-Dis rechter Seite. An seine linke Seite stellte sich der Waisenjunge Cyr, den Ben-Di in seinem Haus aufgezogen hatte wie einen eigenen Sohn. Er bedachte Meleike mit einem überheblichen Lächeln, doch sie versuchte so zu tun, als habe sie es gar nicht gesehen. Sie presste die Lippen aufeinander. Es war nicht zu ändern: Meleike konnte Cyr nicht ausstehen. Seine Selbstgefälligkeit und der berechnende Einsatz seiner traurigen Lebensgeschichte erbosten sie. Und in letzter Zeit schien er sich auch noch ausgerechnet ganz besonders für sie zu interessieren.
In der festgelegten Reihenfolge, der unverrückbaren Hierarchie von Adeva, folgten nun die anderen Fünfzehnjährigen. Es waren viele in diesem Jahr; der Kreis, der um den Fürsten herum als weiße Fläche zusammenfloss, war groß. Ein Zeichen dafür, dass es Adeva besser und besser ging. Endlich entdeckte Meleike in der Menge ihre beiden besten Freunde Amina und Aman, die sich verschüchtert wie kleine Kinder an den Händen hielten. Die Zwillinge trugen jene Angst im Gesicht, die Meleike im Herzen saß, und das brachte sie zum Lächeln. Sie brauchten sich keine Sorgen zu machen, dachte Meleike. Jeder in Adeva wusste, dass sie Telepathen würden. Zwillinge wurden beinahe immer Telepathen. Es kam auch vor, dass Jugendliche, die vor der Mantai ein Paar gewesen waren, zu Telepathen wurden, was nicht selten zum Ende der Beziehung führte und daraufhin zu unzähligen Schwierigkeiten. Denn gedanklich kommunizieren konnten die Telepathen ein Leben lang. Bei Amina und Aman würde es keine Probleme geben, die beiden waren ohnehin unzertrennlich.
Als schließlich alles bereit war, wurde um den äußeren Kreis der Jugendlichen herum eigens für diese Anlässe aufgespartes Benzin verschüttet und die Fackelträger setzten es in Flammen. Ein Ring aus Feuer loderte auf und umschloss die Mantaii mit bedrohlicher Hitze. In diesem Augenblick war Meleike sehr froh, im Innern des Kreises stehen zu dürfen. Wie mochte es wohl denen ergehen, die dem Feuer viel näher waren?
Um den Ring herum gruppierten sich die Familien. Ihr Getrappel steigerte sich, während das Summen zu Gesang wurde. Sofort erkannte Meleike die Stimme ihrer Mutter. Tirese hörte man immer heraus, weil sie am lautesten sang, sie konnte einfach nicht anders. Über Meleikes Gesicht huschte ein schiefes Grinsen. Ben-Di stand mit geschlossenen Augen da, die Arme gen Himmel gereckt. Alle anderen um Meleike herum hatten die Augen ebenfalls geschlossen und hielten ihre Handflächen nach oben. Hastig tat sie es ihnen gleich, von dem seltsamen Gefühl ergriffen, bereits jetzt schon alles verpasst zu haben. Doch kurz darauf merkte sie, wie es begann.
Aus dem Gesang wurde ein einziger Ton, und die Flammen loderten auf, als Wind heraufzog. Es war, als hielte der Wald Zwiesprache mit dem Feuer darüber, ob es die Pekuu segnen oder zerstören sollte. Meleike fühlte, wie sich ihr Herz so stark zusammenzog, dass sie zwischendurch dachte, es habe das Schlagen eingestellt. Seit vielen Augenblicken wagte sie bereits nicht mehr zu atmen. Still, ganz still hielt sie, um ihre Gabe empfangen zu können. Diesen Moment wollte sie nicht ruinieren. Sie spürte die Anwesenheit der Kräfte und war sich nun wieder ganz und gar sicher, dass sie bei ihrer Mantai nicht leer ausgehen würde.
Doch die Zweifel kehrten schon bald zu ihr zurück, als vereinzelt einige Mantaii begannen, scharf Luft durch die Zähne einzusaugen. Manche stießen auch spitze, kleine Schreie aus oder begannen zu lachen. Wie von ferne hörte Meleike noch immer die Stimme ihrer Mutter. Tirese warf sie ihr zu wie einen Anker, und die Tochter hielt sich daran fest, denn der Boden unter ihren Füßen hatte bedrohlich zu wanken begonnen.
Meleike musste keine Luft durch die Zähne ziehen, musste weder lachen noch schreien und fühlte jenseits der Aufregung und Spannung in sich selbst keinerlei Besonderheiten. Es tat sich überhaupt nichts. Bald musste es doch auch einmal zu ihr kommen. Immer mehr Stimmen jauchzten auf, Knie sanken auf den Waldboden und stellenweise flimmerte irres Kichern über die Lichtung. Meleike war drauf und dran, etwas zu rufen, doch was hätte das sein sollen? »Komm zu mir. Ich bin hier!«? Nein. Sie konnte nicht das Geringste tun und das war vielleicht das Schlimmste daran.
Schließlich erstarben die Flammen, der Wind legte sich, die Stimmen verstummten. Es war vorüber und augenblicklich wurde ihr übel. Kein Stück hatte sie sich verändert, das spürte sie genau. Noch immer dieselbe, alte, langweilige Meleike Mey. Sie wagte kaum, die Augen zu öffnen und sich umzublicken, wollte ihr Handgelenk nicht sehen, nicht feststellen müssen, dass sich auch dort nichts verändert hatte. Doch endlich schlug sie die Augen auf, da eine leise Hoffnung sie aufforderte nachzusehen. Sicherzugehen. Vielleicht fühlte jeder das Kommen der Gabe anders?
Eine ganze Weile starrte sie auf die Innenseite ihres braun gebrannten, aber auffällig unauffälligen Handgelenkes, als wollte sie es durch schieres Starren dazu bringen, eines der ersehnten Zeichen sichtbar zu machen. Aus dem Augenwinkel sah sie ihre Freunde, die sich am Erscheinen ihrer eigenen Zeichen erfreuten und diese aufgeregt Familie und Umstehenden zeigten. Nichts war geschehen – sie hatte es befürchtet. Als Meleike schließlich ihren Kopf hob, schaute sie direkt in Tireses besorgtes Gesicht. Hatte sie es kommen sehen? Scheinbar nicht.
Ben-Di trat an ihre Seite und blickte viel zu lange auf Meleike herab. Er fixierte sie mit einem Ausdruck, den sie nicht deuten konnte, jedoch war sie sicher, dass es nicht Mitleid war, was ihn füllte. Weder Tirese noch er sagten auch nur ein Wort zu ihr. Kein Trost, keine Verblüffung, keine Fragen. Verletzt und wie in Trance schlich Meleike an ihren Platz in der ersten Reihe zurück. Sie wagte es nicht, Ben-Di noch einmal anzusehen, dessen Augen sie eine weitere schmerzhaft lange Weile auf sich ruhen fühlte. Meleike glaubte, an der Demütigung zugrunde gehen zu müssen. Am liebsten wäre sie einfach davongerannt, doch es war ohnehin zu spät. Jeder hatte gesehen, dass sie nicht wie ungefähr ein Drittel der Mantaii dieser Nacht bei Ben-Di geblieben war. Alle wussten nun, dass sie ihrer Mutter nicht nachschlug, die Kunst ihrer Großmutter nicht weiterführen würde, weder vom Vater noch vom Großvater Talente erhalten hatte. Meleike Mey war nichts Besonderes. Sie war eine Kema.
Während die Gesegneten gefeiert wurden und vom Fürsten ihre offiziellen Plaketten bekamen zum Beweis dafür, dass sie keine Scharlatanerie betrieben, starrte sie leer auf einen Punkt. Koda flüsterte ihr etwas zu, doch sie beachtete ihn nicht. Sie versuchte, sich zu beruhigen und zu ermahnen, nicht allzu enttäuscht zu sein. Enttäuschung schickte sich nicht. Nichts empfangen zu haben sollte keine Demütigung für sie sein. Von klein auf hatte man ihr beigebracht, dass die Gabe ein Geschenk war, auf das es kein Anrecht gab. Und dass die Kema, die »Leeren«, wie manche sie heimlich nannten, ein wertvoller und der größere Teil ihrer Gesellschaft waren. Dennoch. Es kam ihr vor, als hätte sie eine Strafe erhalten, ohne zu wissen, was ihr Verbrechen war. Tatsächlich fühlte sie sich in jener Nacht so leer, als habe man ihr etwas weggenommen und nicht bloß nichts hinzugefügt.
Für einen normalen Pekuu war es keine Schande, Kema zu sein. Für eine Mey jedoch war es eine Katastrophe.
Sie blickte ihre Familie nicht mehr an; die Enttäuschung der anderen wollte sie sich nicht auch noch aufladen – es hätte sie erstickt. Und so trotteten die Meys schweigend und auf müden Füßen nach Hause. Keiner sagte ein Wort und das, obwohl es nun schon längst wieder erlaubt war, zu sprechen und angeregtes Gemurmel wie ein Summen über dem langen Strom der Pekuu lag, der gemächlich in die Stadt zurückfloss. Nur Mama Maela pfiff vergnügt vor sich hin. Meleike konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor so wütend auf sie gewesen zu sein.
Bald schon sollte sie sich dafür entsetzlich schämen.
Dort, wo er war, gab es kein Licht. Seit Tagen, seit Wochen gab es keines. Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren, doch brauchte er kein Licht, um zu sehen. Die Welt hatte keine Möglichkeit, sich seiner Fähigkeiten zu entziehen, da nützten die dicksten Mauern und die schwärzesten Nächte nicht das Geringste. Nichts blieb vor seinem Blick verborgen.
Er sah ganz deutlich, wie seine Mutter die Wärter zu bestechen versuchte, damit er bekam, was er brauchte. Warme Kleidung, Bücher, Schokolade, sein altes Kopfkissen. Familienfotos. Als hätte er Interesse daran. Als könnte er in dieser Schwärze Bücher lesen oder Bilder betrachten. Als hätte er ein Bett, auf das er sein Kissen legen könnte. Außerdem kam von all den Dingen sowieso nichts bei ihm an. Das Geld steckten die Männer heimlich ein; alles andere wurde verbrannt. Noch nicht einmal die Schokolade wollten sie essen, als sei alles, was mit ihm in Verbindung stand, verflucht und verdorben. Zu groß schien ihre Angst vor ihm. Alles, was sie für ihn übrig hatten, waren Abscheu und Spott. Aber sie misshandelten ihn nicht, weil er war, wer er war: der Sohn von Dr. Connor.
Doch das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass er nun erfuhr, wer Dr. Connor wirklich war – er sah es. Er sah, was sein Vater tat, wenn er arbeitete. Wie er anschließend seine Hände wusch und mit Kollegen plauderte, sich Essen in der Kantine holte. Die Abwesenheit seines Sohnes so mechanisch und steril ignorierend wie all das Grauen und Leid, das er selbst täglich verursachte. Und wie er allabendlich in einem kleinen Hörsaal des Sciencetowers stand und einer Handvoll Studenten sein grausiges Wissen vermittelte.
Der Junge musste begreifen, dass sein Vater schon immer diese Arbeit verrichtet hatte. Auch schon, als er noch klein gewesen war. Der Vater hatte ihn mit diesen Händen in den Schlaf gewiegt, seine Fußballspiele beklatscht, kleinere Sünden mit ihnen bestraft und an Sonntagen das Familienessen mit ihnen zubereitet. All die Jahre hindurch. Diese Hände bekam er nicht mehr aus seinem Kopf, denn er wusste jetzt, wozu sie fähig waren. Er hatte sie arbeiten sehen. Nun schämte er sich, denn er hatte es einfach nicht wissen wollen. Hatte all die Anzeichen verdrängt und war stolz auf seinen berühmten Vater gewesen, weil dieser von allen geachtet wurde. Weil Dr. Connor der Familie Reichtum und Ansehen beschert hatte. Er hatte zu seinem Vater aufgesehen, immer. Der Schmerz der Erkenntnis brachte ihn beinahe um den Verstand. Schlimmer noch als die dunkle Zelle, schlimmer noch als das Essen und die anderen Demütigungen, denen er ausgesetzt war. Die schreckliche und hell ausgeleuchtete Wahrheit der sterilen Operationstische ließ ihn nicht los, verfolgte ihn bis in seine Träume. Sie war überall.
Er sah aber auch, was sich außerhalb der Mauern seiner Zelle abspielte, wusste, dass er in einem Gefängnis saß und als einziger Gefangener nicht einmal eine halbe Stunde Ausgang bekam. Niemand durfte ihn sehen, keiner durfte von ihm erfahren. Das Licht in seiner Zelle war das Einzige, das niemals angeschaltet wurde. Auf persönliche Anweisung seines Vaters. Der Entzug von Licht war eine der schlimmsten Strafen in der Welt, in der er aufgewachsen war.
Gerüchte begannen schon durch die Mauern zu sickern. Jeder wusste: Etwas lauert hinter Zellentür 113, etwas so Monströses, dass selbst die härtesten Männer davor zurückschreckten. Er sah, dass die Köche Medikamente in sein Essen gaben und manchmal auch hineinspuckten. Deshalb rührte er es nicht an. Einzig das Brot, das sie ihm zu beinahe jeder Mahlzeit brachten, konnte er gefahrlos essen, doch es reichte bei Weitem nicht aus, um seinen noch im Wachstum befindlichen Körper zu versorgen.
Abend für Abend sah er seiner Mutter zu, wie sie in seinem Zimmer saß, sein Fußballtrikot auf dem Schoß, und weinte, während sein Vater sie dafür schlug. Doch Dr. Connor vermochte den Fluss der Tränen nicht zu stoppen, denn schließlich war er auch deren Quelle.
Der Junge selbst konnte sich nicht erklären, wie es geschehen war. Es war ebenso simpel wie grausam: Eines Tages war es einfach passiert. Das Zeichen war zu ihm gekommen, wie der Abend kam. Selbstverständlich und unaufgeregt. Erst langsam begann er zu begreifen, was man ihm antat und warum. Warum auf einmal sein gesamtes bisheriges Leben vorüber war und nichts wieder so würde, wie es einst war. Warm, sicher, zuverlässig und unbeschwert. Nur war er sich noch nicht im Klaren darüber, ob das, was er zurücklassen musste, eine Lüge war, oder das, was außerhalb der Zellenwände noch auf ihn wartete. Er hatte nichts verbrochen, nein, das nicht. Doch ein paar Wochen nach seinem fünfzehnten Geburtstag war an seinem Handgelenk ein kleiner blassbrauner Ring mit einem Punkt in der Mitte aufgetaucht, der sich nicht abwaschen ließ. Überhaupt schien es, als sei das Zeichen schon immer da gewesen, als sei es Teil seines Körpers, seiner selbst. Wie ein Muttermal oder seine dunklen Augenbrauen, die so ganz anders waren als die feinen, hellen Linien in den Gesichtern seiner Eltern.
Sein Vater hatte ihn nur wortlos angestarrt, als habe er absichtlich und spontan Giftzähne entwickelt. Beim gemeinsamen Abendessen hatte er nach der Schale mit den Erbsen greifen wollen und dabei war sein Hemd am Bund ein wenig zurückgerutscht. Das war der Augenblick, an dem Dr. Connor das Zeichen entdeckt hatte. Jegliche Liebe und Zuneigung war aus seinen Augen gewichen und blanker Hass war dem Jungen entgegengeschlagen, mit einer Wucht, von der er sich bis heute nicht erholt hatte. In der darauffolgenden Nacht hatte sein Vater ihn hierhergebracht. Ohne ein Wort zu sagen. Und war seitdem kein einziges Mal auch nur in die Nähe der Zellentür gekommen.
Was dort auf seinem Handgelenk erschienen war, bedeutete nichts Gutes, das hatte er begriffen. Doch das Ausmaß war ihm in jener Nacht noch nicht bewusst gewesen. Wahrscheinlich hatte schon sein Vater ihn unter Medikamente gesetzt, bevor er ihn herbrachte; erst später hatte er angefangen, das Essen zu verschmähen. Grund zu Misstrauen hatte er nie zuvor gehabt, die Stadt Lúm war sein Zuhause gewesen, ihre Bewohner seine Freunde, er hatte sich immer sicher und behütet gefühlt. Als einer von ihnen. Bis Flynn Victor Connor angefangen hatte zu sehen.
Die nächsten zwei Wochen sprach sie kaum mit jemandem. Der Schmerz hielt an und Meleike war in jenen Tagen eine unausstehliche Gesellschaft. Ihre Aufgaben verrichtete sie mit trotzigen Händen, während ihr Mund unablässig leise Flüche ausstieß. Alles war schlecht, öde und freudlos – kein Trost drang zu ihr durch. Obwohl Amina und Aman noch immer die Arbeit mit ihr teilten, kam es Meleike so vor, als sei der Boden nun schmutziger, die Glasscherben scharfkantiger und dieser Dienst ganz bewusst ihr zugeteilt, weil sie eine Kema war.
Was ihr besonders zusetzte, war, genau zu wissen, dass Amina und Aman ihre neu gewonnenen Fähigkeiten nutzen, um sich wortlos über sie auszutauschen, und Meleike bedachte die beiden nur mit wütenden Blicken, wenn einer von ihnen mit besorgter Miene Luft holte, um das heikle Thema anzuschneiden. Sie wollte nichts davon hören. Alles war ihr zu viel und zuwider. So starrte sie die meiste Zeit stumm vor sich hin, während ihre Hände sich mit wütender Beharrlichkeit durch den Schutt gruben.
Die Stadt Adeva lag in Trümmern. Keiner wusste, warum und wie es dazu gekommen war. Es schien fast so, als seien die Pekuu aus Trümmern geboren worden, seien aus ihnen hervorgekrochen wie Insekten, die sich durch geborstene Betonplatten winden. Meleike und ihre Freunde kannten ihre Stadt nicht anders, wussten aber doch, dass es nicht immer so gewesen sein konnte. Sie hatten eine Ahnung, dass ihre Welt kaputt war. Unzählige Maschinen standen herum, rosteten vor sich hin und vermittelten nur noch einen schwachen Eindruck davon, wozu sie einmal gut gewesen waren. Unter der Stadt bildeten kilometerlange Schächte in beachtlicher Tiefe ein gigantisches Tunnelsystem. Kletterte man weit genug hinab, so traf man auf Schienen und riesige Wagen aus Stahl, die einst dazu gedient haben mussten, Menschen von Ort zu Ort zu bringen. Doch auch sie standen still, denn in Adeva gab es kaum Zugang zu Strom. Ein paar Leute besaßen noch große Batterien oder Generatoren, diese wurden jedoch nur zu besonderen oder wichtigen Anlässen eingesetzt. Denn neue herstellen konnte niemand. So staubten in den Waggons die kühlen Polster der alten Sitze, die einst vielen Menschen Platz geboten hatten, müde vor sich hin, bis sich wieder einmal ein Pärchen vor den Blicken der Öffentlichkeit in den Tunneln zurückzog.
In einem anderen Teil der Stadt hatten Meleike und ihre Freunde vor einem knappen Jahr ein Haus entdeckt, über dessen Eingang in schmutzigen Buchstaben das Wort »Starlight Cinema« stand. Im Innern gab es einen dunklen Saal mit etlichen Reihen ausklappbarer Polsterstühle, die alle in eine Richtung zeigten, und dahinter einen kleinen Raum, in dem eine Maschine mit zwei großen Spulen stand. Auch lagen ein paar Metallrollen herum, auf die lange, transparente Bänder gewickelt waren, die, wenn man sie gegen das Licht hielt, Bilder von Menschen und Dingen zeigten, die es längst nicht mehr gab. Amina und Aman war der Ort sofort unheimlich gewesen, aber Meleike liebte ihn. In letzter Zeit sogar mehr als ihr eigenes Zuhause. Sie hatte all die Rollen, die sie finden konnte, zusammengetragen, behutsam gereinigt und unter den Holzdielen bei einem der Sitze versteckt. Diese Bilder waren ihr wertvollstes Geheimnis. Wenn sie nachdenken musste, schlich sie sich manchmal dorthin, nahm eines der langen Bänder und betrachtete die kleinen Fenster, die sich nach und nach veränderten, Bewegungen nachempfanden und ihr eine Wirklichkeit zeigten, die für die Pekuu längst verloren war. Manchmal fiel die Sonne günstig durch eines der Löcher im Dach und verlieh den Bildern eine unheimliche Lebendigkeit, brachte Farben zum Vorschein, die in Adeva selten zu sehen waren. Meleike stellte sich dann vor, dass sie sich selbst auf den Bildern befand, durch die sauberen Straßen spazierte und einer Arbeit nachging, die nicht darin bestand, Dinge aus dem Schutt zu klauben. Immer wenn sie das tat, überzog ein Schauer ihre Seele und sie fühlte, dass in Adeva etwas Schreckliches geschehen sein musste. Etwas, das für den Schutt verantwortlich war, für all die Schäden und die Geheimnisse, die ihre Stadt umgaben. Sie hätte nur allzu gerne gewusst, was.
Für die jungen Pekuu war Adeva, so wie es war, die einzige Welt, die sie kannten. Doch manche der Älteren erinnerten sich noch an eine ferne Vergangenheit, an ein »Davor« mit intakten Gebäuden und leuchtenden Farben. Ihre Erzählungen waren allerdings nicht mehr als Splitter dessen, was Adeva einst gewesen sein mochte. Wer immer den Alten zuhörte, verlor nach kurzer Zeit die Geduld, denn ihr Gerede war widersprüchlich und ergab meist recht wenig Sinn. Sie konnten keine Antworten geben und ihre Erinnerungen lagen in einem scheinbar undurchdringlichen Nebel. Vater Sabida hatte schon wiederholt versucht, durch Hypnose mehr Informationen aus ihnen hervorzulocken, doch es schien unmöglich, bis zum Kern der Erinnerungen vorzudringen. Es war das größte Rätsel, das die Pekuu kannten.
Viele von ihnen störten sich jedoch nicht weiter daran. Sie interessierten sich nur für die Gegenwart, aber Meleike selbst hatte es nie behagt, dass die Pekuu nicht genau wussten, woher sie kamen. Die Meys waren eine Seherfamilie, und Meleike wusste ganz genau, dass es ohne die Vergangenheit keine Gegenwart geben konnte. Dass Adeva seine Geschichte vor ihnen verbarg, machte ihr manchmal Angst. Als könnte die Stadt eines Tages vollständig über ihnen zusammenbrechen und alle Pekuu unter sich begraben. Die Oberfläche ihrer Welt kam Meleike in solchen Momenten rissig und morsch vor.
Nichtsdestotrotz liebte sie die Trümmerstadt. Sie gab den Pekuu die Härte und Identität, die sie brauchten. Adeva passte ideal zu ihnen. Die hohen Gebäude, die überall in den Himmel ragten, hatten oftmals keine Dächer, Fenster oder Außenmauern mehr. Auf den Straßen und Plätzen lag Geröll, jeder Schritt wirbelte Staub auf. Ätzenden, feinen Staub, der sich auf Haaren und Wimpern absetzte, was jedem Peku den Anschein von Reife und Weisheit verlieh, wenn der Tag zur Neige ging. Meleike wusste, dass es kein Paradies war. Aber Adeva war ihr Zuhause. Die Achse, um die sich ihr Leben, ihr ganzes Universum drehte und alles, was sie je gekannt hatte.
Seit sie arbeiten konnte, sammelte Meleike Scherben. Dabei hockte sie am Boden und pickte die kleinen Glasfragmente aus dem Geröll. Anschließend sortierte sie die Scherben nach Farben, damit man sie einschmelzen konnte. Nach und nach erhielten so die wichtigsten Gebäude von Adeva wie die Schulen, Gemeindezentren und Hospitäler Fensterscheiben – mal durchsichtige, mal grüne, manchmal auch braune. Hauptsache, der Wind pfiff nicht mehr durch die Löcher, denn im Winter konnte es in Adeva empfindlich kalt werden. Doch in der Zeit nach der Mantai lag Hitze über der Stadt, und die jüngeren Kinder rannten, nachdem sie ihre Pflichten erledigt hatten, zu einem der drei großen Strände und stürzten sich ins Wasser.
Der Sommer in Adeva war herrlich. Abends, wenn alle von der Arbeit kamen und die Kleineren vom Strand, setzten sich die meisten Pekuu einfach mit ihrem Essen auf die Straße. Es fand sich eigentlich immer jemand, der anfing, zu singen oder Geschichten zu erzählen, und die Menschen gingen jeden Abend zu spät ins Bett. So war es die Wochen seit der Mantai beinahe täglich gewesen. Jedermann in Adeva schien guter Dinge zu sein und das verdüsterte Meleikes Laune zusätzlich.
An einem Mittwoch, als sie Koda schon längst mit seinen Freunden am Weststrand vermutete, stand er ihr auf einmal in der Sonne.
»Was willst du?«, fragte Meleike barscher, als sie es beabsichtigt hatte. Sie verlagerte ihr Gewicht, sodass sie nun etwas gerader dasaß und mit abgeschirmten Augen in sein Gesicht blicken konnte. Er schien sich zu fragen, ob er nun beleidigt sein sollte oder nicht, denn seine dunklen Augenbrauen beschrieben eine scharfe S-Kurve, wie immer, wenn er angestrengt über etwas nachdachte. Dann lächelte er unsicher und sagte: »Mama Maela will dich sehen. Du sollst zu ihr kommen, sobald du kannst. Sie ist zu Hause!«
Meleike nickte und wischte sich mit dem Handrücken Staub von der Stirn. »Weißt du, warum?«
Koda schüttelte den Kopf. Meleike seufzte. Sie hatte bereits seit einiger Zeit geahnt, dass Mama Maela mit ihr über die Mantai würde sprechen wollen, und war erstaunt gewesen, dass sie nicht schon früher nach ihr geschickt hatte. Einerseits war sie froh, einen Vorwand zu haben, die Arbeit für heute ruhen lassen zu können, doch andererseits hatte sie noch weniger Lust, über die Mantai zu sprechen. Doch sie hatte keine Wahl. Maela war das Oberhaupt der Familie, und Meleike musste tun, was von ihr verlangt wurde. Geistesabwesend strich sie ihrem Bruder über die staubigen Locken. »Ich mach mich auf den Weg. Sag Tirese Bescheid, wenn du nach Hause kommst.« Koda zuckte die Schultern. »Wie du meinst!« Dann trottete er zu seinen Freunden zurück, die in einigem Abstand zu Meleike an eine Hauswand gelehnt auf ihn warteten und tuschelnd zu ihr herüberstarrten. Meleike bedachte die Jungen mit einem grimmigen Blick und sie trollten sich.
Langsam, beinahe mechanisch richtete sie sich nun zu voller Größe auf. Ihre Beine waren ungewöhnlich lang, und der Rest ihres Körpers hatte offensichtlich Mühe, mit dem Wachsen hinterherzukommen. Es schien ihr jedes Mal, als müsse sie sich behutsam auseinanderfalten, damit nichts an ihr reißen oder entzweibrechen konnte. Sie klopfte sich den Staub aus der Kleidung und schlenderte zu Amina und Aman hinüber. Ohne die Freunde anzublicken, sagte sie: »Mama Maela ruft mich, ich muss gehen.«
»Hast du es gut! Grüß sie von uns!«, erwiderte Aman. Meleike nickte knapp und ging weiter zu ihrem Aufseher, um sich abzumelden. Dann trat sie den Weg zu Mama Maela an.
Maelas Haus war mit Abstand das höchste in dem Viertel, in dem Meleike mit ihrer Familie lebte. Einst musste es hauptsächlich aus Glas bestanden haben, denn die Löcher in den Mauern waren riesig und hatten scharfe Kanten. Es glich eher einem Gerüst als einem Haus und Mama Maela wohnte ganz oben.
Meleike stöhnte, als sie die Treppen zum achtzehnten Stock hinaufging. Sie wunderte sich jedes Mal, warum Maela ausgerechnet hier leben musste, wo sie doch überall Wohnung hätte nehmen können. Doch Meleike wusste auch, dass der Blick, der sich von Maelas Zuhause aus über Adeva und das Meer bot, traumhaft war.
Als sie endlich oben angekommen war, verharrte sie noch einen Augenblick vor der Tür. Eigentlich verspürte sie keine rechte Lust hineinzugehen. Ihr Herz klopfte schnell, und Meleike fragte sich, ob das nun dem langen Aufstieg oder ihrer Nervosität geschuldet war. Noch einmal holte sie tief Luft und versuchte, ihren Herzschlag zu bändigen. Dann vernahm sie durch das schwere Holz der Tür die Stimme ihrer Großmutter: »Steh nicht da wie ein Esel, Meleike! Komm herein!«
Kopfschüttelnd drückte das Mädchen die Tür auf und trat in gleißendes Sonnenlicht.
Maelas Zuhause war in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Eigentlich war es nur ein Plateau mit mehreren in die Höhe ragenden Säulen, die wohl einst das Dach getragen hatten, das schon seit vielen Jahren fehlte. Auch Wände hatte Maelas Heimstatt kaum, teilweise deuteten hüfthohe Brüstungen vermeintliche Sicherheit an, aber an zwei Seiten konnte ein unbedachter Schritt in die Leere und den Tod führen. Yaris hatte Maela für die Regenzeiten und den Winter kleine, boxenartige Räume auf die Fläche gebaut, in denen Küche, Badezimmer und eine Schlafgelegenheit untergebracht waren. Maelas Regale waren überdacht. Ansonsten lagen viele Kissen auf dem Boden verstreut, zwischen ihnen standen vereinzelt niedrige Tische. Leinen spannten sich kreuz und quer von Säule zu Säule, an manchen hingen Wäschestücke, an anderen Bilder, Blätter, vereinzelt auch etwas zu essen oder eine Reihe toter Ratten. Die alte Frau besaß eine beachtliche Anzahl großer Schlangen, die bei Laune und Futter gehalten werden wollten. Aber auch für die Pekuu selbst waren Ratten einer der Hauptnahrungslieferanten. Sie schmeckten besser als Schaben, waren aber auch deutlich schwerer zu jagen. Doch Maela verstand sich hervorragend darauf. In einer ganzen Reihe großer Käfige zwitscherten von allen Seiten auch viele bunte Vögel, die sie eigenhändig gefangen hatte.
Die Großmutter selbst stand mit verschränkten Armen lächelnd inmitten ihres Reiches, als Meleike eintrat. Sie trug ein langes schwarzes Kleid und hatte sich ein hellgrünes Tuch um den Kopf gewickelt. An ihren Fingern glitzerte eine absurde Anzahl dicker goldener Ringe. Als das Mädchen auf sie zuging, öffnete die alte Frau ihre dünnen Arme und drückte sie fest an sich.
»Ela«, sagte Meleike, noch immer etwas außer Puste, »warum kannst du nicht weiter unten leben, so wie alle anderen auch?« Maela hielt ihre Enkeltochter mit ausgestreckten Armen von sich und grinste. »Weil ›alle anderen‹ für mich kein Maßstab sind. Außerdem bin ich eine Seherin, meine Kleine, ich muss sehen können.« Dann zog sie an Meleikes Hand und lotste sie zu einem Stapel Kissen, wo die beiden sich nebeneinander niederließen. Auf einem niedrigen Tischchen zwischen ihnen stand in zwei Tassen dampfender Tee bereit.
»Tee?« Meleike runzelte die Stirn. »Ausgerechnet? Ela, es ist so heiß, dass ich gar nicht weiß, was ich noch alles ausziehen soll!« Bei diesen Worten zupfte Meleike an ihren kurzen Shorts. Maela zog die Stirn in Falten und blickte dabei drein, als sei ihr die Hitze gerade erst aufgefallen. Dann antwortete sie: »Du kannst ihn ja ein bisschen stehen lassen. Alles hat seine Zeit, auch der Tee. Ich habe dich ohnehin nicht hierherbestellt, um Tee mit dir zu trinken.«
Meleike wusste das, doch sie wollte nicht reden. Darum nahm sie die große Tasse mit der heißen Flüssigkeit zwischen ihre Hände und pustete mit abwesender Miene hinein. Den Blick wandte sie zum Meer hinaus. Es lag blau und still am Strand, als hielte es die Luft an.
Maela ließ ihre Enkeltochter noch eine Weile schweigen, bis sie zu sprechen begann. »Meleike, ich weiß, dass du enttäuscht bist.«
Meleike setzte ein gequältes Gesicht auf. Sie hatte zwar damit gerechnet, aber dennoch hatte sie nicht die geringste Lust, sich jetzt und hier mit ihrer Mantai zu befassen. Sie wollte lieber mit Mama Maela auf das Meer hinausblicken, sich über alles andere Gedanken machen und wenn es sein musste, sogar heißen Tee dazu trinken. Konnte es den anderen Pekuu nicht einfach egal sein, wie sie sich fühlte? Musste sie unbedingt über die größte Demütigung ihres bisherigen Lebens sprechen? Etwas weinerlich entgegnete Meleike: »Ela, ich will nicht darüber reden!«
Mama Maela griff über den Tisch hinweg nach Meleikes Hand und sah ihr direkt in die Augen. »Doch, mein Mädchen. Du wirst darüber sprechen. Jetzt. Mit mir!« Meleike nickte stumm. Etwas in Maelas Blick hatte ihr einen Stich versetzt und brachte ihr Herz ins Wanken. Ihre Großmutter würde keinerlei Widerworte dulden. In den schwarzen Augen der alten Frau lag eine Traurigkeit, die älter war als alles, was Meleike kannte. Sie wunderte sich, dass es ihr nicht gleich bei der Begrüßung aufgefallen war. Normalerweise blickten diese Augen lebhaft und fröhlich in alles hinein und durch alles hindurch. Nun schienen sie ihre gewohnte Neugier verloren zu haben. Ihr Ausdruck änderte sich auch dann nicht, als Maela mit leiser Stimme wieder zu sprechen begann.
»Meleike. Die Gabe, die für dich bestimmt ist, konnte dir die Mantai nicht geben.« Meleike holte scharf Luft, sagte aber nichts.
»Für dich ist ein anderer Weg vorgesehen, mein Schatz«, fuhr Maela mit sanfter Stimme fort. »Ein schwerer, ein schrecklicher Weg. Ich habe versucht, dein Schicksal von dir fernzuhalten. Ich habe versucht, den Lauf der Dinge zu ändern, doch nun weiß ich, dass ich das nicht kann. Aber du kannst es. Und du musst.« Unbehagen kroch Meleikes Kehle hoch. Diese Worte waren nicht das, was sie erwartet hatte, und Angst begann sich in ihr breitzumachen. Das Gefühl drohenden Unheils zog ihr zum ersten Mal seit der Mantai wieder durch die Glieder und sie fühlte Tränen in die Augen steigen. Solche Dinge wollte sie nicht hören. Plötzlich wünschte sie sich mit aller Macht, wieder Kind zu sein, behütet und geborgen, vor solchen Worten geschützt und abgeschirmt. Ihr Vater fehlte ihr in diesem Augenblick mehr, als sie in Worte fassen konnte. Sein Verschwinden schien mit einem Mal wieder näher an das Jetzt und Hier gerückt, als hätte Maela mit dem Gesagten die alten Wunden wieder aufgetrennt. Mit den Messern ihrer Worte. Meleike wurde von Panik ergriffen. Sie konnte kaum atmen.
Mit ruhiger und ungewöhnlich tiefer Stimme sprach Maela weiter. »Es gibt Dinge, die du sehen wirst und besser nie gesehen hättest. Es gibt Dinge, die du erdulden wirst und besser nie erduldet hättest, und es gibt Dinge, die du tun wirst und niemals hättest tun sollen.« Maela hielt inne und schaute mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen zum Himmel hinauf, an dem sich keine einzige Wolke zeigte. Dann senkte sie den Kopf und blickte ihrer Enkeltochter direkt in die Augen. Meleike fühlte, wie die schwarzen Augen sie banden. Sie konnte nirgendwo anders mehr hinsehen. »Vergiss niemals, dass du eine Mey bist und Tochter deines Vaters. Vergiss nie, dass es Menschen gibt, die ein gutes Herz haben, und Dinge, die gut und richtig sind auf der Welt. Denke immer an deinen Bruder und deine Freunde in dieser Stadt. Vergiss nichts von alledem, von deinem Leben und von uns. Erinnerung ist das Wichtigste. Versprich es mir!«
Meleike saß da wie versteinert. Sie wollte nichts versprechen. Nichts sagen oder hören, das nach Abschied klang. Sie wollte Maela packen und schütteln, sie dazu bringen, mit dem Unsinn aufzuhören und wieder ganz normal mit ihr zu sprechen, vielleicht ein paar weise und salbungsvolle Worte zu ihrer Mantai zu sagen oder einfach nur mit den Vögeln zu singen. Alles, alles wäre Meleike in diesem Augenblick recht gewesen. Doch das grässliche Gefühl hatte sich zu einem Knoten verdichtet, der alles abschnürte, was hell und gut war. Nicht ein Wort hätte sie über die Lippen gebracht, deshalb nickte sie nur. Und Maelas Gesicht schien einen Ausdruck erleichterter Entspannung anzunehmen.
Auf einmal umschlossen die dünnen Finger der alten Hand den Schaft eines blitzenden, langen Messers. Meleike wusste nicht, wo Maela es so plötzlich hergenommen hatte. Noch bevor sie etwas äußern konnte, sagte die alte Frau: »Ich wünschte so sehr, es wäre anders, Meleike. Aber ich muss das tun.«
Meleike verstand kein Wort, doch sie begann am ganzen Leib zu zittern. Ihr Herz schien schneller als ihr Kopf zu begreifen, dass etwas im Gange war, das sie nicht unter Kontrolle hatte. Mit wachsendem Entsetzen sah sie zu, wie Maela sich beide Handflächen diagonal und ohne Zögern aufschnitt. Blut rann ihr über die Handgelenke und tropfte auf die Kissen. Maela murmelte etwas, das Meleike nicht verstand, dann legte sie ihr die Hände an die Schläfen.
Es war, als habe Meleike ein Stromschlag getroffen, als habe ein Blitz ihr Hirn durchzuckt. Ein spitzer Schrei entschlüpfte ihrer Kehle, und beinahe war ihr, als müsste sie zu kichern anfangen. In ihrem Bauch schien sich alles zu drehen. Sie schloss unwillkürlich die Augen, doch zu ihrer größten Verwunderung verschwand die Wohnung nicht. Vielmehr sah sie, mit einer Klarheit und Schärfe, die sie von Träumen und Erinnerungen nicht kannte, den Tisch, die Kissen und die Weite der Stadt. Nur saß Mama Maela nicht mehr neben ihr, sondern stand direkt an einer der offenen Flanken der Plattform, an der keine Brüstung sie vom Abgrund trennte. Meleike wollte aufspringen, um sie von dort wegzuziehen, da hörte sie Maelas Stimme wie von ferne. »Es tut mir leid!«
Im nächsten Augenblick war sie fort. Hatte einen Schritt zur Seite getan und sich der Leere übergeben. Fiel. Unzählige Meter tief. Meleike schrie, diesmal vor Entsetzen.
Als sie ihr eigenes Schreien hörte, wurde ihr allmählich bewusst, dass noch immer Maelas Hände auf ihrem Kopf lagen, dass Maelas warmes Blut ihre Wangen hinabrann. Als Meleike ihre Augen wieder öffnete, saß die Großmutter noch immer an ihrer Seite, sah sie voller Zuneigung an und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.
Meleike war erleichtert und wie benommen. Was war da gerade vor sich gegangen? Warum hatte sie gesehen, was nicht geschehen war?
Noch während sie versuchte einzuordnen, was ihr widerfahren war, war Mama Maela aufgestanden. Sie stand nun, zu Meleikes grenzenlosem Entsetzen, genau dort, wo sie sie eben noch in ihrem Kopf hatte abstürzen sehen. Meleike dämmerte, was Maela mit ihren Händen getan, was sie ihr gegeben hatte. Das konnte nicht wahr sein. Es durfte nicht.
»Nein!«, schrie Meleike und rappelte sich hoch. »Nein!!!« Auf unsicheren Füßen stolperte sie durch den Raum und versuchte, nach der Großmutter zu greifen, doch Meleike konnte sie nicht mehr erreichen. Es war zu spät.
Maela wandte ihrer Enkeltochter das Gesicht zu, auf dem nun ein ruhiger und fest entschlossener Ausdruck lag. Es gab nichts mehr, was Meleike noch ändern konnte, doch sie schrie einfach weiter. »Es tut mir leid!«, sagte Mama Maela. Dann ließ sie sich fallen.
Dr. Connor hatte beschlossen, seinen Sohn zu operieren. Flynn hatte gestern Abend gesehen, wie sein Vater sich mit einem Kollegen darüber unterhalten hatte. Sie wollten es aus ihm herausschneiden, wie man einen Tumor herausschnitt. Doch Flynn wusste genau, dass das, wovor sie Angst hatten, nichts war, was man herausschneiden konnte. Und sie mussten es auch wissen, schließlich hatten sie es lange genug versucht. Doch für seinen Vater war es eine Frage der Ehre, die größte Herausforderung und der traurige Höhepunkt seiner widerlichen Karriere.
Dr. Connor wollte mit aller Macht beweisen, dass seine Arbeit nicht umsonst gewesen war, seine Theorien tragfähig und seine Welt in Ordnung. Er wollte es an seinem eigenen Sohn beweisen.
Diesem Wahnsinn war nicht mehr zu entkommen. Flynn schwebte in größter Gefahr, und er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit ihm noch bleiben würde. Doch die Tatsache, dass man ihn aus dieser Zelle würde herausholen, die Tür für ihn würde öffnen müssen, mischte Aufregung und Hoffnung unter seine Angst. Sie würden ihn zu seinem Vater bringen müssen, durch die Stadt zum Sciencetower. Es war vielleicht seine einzige Chance zu entkommen. Natürlich, das wusste er auch, war seine Flucht zum Scheitern verurteilt, aber er hatte nicht vor, sich widerstandslos von den schrecklichen Händen seines Vaters zerstören zu lassen. Er musste es versuchen.
Seit Tagen oder Wochen hatte er kaum Bewegung gehabt, das würde er nun dringend ändern müssen. Wenn sie kamen, wollte er bereit sein. In der mittlerweile vertrauten Schwärze des kleinen Raumes begann er, auf und ab zu gehen und Liegestützen zu machen. Langsam und leise zählte er in der Dunkelheit.
Es durfte nicht wahr sein, alles, alles nur das nicht! Meleike rannte, sie flog beinahe die Stufen hinab. Es schienen immer mehr zu werden. In rasendem Lauf fiel sie, schlug sich die Knie auf und stieß sich die Knöchel an, ohne darauf zu achten. Ela, ihre Großmutter, lag dort unten auf der Straße. Tot. Und Meleike fehlte jegliche Erklärung, warum sie sich hinabgestürzt hatte.
Als sie endlich auf die Straße stolperte, hatte sich bereits eine Traube von Menschen um den leblosen Körper versammelt. Meleike schob sich durch die Menge, und als die Leute erkannten, wer sie war, traten sie zur Seite und ließen sie vorbei. Meleike hörte, wie sie bei ihrem Anblick hinter vorgehaltenen Händen zu tuscheln begannen. Bald schon würden sich Gerüchte über die Stadt verbreiten. Gerüchte über Meleikes blutverschmiertes Gesicht und Maelas Todessprung. Doch Meleike konnte ihnen nichts entgegenhalten. In diesem Augenblick wollte sie das auch gar nicht. Es war ihr vollkommen gleich, was die Leute dachten.
Verzweifelt kniete sie neben Mama Maela auf dem staubigen Boden nieder und nahm deren rechte Hand. Als die Umstehenden die Schnitte auf den Handflächen der Seherin wahrnahmen, ging ein Raunen durch die Menge.
Sie wussten nun, was sich auf dem Dach des Hauses zugetragen hatte. Etwas, das sie nur aus Legenden kannten. Etwas, von dem die meisten Pekuu nicht geglaubt hatten, dass es tatsächlich möglich war. Und etwas, zu dem kein anderer Einwohner Adevas jemals den Mut gehabt hätte. Keiner. Nur Mama Maela.
Aus dem Schnitt in der Hand, die wie ein kleiner, toter Vogel in Meleikes eigener lag, sickerte ein wenig Blut. Die Finger waren noch warm und fühlten sich doch so seltsam an unter den ihren. Es war deutlich zu spüren, dass das Leben aus ihnen gewichen war. Ein Gefühl, das kaum zu erklären war. Alles war an seinem Platz, die Haut hatte noch immer dieselbe Farbe – und dennoch. Etwas war verrutscht, gewichen. Hatte sich davongemacht.
Meleike war starr vor Kummer, sie konnte nicht einmal weinen. Ihr Herz hatte noch nicht erfasst, was in den letzten Minuten alles geschehen war. Doch Schuldgefühle begannen bereits, Besitz von ihr zu ergreifen. Die Welt schien um sie herum zu toben und doch drang kein Laut an ihre Ohren, nahmen ihre Augen keinerlei Bewegungen wahr. Sie sah nur den Boden und eine reglose Mama Maela. Ein flüchtiger Blick in das Gesicht der alten Frau zeigte Meleike, dass ein amüsiertes Lächeln auf deren Lippen lag, doch das Bild des unnatürlich eingedrückten Kopfes konnte sie nicht lange ertragen.
Nach einigen Minuten hörte sie eine bekannte Stimme nach ihr rufen. Tief, weich und fordernd, war es die einzige Stimme, die zu ihr vordringen konnte in diesem Augenblick. Tirese war auf dem Weg.
Ihre Mutter bahnte sich einen Weg durch die Menge und Meleike stürzte sich hastig in ihre Arme.
Doch als ihre Hände Tireses weiche Haut fanden, durchzuckte ein leuchtend heller Blitz ihren Kopf.
Sie sah ihre Mutter deutlich vor sich. Wieder war es nicht die Realität, die sich vor ihren Augen abspielte, sondern etwas anderes. Eine Realität, die hinter ihrer Stirn zu liegen schien. Nicht wie ein Traum, sondern wie eine andere Version der Wirklichkeit.
Meleikes zweite Vision war nicht weniger schrecklich als die vorangegangene. Ihre Mutter stand mit bloßen Füßen auf der Straße vor ihrem Haus. Und Adeva brannte.
Tirese rief etwas. Um sie herum liefen unzählige Pekuu schreiend durcheinander. Vom Himmel schien es Feuer zu regnen. In dicken, geschwungenen Bögen fiel es mit unerbittlicher Eleganz auf die Stadt herab. Mit einem Mal stand Tirese von Kopf bis Fuß in Flammen. Ihre Augen loderten auf vor Angst und bald schon erfasste das regnende Feuer ihre Gestalt und warf sie zu Boden. Ein dumpfes Dröhnen legte sich über die gesamte Stadt.
Ruckartig löste sich Meleike aus der Umarmung ihrer Mutter, die sie verwundert anblickte. Dann erst begann Tirese, die gesamte Situation zu erfassen, und ihr Blick verhärtete sich. Er wanderte von dem Körper ihrer toten Mutter über deren Hände, Meleikes blutverschmiertes Gesicht bis zu den Handgelenken ihrer Tochter. Jetzt erst sah auch Meleike selbst auf ihre Arme herunter. Die Innenseite ihres rechten Handgelenks wies einen dunklen Ring auf, in dessen Mitte ein Punkt ruhte. Meleike stockte der Atem. Der Ring war das Zeichen der Seher. Er saß dort so selbstverständlich, als habe er schon immer zu ihr gehört. Doch auf den Punkt in der Mitte konnte sie sich keinen Reim machen. Selbst Mama Maela hatte keinen solchen Punkt getragen. Sie hielt ihrer Mutter wortlos den Arm entgegen. Vielleicht würde sie von ihr eine Erklärung erhalten oder zumindest tröstende Worte. Doch Tireses Mine war reglos.
»Nun hast du, was du wolltest«, zischte sie mit kalter Stimme und Meleike blieb in diesem Augenblick das Herz stehen vor Einsamkeit. Sie wich ein paar Schritte zurück. Instinktiv wollte sie nach ihrer Mutter greifen, wollte ihr ein Lächeln abzwingen, ein Zeichen, dass sie geliebt wurde, doch es war zwecklos. Tireses Worte hatten eine Mauer zwischen Mutter und Tochter gesetzt, die zwar unsichtbar, aber nicht weniger massiv war als Mauern aus Stein. Tirese Mey war nun neben Maela auf den staubigen Boden gesunken und hatte ihren Kopf auf deren Brust gebettet. Meleikes stolze Mutter schluchzte bitterlich, und zwischendurch flüsterte sie immer wieder: »Was hast du getan? Was hast du getan?« Doch die Antwort auf diese Frage kannte Tirese längst.
Irgendjemand hatte Ben-Di informiert. Mit Cyr an seiner Seite stand er auf einmal hinter Meleike und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Diese zuckte zurück, in Erwartung, schon wieder eine Vision ertragen zu müssen, doch nichts dergleichen geschah. Ben-Di hingegen ergriff blitzschnell Meleikes Handgelenk und betrachtete mit hochgezogenen Augenbrauen das Zeichen. Dann ließ er ihre Hand fallen, als sei diese nichts weiter als eine magere tote Ratte.
Anschließend kniete Ben-Di neben Tirese nieder und ließ Meleike mit Cyr zurück. Mit gerunzelter Stirn beobachtete Meleike ihre Mutter und den Fürsten. Wie er sie ansah und ihr einen Arm um die Schultern legte – wie sie sich an seiner Brust auszuweinen begann. Die großen Hände des Fürsten hielten die zierliche, dunkelhaarige Frau so vorsichtig, als sei sie ein Schmetterling, der leicht zerdrückt werden konnte. Als bestünde Tirese Mey aus nicht viel mehr als dünnem Papier und Abendwind. Plötzlich schoss Meleike ein schmerzhafter Gedanke durch den Kopf: Die beiden sahen aus wie ein Liebespaar. Sie fühlte sich einsam und betrogen.
»So«, hörte sie Cyr auf einmal sagen. Sie wandte sich zu ihm und sah, dass seine Lippen sich spöttisch über dem Kinn kräuselten, wie magere Würmer. »Dann bist du jetzt also die größte Seherin von Adeva!«
Meleike wich vor ihm zurück. Seine Worte trafen sie hart, als schlüge er ihr direkt ins Gesicht. Der amüsierte Unterton in seiner Stimme machte es noch schlimmer. Denn auch wenn ihr Kopf es noch zu leugnen suchte, wusste ihr Herz längst, dass er die Wahrheit sagte. Wahrscheinlich war sie nun die größte Seherin von Adeva. Maela hatte ihr die Kräfte übertragen, die sie ein ganzes Leben lang ausgemacht hatten. Und sie war dafür in den Tod gegangen. Bald würde es in dieser riesigen Stadt kaum mehr einen Menschen geben, der nicht darüber Bescheid wusste. Mehr als je zuvor würde Meleike von nun an eine Gezeichnete sein. Denn Kema gab es viele in dieser Stadt, das war nichts weiter Besonderes, auch wenn es in Bezug auf Meleike immerhin für eine gute Geschichte gereicht hatte. Aber die Erbin von Mama Maela zu sein, das war etwas Einzigartiges und würde Meleike für immer außerhalb der Gesellschaft stellen, das wusste sie genau. Nicht umsonst hatte Mama Maela in einem verlassenen Haus hoch oben über der Stadt gewohnt. Achtung und Verehrung waren nicht zu verwechseln mit guter Nachbarschaft oder gar Freundschaft. Wahrscheinlich würde nun auch von ihr erwartet, dass sie in all ihrem Handeln in Mama Maelas Fußstapfen trat. Dass sie von nun an die gleiche Arbeit tat, die Maela immer verrichtet hatte, und für die Leute genau die Lücke füllte, die ihre Großmutter hinterlassen hatte. Nur damit wären sie zufrieden.
Für die Pekuu wäre es dann fast so, als sei nichts geschehen. Eine gute Geschichte, nicht mehr und nicht weniger. Was das für ihre Zukunft bedeutete, konnte Meleike sich nicht im Entferntesten vorstellen. Alles, was sie in den vergangenen Minuten (oder waren es Stunden?) vor ihrem inneren Auge gesehen hatte, war Tod und Verderben. Ein grausames Einmaleins des Sterbens zweier Menschen, die sie liebte. Mit einer bewiesenen Trefferquote von immerhin fünfzig Prozent. Doch konnte sie das niemandem sagen, der Rat und Hilfe von ihr erwartete. Was, wenn sie nicht in der Lage war, irgendetwas anderes vorherzusehen? Und ein noch schrecklicherer Gedanke brach sich Bahn in ihrem Kopf: Was, wenn auch ihre zweite Vision zutraf?
Sie fühlte, wie sich eine traurige und nagende Unruhe in ihr breitmachte. Die ganze Situation zehrte von Sekunde zu Sekunde mehr an ihr, drang in sie ein, saugte sie aus und zog sie nach unten. Der Gedanke, dass sie diesen Ort ebenso gut verlassen konnte anstatt zu bleiben, kam ihr verhältnismäßig spät. Doch dann ließ sie Cyr stehen, wo er stand, und rannte davon.
Das rhythmische Klopfen ihrer Füße auf dem staubigen Stadtboden war ein gutes Geräusch. Es gab diesem Tag, der sich nun dem Ende zuneigte, einen Takt. Wie hektische Schläge auf eine Trommel, die alle dazu aufrief, ihre Häuser zu verlassen und in den Kellern unter der Stadt Zuflucht zu suchen, da sich großes Unheil über Adeva zusammenbraute. Feuer, das vom Himmel fiel. Die Staubwolken, die Meleikes Füße beim Laufen aufwirbelten, hüllten sie beinahe vollständig ein. Nach einigen Minuten fiel ihr auf, dass sie nicht wusste, wohin sie laufen sollte. Meleike rannte ohne Plan und Ziel.
Nach Hause wollte sie nicht, es kam ihr unsinnig vor, in ihre alltägliche Umgebung zurückzukehren, als sei nichts gewesen. Sich vielleicht auf ihr Bett zu werfen und die immer gleichen Wände anzustarren, als könnte sie ihnen Antworten abtrotzen. Wahrscheinlich würde sie jeden Gegenstand im Haus anschreien, als Strafe dafür, dass er keinerlei Trost für sie bereithielt. Außerdem hatte sie zwar Angst davor, alleine zu sein, aber auch Angst, dass Tirese nach Hause kam und sie sich ihrer Mutter stellen musste. Für die betroffenen Gesichter ihrer Freunde hatte Meleike auch keine Kraft. Sie erinnerte sich nur allzu gut an die Blicke damals, das Flüstern und die flüchtigen Handbewegungen der anderen, Freunde und Mitschüler, als klar wurde, dass Yaris Mey wohl nie wieder aus dem großen Wald nach Hause zurückkehren würde. Das Mitleid der anderen gepaart mit der grenzenlosen Erleichterung, nicht selbst an Meleikes Stelle zu sein, hatte sie beinahe erstickt. Sie hasste Mitleid, sie brauchte es nicht. Doch wünschte sie sich manchmal, jemand wäre in der Lage und bereit, ihre Wut mit ihr zu teilen.
Nachdem sie weiter ziellos durch ihr Viertel gerannt war, verlangsamte sie den Schritt. Ihre Beine hatten sich müde gelaufen und die Bewegung hatte die Wirkung des Schocks ein wenig gemildert. Beinahe fühlte es sich an, als tropften der Schrecken und die geistige Lähmung milliliterweise aus ihr heraus. Sie wusste nun, wohin sie gehen wollte.