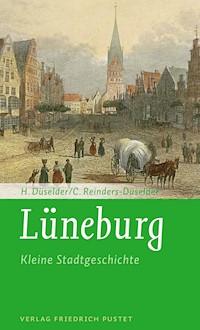
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
Lüneburg mit seinen pittoresken Straßenzügen und Plätzen, mit imposanten mittelalterlichen Kirchen, einem reich ausgestatteten Renaissance-Rathaus und allerorten anzutreffenden Bürger- und Handelshäusern vergegenwärtigt selbstbewusst seine Geschichte als Hansestadt. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts gegründet, durch Salzhandel zu Reichtum gelangt, existiert Lüneburg als weitgehend autonome Bürgerstadt, die die Tugenden einer guten und gerechten Regierung im Sinne römischer Patrizier zur Geltung bringt. Anschaulich und unterhaltsam führt der Gang durch die Jahrhunderte und berichtet von den Anfängen der Stadt, den ersten Siedlungskernen auf einem geologisch spannenden Terrain bis in die Gegenwart. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die Geschichte gestalten und Geschichten erleben und die Stadt im Wandel der Epochen zeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike DüselderChristoph Reinders-Düselder
Lüneburg
Kleine Stadtgeschichte
UMSCHLAGMOTIVE
vorne: Der Platz Am Sande von Westen. – Kolorierter Stahlstich von Emil Höfer nach Carl Alexander Lill, 1843 (Sammlung Museum Lüneburg); hinten: Blick auf den Stint – ein beliebter Platz zum Verweilen. – Fotografie (Adobe; hungry_herbivore).
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATION DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3311-1
Reihen-/Umschlaggestaltung und Layout: www.martinveicht.de
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2022
eISBN 978-3-7917-6213-5 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unter www.verlag-pustet.de
Inhalt
Vorwort
Charakter der Stadt
1371 – Von der Residenz- zur Bürgerstadt / Salzstadt auf unsicherem Boden / Stadt und Landesherrschaft / Von der Garnisons- zur Universitätsstadt
Topografie der Stadt
Die mittelalterlichen Quartiere – Bis heute erhalten / Der »ALA« – Verantwortung in Bürgerhand / Die Stadt im Bild / Lüneburg – eine »Idealstadt«? / Die wachsende Stadt / Kasernen und Soldaten / Bewegung im Untergrund
Menschen in der Stadt
Königlicher Unmut in Hannover / Von der mittelalterlichen Großstadt zur Stadt in der Krise / Stadtmauern fallen / Zeiten der Not – Krieg und Nachkriegszeit / Stagnation – Radikalisierung – Militarisierung / Auf Straßen geworfen – Das »Babylon an der Ilmenau« / Aufbruch und Vision – Urbane Modernität im Zeitgeist der 1970er Jahre / Bunt-belebte Wohnquartiere statt grauer Kasernen / Lüneburg als »Zukunftsstadt« mit Geschichte
Pest – Cholera – Corona
Pestzeiten in dichter Folge / Im Kampf gegen die Seuche: Ärzte – Behörden – Kirchen / Blattern – Die Geißel des 18. Jahrhunderts / Stadt in Panik: Nach Pest und Pocken die Cholera / Seuchengeschichte: Kontinuitäten und Zäsuren zwischen Pest und Corona / Hospitäler
Stadtpolitik im Wandel
Historische Reminiszenzen: 1586, 1956, 2012 / Grundzüge der Stadtpolitik / Von der Residenz- zur Bürgerstadt / Der »Donat« und die Stadtgesetzbücher / Die »gute Regierung« und ihre Vorbilder / Das Ende der Sülfmeister / Soziale Fürsorge und patrizisches Selbstverständnis / Reformen in Politik und Verwaltung / Marcus Heinemann – Ehrenbürger der Stadt, »ein guter treuer Bürger« / Die Gründerzeit – Mäzene und Honoratioren / Neue Infrastruktur – Erfolg und Misserfolg / Für die einen eine Schande, für die anderen eine Ehre – Der Verkauf des Ratssilbers / Lüneburg auf dem Weg ins 20. Jahrhundert / Anna Vogeley, die erste Frau im Rathaus / Nationalsozialisten in Lüneburg / Der »Führerbunker« / Das Ende der jüdischen Gemeinde / Kriegsende und Verantwortung
Geschichtskultur: Vom Umgang mit Denkmälern und Erinnerungsorten
Steine des Anstoßes im 20. Jahrhundert / Die ersten Kriegerdenkmäler und die Dragoner / Das Denkmal für Johanna Stegen – Das »Heldenmädchen« von Lüneburg / Bergen-Belsen-Prozess – KZ-Ehrenfriedhof – Eisenbahnwaggon / Ein Denkmal gerät in den Fokus / Die Synagoge – Aus dem Stadtbild getilgt und als Gedenkstätte neu gedacht / Die »Euthanasie«-Gedenkstätte Lüneburg / Die »Unfähigkeit zu trauern«
Spannungsfelder – Lüneburg und die äußeren Mächte
Städtisches Streben nach unbeschränkter Freiheit / Bedrohte Freiheiten / Die Dramaturgie des Jahres 1371 und der Preis der Freiheit / Rat und Hanse gegen Prälaten, Papst und Kaiser / Beginnender Machtverfall / Beschleunigung des Wandels / Lüneburg als »welfische Erb- und Landstadt« / Wechselnde Herrschaften / »In untertänigster Devotion, Liebe und Treue« – Die Huldiugung von 1706
Sülfmeister und Kaufleute, Handwerker und Industrielle
Dominanz des Salzes / Mittelalterlicher Industriebetrieb / Salz und Holz / Vielfalt im mittelalterlichen Handwerk / »Kagelbrüder« und Brauer / Angesehene Brauer / Krisenhafte Zeiten / Neuer Aufbruch / Kriege – Krisen – Neuanfänge / »Hilfe aus Schottland« / Neuer Unternehmergeist in Lüneburg / Die »Lünale«
Wege zum Wissen
Anfänge – Konkurrenzen hinter mittelalterlichen Klostermauern / Geschicktes Taktieren – Der Rat und die »sunte Johannis schole« / Zäsuren – Bildung im Zeichen der Reformation / Lucas Lossius / »Winkelschulen« und Mädchenbildung / Entwicklungen und Traditionen / Reisen bildet! / Ritterschaftliche Akademie statt klösterlicher Spiritualität / Neue Dynamik: Bildungsoffensive im 19. Jahrhundert
Kirchen, Klöster und Stiftungen
St. Johannis – Ratskirche unter dem Patronat der Stadt / St. Michaelis – Klosterkirche, Garnisonskirche, Gemeindekirche / St. Nicolai – Kirchenbau der Spätgotik / St. Lamberti – Kirche der Sülfmeister und Salinenarbeiter / Stiftungen »ad pias causas« / Kloster Lüne – ein Kleinod mit großer Geschichte am Rande der Stadt / Kirche heute – ein Ausblick
Kultur und Geselligkeit
Theatralische Anfänge im klösterlichen Milieu / Der Schütting und seine vielseitige Nutzung / Wandernde Komödianten erobern die Bühnen / Neue Maßstäbe auf alten Bühnen / Aufklärung in Lüneburg / Die Lesegesellschaft und die bürgerliche Öffentlichkeit / Der Club von 1785 / Der Weg in die Moderne / Alltagskultur und Geselligkeitskreise
Stadtökologie – Lüneburg ist ganz schön grün!
Wälder und Parkanlagen / Gute Luft trägt zum hohen Alter bei! / Reges Leben in Türmen, Mauern und Pflasterfugen / Kleingärten – Grüne Inseln im Häusermeer / Und am Ende – Die Friedhöfe
Anhang
Zeittafel / Literatur / Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin in Lüneburg von 1846 bis 2021 / Ortsregister / Personenregister / Bildnachweis / Karte von Lüneburg
Vorwort
Wenn sich die großen Linien der Geschichte im Lokalen widerspiegeln, wenn das Staunen über die vielfältigen noch sichtbaren Spuren der Vergangenheit nicht aufhören will, wenn die Freude über die nahezu unzerstörte historische Kernstadt sich paart mit dem Gefallen an den hier geschaffenen Verbindungen von Tradition und Moderne, dann wird das Schreiben einer Stadtgeschichte zu einer erfüllenden Aufgabe, der wir uns als Historikerin und Historiker mit großem Vergnügen und Herz für diese Stadt gewidmet haben. Wie ein buntes Wimmelbild fächert sich die Geschichte der Stadt mit ihren vielen Facetten auf – längst nicht alle konnten ihren Platz zwischen den beiden Buchdeckeln finden. Manches und mancher bleibt außen vor, und wir hoffen auf eine geneigte Leserschaft, die die Lücken verzeiht und die Auswahl mit Wohlwollen annimmt.
Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ratsbücherei und dem Stadtarchiv, im Archiv der Lüneburger Landeszeitung und im Museum Lüneburg für ihre wertvolle kollegiale Unterstützung, dem eifrigen Dokumentar der Stadt Hans-Joachim Boldt für seine Fotos und dem Freund Henning Voss für den kritischen Blick von außen.
Das Jahr 1371, das Jahr, in dem sich Lüneburg die weitgehende Unabhängigkeit erkämpft, liegt inzwischen weit zurück; doch manchmal scheint es, als habe der Bürgerwille seine identitätsstiftende Kraft über die Jahrhunderte erhalten. Lüneburg hat sich zu einer weltoffenen, attraktiven Universitäts- und Kulturstadt mit einem hohen Bewusstsein für die Historizität dieser alten Salz- und Hansestadt entwickelt. Dies ist nicht allein, jedoch zu einem nicht geringen Teil auch der Leitung eines der am längsten amtierenden Stadtoberhäupter in Niedersachsen zu verdanken. Von 1991 bis 2021 lenkte Ulrich Mädge als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt, ihm hat sie viel zu verdanken.
Charakter der Stadt
Lüneburg ist eine lebendige Stadt – die pittoresken Straßenzüge und Plätze, die Wasserläufe und die Parks haben immer schon Maler und Literaten inspiriert, Besucher angezogen und manche von ihnen zum Bleiben bewogen.
Die Lüneburger lieben ihre Stadt. Sie geben gern Auskunft, wenn jemand nach dem Weg fragt oder mit dem Stadtplan in der Hand ratlos dasteht. Und sie zeigen ihre Stadt! Die Gästeführerinnen und Gästeführer sind unterwegs, bisweilen in historischer Kleidung, um Geschichte und Geschichten zu erzählen und voller Stolz durch das historische Rathaus zu führen; es ist in seiner Ausstattung eines der reichhaltigsten Renaissance-Rathäuser Norddeutschlands. Die einstige Bedeutung als Salz- und Hansestadt mit Handelsbeziehungen in ganz Europa und darüber hinaus ist nach wie vor präsent in der von Kriegen und anderen Katastrophen gering betroffenen Stadt.
Die »Kleine Stadtgeschichte« erzählt die Geschichte einer Stadt von ihren Anfängen, den ersten Siedlungskernen auf einem ressourcenreichen und geologisch höchst spannenden Terrain, bis in die Gegenwart. Anschaulich und unterhaltsam führt der Gang durch die Stadtgeschichte zu Ereignissen und Episoden, zu Personen und Persönlichkeiten, zu Gebäuden und Plätzen, zu Büchern und Archiven, zu Märkten und Markantem, aber auch zu Gesteinen, zu Flora und Fauna. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die in Lüneburg leb(t)en und wirk(t)en. Daraus ergibt sich das bunte und lebendige Bild einer Stadtgeschichte, die nicht Daten und Fakten aneinanderreiht, sondern versucht, die Individualität und Identität Lüneburgs zu erfassen und zu erklären, warum »die schönste Stadt der Welt« an der Ilmenau liegt!
1371 – Von der Residenz- zur Bürgerstadt
Bis heute spürt man die Wirkung eines historischen Ereignisses, das weit ins Mittelalter zurückreicht und doch prägend für die Stadtgeschichte wird und im Gedächtnis der Stadt bis heute präsent ist. Bei seiner Gründung wird Lüneburg als Residenzstadt geplant. Die natürliche Erhöhung, der Kalkberg, und drei bereits bestehende Siedlungskerne veranlassen die Herzöge aus dem Geschlecht der Billunger um die Mitte des 10. Jhs., hier eine Stadt zu gründen und sich die kostbaren Ressourcen dieses Fleckens Erde zunutze zu machen. Auf dem Kalkberg entstehen eine Burg und – wie es sich gehört – auch ein Kloster: weltliche und geistliche Macht konzentriert an einem Ort.
Und doch sollte dies im Laufe der Geschichte nicht mehr im Sinne der Lüneburger Bürger sein. Durch den Salzhandel reich und selbstbewusst geworden, wollen sie die Geschicke ihrer Stadt in die eigene Hand nehmen. Lüneburg soll eine Bürgerstadt werden und nicht länger herzogliche Residenzstadt bleiben! Am 1. Februar des Jahres 1371 gelingt die Zerstörung der Burg, und am 21. Oktober desselben Jahres, in der St.-Ursula-Nacht, behaupten die Lüneburger Bürger ihre Freiheiten und Stadtrechte gegen Herzog Magnus, der nach der Zerstörung der Burg versucht, die Stadt mit Waffengewalt zurückzuerobern.
Damit beginnt eine lange Phase der weitgehend autonomen Bürgerstadt. Wirtschaftliche und politische Macht vereinen sich im Patriziat der Stadt. Die Ratsherren sind zugleich die Sülfmeister, jene Männer, die Rechte an der Saline haben und vom florierenden Handel mit dem »weißen Gold« enorm profitieren. Sie fühlen sich den Patriziern der italienischen Stadtrepubliken der Renaissance gleich und zeigen dies am Schmuck ihrer Häuserfassaden, in Inschriften und im wichtigsten Gebäude der Stadt: dem Rathaus. Die »kluge Herrschaft« und »gute Ordnung« nehmen im Bewusstsein und auch im Bild der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes eine wichtige Rolle ein. Das im Kern im 13. Jh. gebaute Rathaus, eines der größten und ältesten Rathäuser in Deutschland, erhält im Laufe des 16. Jhs. eine völlig neue Ausstattung. Die zahlreichen Gemälde, Wand- und Deckenmalereien manifestieren ein politisches Programm, das in seiner Art beinahe einzigartig und allenfalls vergleichbar mit den Rathäusern im italienischen Siena oder Venedig, im belgischen Brügge oder im polnischen Danzig ist. Lüneburg ist ein Musterbuch für die Renaissance.
Aquarell aus einer Bilderchronik von 1595, die Szenen aus dem Lüneburger Erbfolgekrieg zeigt. – Hier: Die Eroberung der Burg.
Vom ersten Drittel des 14. bis zum Beginn des 17. Jhs. erlebt Lüneburg eine Blütezeit. Die Stadt wächst, Kirchen werden gebaut und ausgestattet, Bürger- und Handelshäuser mit beeindruckenden Backsteingiebeln entstehen. Und mittendrin befindet sich der mächtige mittelalterliche Wirtschaftsbetrieb der Saline, die mit ihren Rauchschwaden in vielen zeitgenössischen Stadtansichten als Symbol für Prosperität und Stolz gilt.
Auch wenn die Selbstständigkeit und Vorrangstellung der Hansestadt schon um die Mitte des 17. Jhs. endet und Lüneburg nun als herzogliche Landstadt im gleichnamigen Fürstentum in den frühneuzeitlichen Modernisierungsprozess hineingezogen wird, bleibt die Erinnerung an die große Geschichte der Hansezeit prägend bis heute.
An den verblassten Schriftzügen oder Firmenschildern an einzelnen Gebäuden ist jedoch noch sichtbar, dass es der Stadt vor allem im 19. Jh. gelingt, den Verlust der weitgehenden Autonomie und auch den Niedergang des Salzhandels zu kompensieren. Die Verbindungen über die Flüsse Ilmenau und Elbe sorgen für einen einträglichen Frachtverkehr und ein florierendes Speditionswesen bis – ja, bis die Eisenbahn kommt: Eine neue Zeit bricht an, und ihr werden im folgenden Jahrhundert noch weitere Zäsuren folgen, die die Stadtgeschichte immer wieder in neue Richtungen lenken.
Salzstadt auf unsicherem Boden
Nach wie vor gilt Lüneburg in der Innen- und Außendarstellung als die Salzstadt schlechthin. Das Salz macht die Stadt im Mittelalter berühmt und begehrt. Mons – Pons – Fons, das sind die drei Siedlungskerne, die um die Mitte des 10. Jhs. die zentralen topografischen Gegebenheiten bilden, aus denen die Stadt Lüneburg erwächst. »Mons« bezeichnet den Kalkberg, der bis heute als natürliche Erhebung im Stadtgebiet sichtbar ist. »Pons« ist die Brücke über die Ilmenau, und »Fons« ist die Saline, die den Reichtum der Stadt einst begründet. Gern und immer wieder erzählt wird die Geschichte von der Lüneburger Salzsau, einer Wildsau, die die Solequelle entdeckt haben soll. Nachdem sie von Jägern erlegt worden sei, hätten die Salzkristalle an ihren Borsten den Hinweis auf jene Quelle gegeben, die nicht nur Reichtum bringen, sondern auch identitätsstiftend wirken sollte bis in eine Zeit hinein, in der die Saline schon längst nicht mehr in Betrieb ist.
Spektakulärer noch als die Legende sind die Fakten. Der Salzstock gehörte zum Zechsteinmeer, ursprünglich einmal im heutigen Nordafrika gelegen. Die Ablagerungen, unter anderem Salze, schoben sich im Laufe von Jahrmillionen immer weiter nach Norden. Heute dehnt sich dieser Salzstock auf einer Fläche von 1400 x 900 Metern unterhalb der Stadt aus; die Oberseite, der Salzspiegel, liegt in 40 bis 70 Metern Tiefe. Aus seiner Mitte erhebt sich der Kalkberg mit gut 56 Metern über NN. Um den Salzstock herum lagern die Erdschichten aus den Eiszeiten, die der Salzstock mit mächtiger Kraft durchbrochen und teilweise mitgeschleppt hat. So kommt es zu der geologischen Besonderheit, dass Erdschichten, die in anderen Regionen mehrere Tausend Meter unter der Erdoberfläche lagern, rund um den Salzstock hochgedrückt werden und ihre »Schätze«, die Gesteine aus den Eiszeiten, freigeben.
»Wahrhaftige und eigentliche Abcontrafactur der löblichen Stadt Lüneburg nach aller Form und Gestalt«. Kupferstich von Daniel Frese, Lüneburg 1611. – Die vom Rat der Hansestadt in Auftrag gegebene Stadtansicht hält zahlreiche Details der Gebäude fest. Lüneburg ist zu dieser Zeit mit rund 14.000 Einwohnern eine der wenigen Großstädte im Alten Reich.
Durch den Salzhandel wird Lüneburg Mitglied der Hanse, jenes mittelalterlichen Handels- und Verkehrsbundes von Kaufleuten, die neben dem gegenseitigen Schutz- und Bündnisversprechen ein gemeinsames Selbstverständnis verbindet: Verlässlichkeit, Weltoffenheit und Urbanität sind ihnen wichtige Bezugspunkte. Nachdem die Blütezeit der Hanse vorbei ist und die Zeit der großen, auf das Salz konzentrierten Handelsbeziehungen zu Ende geht, spielt auch der Begriff »Hansestadt« keine elementare Rolle mehr für Lüneburg. Er sinkt für einige Jahrhunderte in die Bedeutungslosigkeit. Erst relativ spät gerät er wieder in das Bewusstsein der Stadt. Seit 2007 darf Lüneburg wieder den Titel »Hansestadt« tragen.
Stadt und Landesherrschaft
Von äußeren Mächten ist die Stadt im Laufe ihrer Geschichte immer wieder beeinflusst worden: durch die Zugehörigkeit zum Fürstentum Lüneburg als Teil des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg, als Landdrostei des Welfenhauses bzw. der preußischen Provinz Hannover, als Gauhauptstadt des Gaus Ost-Hannover während der NS-Zeit und als Teil des neugegründeten Landes Niedersachsen.
Dynastische Konstellationen bringen zuweilen Entwicklungen mit sich, deren Tragweite und Auswirkungen den meisten Menschen in Lüneburg eher als gegebene und weniger das persönliche Leben betreffende Entscheidungen im Bewusstsein bleiben. Und doch hinterlassen die äußeren Mächte auch ihre Spuren im Stadtbild, suchen ihre Präsenz und Bedeutung sichtbar zu machen. Das Stadtschloss lässt Herzog Georg Wilhelm von Lüneburg in den Jahren 1695 bis 1700 gegenüber dem Rathaus errichten – nicht als Neubau, sondern als Ensemble von drei Patrizierhäusern, die prachtvoll den Marktplatz säumen und nun unter dem Dach der herrschaftlichen Residenz mehr oder weniger verschwinden. Das Stadtschloss zeigt unmissverständlich die Herrschaftsansprüche eines Landesherrn, der sich vermutlich häufiger auf seinem Jagdschloss in Wienhausen als in Lüneburg aufhält, jedoch durch das repräsentative Gebäude in exponierter Lage auch in der Hansestadt überaus präsent ist und bleibt.
Schloss am Markt um 1840. Innenseite des Deckels eines Schminkkastens. Öl auf Holz. – Hier ist die naive Darstellung eines Fürstenbesuches im Schloss zu Lüneburg abgebildet.
Dynastische Entscheidungen führen auch dazu, dass sich mit dem Lüneburger Stadtschloss in der Lokalhistoriografie vor allem ein klangvoller Name mit einer ebenso wirkmächtigen Person dahinter verbindet: Eléonore d’Olbreuse, von Stadtchronisten zu Unrecht als herzogliche Mätresse tituliert und darauf reduziert, ist die Ehefrau Georg Wilhelms. Die Tochter aus hugenottischem Landadel im französischen La Rochelle und Hofdame in Paris lernt Georg Wilhelm am Kasseler Hof kennen und wohl auch lieben. Der Herzog setzt sich für sie über sein Versprechen hinweg, auf eine Eheschließung zugunsten seines Bruders zu verzichten, um ein Leben mit dieser nicht nur wegen ihrer Schönheit bekannten, sondern auch klugen Frau zu verbringen. Unter ihrem Einfluss entsteht 1684 ein Edikt, das den reformierten Glaubensflüchtlingen aus Frankreich Aufnahme im Fürstentum Lüneburg zusichert. Und so lebt im herzoglichen Stadtschloss am Markt zeitweise auch eine kleine Gemeinde von Hugenotten, die den Audienzsaal als Raum für ihre Gottesdienste nutzt. Ihre Witwenjahre verbringt Eléonore d’Olbreuse in Lüneburg.
Ebenfalls äußere Mächte sind es, durch die Lüneburg eine Bedeutung als Garnisonsstadt bekommt. Während des Dreißigjährigen Krieges richtet Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg eine Garnison in Lüneburg ein. Dafür zahlt die Stadt einen hohen Preis, denn sie muss den Kalkberg an den Herzog abtreten: eine bittere Niederlage, die das Ende der weitgehenden städtischen Autonomie besiegelt.
Von der Garnisons- zur Universitätsstadt
Der weitere Ausbau der Stadt zur Garnisonsstadt erfolgt dann im 19. Jh. und vor allem in der NS-Zeit. Lüneburg wird 1937 Gauhauptstadt des Gaus Ost-Hannover, und mit dem Kasernenbau wird Lüneburg für Jahrzehnte zur Soldatenstadt.
Lange Zeit bleibt die NS-Zeit in Lüneburg unerforscht. Nur wenige Dokumente und Belege der NS-Strukturen und Täter vor Ort bleiben erhalten; viele der politisch Verantwortlichen fliehen. Sprachlos bleibt man in der Nachkriegszeit auch angesichts des ersten großen Prozesses gegen die NS-Täter, dem Bergen-Belsen-Prozess. Im September 1945 stehen in Lüneburg die Täter des KZ Bergen-Belsen vor einem britischen Militärgericht, und in diesem Moment blickt die Welt auf Lüneburg. Nur wenige Monate zuvor ist die Stadt durch das kluge Handeln des Lüneburger Stadtkommandanten Oberstleutnant von Bülow kampflos übergeben worden und somit von Zerstörungen verschont geblieben. Und ganz in der Nähe, auf dem Timeloberg, hat am 4. Mai 1945 die Teilkapitulation der norddeutschen Truppen gegenüber der britischen Armee unter Führung des Generalfeldmarschalls Bernard L. Montgomery stattgefunden. Heute ist der Timeloberg ein Gedenk- und Lernort, ebenso wie eine Reihe von weiteren Schauplätzen und Denkmälern. Sie werden im Kontext einer reflektierten und zukunftsweisenden Erinnerungskultur kritisch in den Blick genommen und neu bewertet.
Mit dem 2017 fertiggestellten »Libeskindbau«, dem Audimax nach den Entwürfen des international bekannten Architekten Daniel Libeskind, erhält die Leuphana Universität Lüneburg einen besonderen Akzent.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte muss das Militär an vielen Standorten weichen. Zunächst übernehmen die Briten die militärischen Liegenschaften in Lüneburg, bis 1958 die Bundeswehr – meistenteils freudig begrüßt – mit mehreren Tausend Soldaten in die Kasernen einzieht. Lüneburg wird jetzt wieder eine Soldatenstadt. Doch das Ende des Kalten Krieges geht am Militärstandort Lüneburg nicht spurlos vorbei. So kommt es, dass hier drei Kasernen von der Bundeswehr aufgegeben werden. In diesem Zuge setzt ein bemerkenswerter Prozess ein, der mit dem Begriff »Konversion« bezeichnet wird: die Umwandlung der Gebäude von militärischer in zivile Nutzung.
Allmählich verschwinden die Soldaten mehr und mehr aus dem Stadtbild, und auch diese Entwicklung trifft die lokale Wirtschaft. Gleichzeitig entwickelt sich die Pädagogische Hochschule Lüneburg. 1946 wird sie gegründet und 1978 zur wissenschaftlichen Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht erklärt. Die freigewordenen Liegenschaften der Scharnhorstkaserne sind geeignet, um den Raumbedarf der Hochschule zu decken. Aus der einstigen Wehrmachtskaserne ist ein Ort freier Forschung und Lehre geworden. Das neue Zentralgebäude der Universität mit seiner besonderen Architektur, den asymmetrischen Formen und der Außenfassade aus Glas und Titanzink, bildet einen bewussten Gegensatz zur streng gegliederten Kasernenarchitektur. »Statt Strenge und Disziplin soll der ‚Libeskindbau‘ Transparenz und Demokratie symbolisieren«, heißt es in einem Beitrag zur Geschichte der Universität. Die Leuphana Universität genießt heute einen weit über die Region und Landesgrenzen hinausgehenden Ruf. Sie ist international aufgestellt und zieht Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie Studierende aus allen Teilen der Welt ins beschauliche Lüneburg.
Topografie der Stadt
Kommt ein Besucher in die Stadt an der Ilmenau, so erschließt sie sich ihm unverkennbar als ein Ort hoher kultureller Dichte mit einem nach wie vor lebendigen Bewusstsein ob ihrer kulturhistorischen Besonderheiten. Unwillkürlich drängen sich ihm beim Gang durch die verschiedenen Stadtviertel Fragen nach deren Charakter und Wandel im epochalen Rhythmus der Zeitläufte auf.
Die mittelalterlichen Quartiere – Bis heute erhalten
Nur wenige Schritte entfernt vom Marktviertel mit Markt und Rathaus im Zentrum zeigt sich dem Besucher im Quartier rund um St. Michaelis ein gänzlich anderes Bild der Stadt: Verwinkelte, schmale Gassen, von Bescheidenheit gezeichnete Hausfassaden, Spuren einer einstigen Klostergemeinschaft, kaum noch sichtbare Hinweise auf ein jüdisches Gemeindeleben in mittelalterlichen Zeiten. Die Stadt findet hier eine Prägung durch Menschen, die ihr Auskommen in der nahen Saline, im kleinen Handwerk hatten. Ruhig und beschaulich ist es hier; Einheimische wie Fremde erfreuen sich an den farbig gefassten Haustüren, den Rosenstöcken an den Eingängen und den liebevoll gestalteten Innenräumen der Kastenfenster. Schaut man genau hin, erkennt man die Arbeit der verschiedenen Gewerke, die am Fensterbau früher beteiligt waren: Tischler, Glaser und Maler, aber auch Schlosser und Schmiede für die kunstvollen Beschläge mit ihren traditionellen Verschlusstechniken.
Beinahe wäre das Michaelisviertel dem Modernisierungstrend der Nachkriegsarchitektur zum Opfer gefallen; den vielen baufälligen Häusern im Senkungsgebiet nahe der Saline droht in den 1960er und 70er Jahren der Abriss. Der Denkmalschutz spielt damals keine große Rolle. Die Architektur der Zeit setzt ganz andere Akzente: neue Formen, neue Materialien, neue Konstruktionen. Davon bleibt das Michaelisviertel jedoch verschont, denn schon in den frühen 1970er Jahren gründet sich hier eine der ersten Bürgerinitiativen in Deutschland und sorgt dafür, dass die historische Bausubstanz erhalten bleibt.
HINTERGRUND
DER »ALA« – VERANTWORTUNG IN BÜRGERHAND
Seit 1974 kümmert sich der »Arbeitskreis Lüneburger Altstadt« (ALA) als Verein um den Denkmalschutz. Sein Gründer ist Curt Pomp, der sein Leben dem Denkmalschutz gewidmet hat. Er bringt Freunde und Bekannte dazu, die zum Abriss freigegebenen Häuser zu kaufen und damit zu retten. Heute ist das Viertel längst nicht mehr das Quartier der »kleinen Leute«. Die Eigentümer der Häuser eint das Bewusstsein für die Anforderungen des Denkmalschutzes zur Erhaltung ihres Besitzes.
Das Michaelisviertel trägt zusammen mit den übrigen denkmalgeschützten Gebäuden der Altstadt dazu bei, dass die Hansestadt Lüneburg mit ihrer außergewöhnlichen Dichte und Qualität an originaler, historischer Bausubstanz zu den wichtigsten Architekturstätten mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Baukultur in Norddeutschland zählt.
Geschäftiges Treiben, pulsierendes Leben erfüllt den städtischen Raum im nahegelegenen Wasserviertel um den Hafen, das Alte Kaufhaus und die Nicolaikirche. Hier sind es die Schiffsknechte und Salztonnenböttcher, Handwerker, Spediteure und Lastenträger, die dem Viertel einst eine lebendige, bisweilen laute, auch derbe Dynamik verliehen haben.
Die drei großen mittelalterlichen Stadtkirchen prägen das Stadtbild und geben Orientierung. Neben der Michaelis- und der Nicolaikirche überragt St. Johannis den Platz Am Sande, das Sandviertel. Schon im 8. Jh. gibt es hier an der Brücke über die Ilmenau eine kleine hölzerne Taufkirche, um die sich einer der ersten Siedlungskerne der späteren Stadt gruppiert. Der große sandige Platz in der Nähe des Flusses, der dem Ort bis heute seinen Namen gibt, ist im Mittelalter der Umschlagplatz für Waren. Händler und Kaufleute fahren mit ihren Fuhrwerken vor und preisen ihre Waren an, Gasthäuser und Herbergen bieten ihnen Unterkunft. An der Südseite des Platzes wohnen im 16. Jh. überwiegend Patrizier; die übrigen Grundstücke nutzen Brauer, Gewerbetreibende, Spediteure. Die Gebäude sind heute noch Zeugnisse der Blütezeit Lüneburgs vom 14. bis zum frühen 17. Jh. Baugeschichte lässt sich hier besonders gut studieren. Mehrachsige Treppengiebel, Blendarkaden, spitzbogige Blenden, Standerker, sog. »Utluchten« und detailreiche Formsteine in vielen Varianten verleihen diesem Platz seinen besonderen Charme. Vor den Portalen entstehen repräsentative Treppenanlagen mit sog. Beischlagwangen, den »Visitenkarten« des Hauses, auf denen die Besitzer mit ihren Wappen und Hausmarken, aber auch biblischen Szenen oder Heiligendarstellungen ihren Repräsentationsbedürfnissen nachkommen.
Straßenzug im Michaelisviertel. Die Fenster sind die »Augen des Hauses« – diese Metapher nutzten schon die Architekten in der Renaissance.
Die Stadt im Bild
Lüneburg ist die Stadt der Türme und Giebel, das wissen auch schon die Maler im 15. Jh. aufs Beste hervorzuheben. Eine der seltensten, wenn nicht die älteste erhaltene Darstellung einer Stadt überhaupt befindet sich auf einem Altarflügel in der Nicolaikirche, der jüngsten der Lüneburger Altstadtkirchen, die reich mit gotischen Kunstwerken ausgestattet ist. Der Hamburger Meister Hans Bornemann schafft 1446/47 auf einem Altarflügel eine Panoramaansicht Lüneburgs und damit die erste topografisch getreue Stadtansicht Norddeutschlands. Die Stadt bildet den Hintergrund für eine biblische Szene.





























