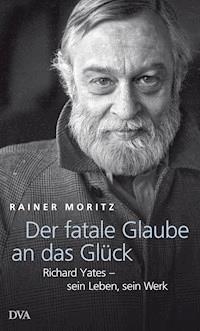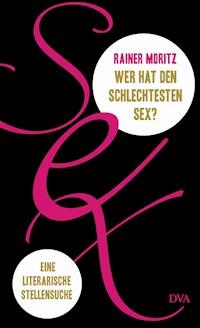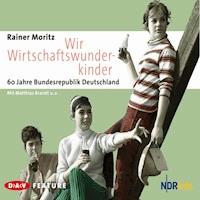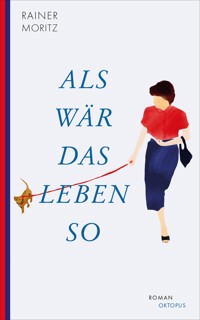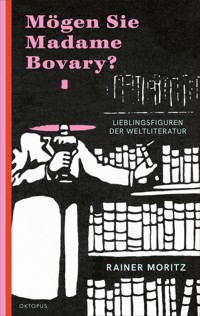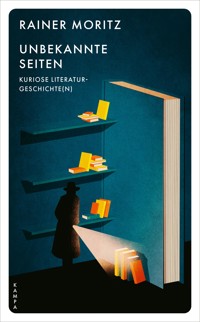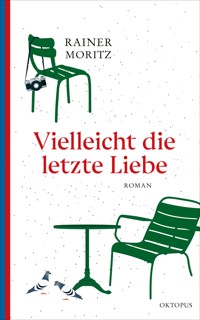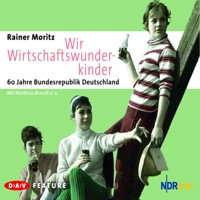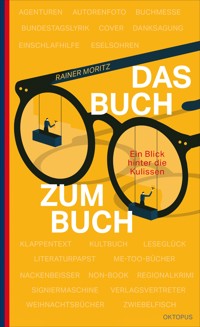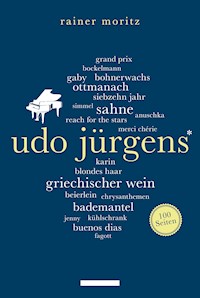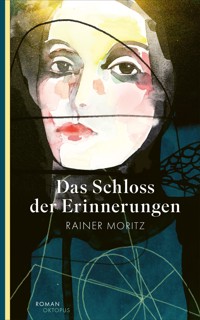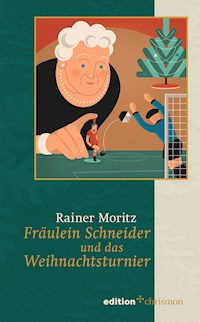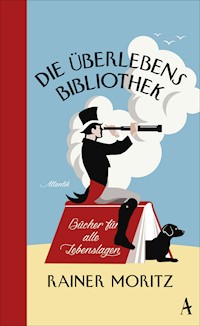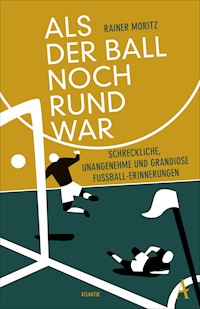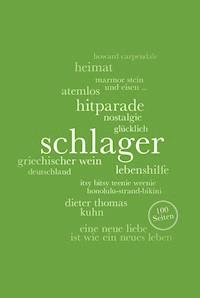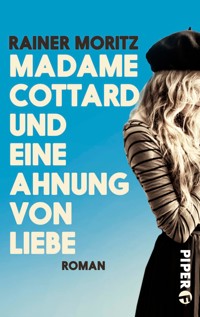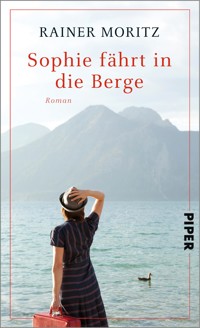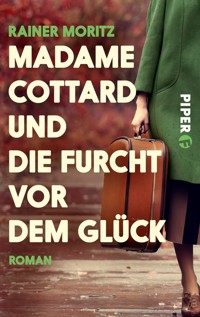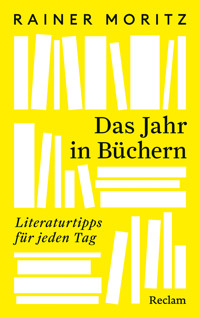
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Antwort auf die Frage: »Was soll ich lesen?« Was soll man lesen? Welche Romane, Gedichte oder Theaterstücke lohnt es, wieder in die Hand zu nehmen oder erstmals für sich zu entdecken? Rainer Moritz macht aus der Not eine Tugend und gibt unerschrocken satte 366 Literarturtipps (Schaltjahre also inbegriffen). Ob Vertrautes oder Überraschendes: Auf jeder Seite findet sich eine Buchempfehlung, die entweder einen direkten oder einen charmanten Bezug zum Datum oder zur Jahreszeit hat. So möge Neugier entstehen, den Horizont zu erweitern und sich dem Entlegenen, dem manchmal zu Unrecht Vergessenen zuzuwenden. Ein Buch voller Leseglück, das dazu ermuntert, die eigenen Regale abzuschreiten oder Buchhandlungen und Bibliotheken zu durchstöbern. Ein bibliophile Freude zum Verschenken – oder um sich selbst eine zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer Moritz
Das Jahr in Büchern
Literaturtipps für jeden Tag
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Kosmos Design, Münster
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962440-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011511-4
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Vorwort
1. Januar
2. Januar
3. Januar
4. Januar
5. Januar
6. Januar
7. Januar
8. Januar
9. Januar
10. Januar
11. Januar
12. Januar
13. Januar
14. Januar
15. Januar
16. Januar
17. Januar
18. Januar
19. Januar
20. Januar
21. Januar
22. Januar
23. Januar
24. Januar
25. Januar
26. Januar
27. Januar
28. Januar
29. Januar
30. Januar
31. Januar
1. Februar
2. Februar
3. Februar
4. Februar
5. Februar
6. Februar
7. Februar
8. Februar
9. Februar
10. Februar
11. Februar
12. Februar
13. Februar
14. Februar
15. Februar
16. Februar
17. Februar
18. Februar
19. Februar
20. Februar
21. Februar
22. Februar
23. Februar
24. Februar
25. Februar
26. Februar
27. Februar
28. Februar
29. Februar
1. März
2. März
3. März
4. März
5. März
6. März
7. März
8. März
9. März
10. März
11. März
12. März
13. März
14. März
15. März
16. März
17. März
18. März
19. März
20. März
21. März
22. März
23. März
24. März
25. März
26. März
27. März
28. März
29. März
30. März
31. März
1. April
2. April
3. April
4. April
5. April
6. April
7. April
8. April
9. April
10. April
11. April
12. April
13. April
14. April
15. April
16. April
17. April
18. April
19. April
20. April
21. April
22. April
23. April
24. April
25. April
26. April
27. April
28. April
29. April
30. April
1. Mai
2. Mai
3. Mai
4. Mai
5. Mai
6. Mai
7. Mai
8. Mai
9. Mai
10. Mai
11. Mai
12. Mai
13. Mai
14. Mai
15. Mai
16. Mai
17. Mai
18. Mai
19. Mai
20. Mai
21. Mai
22. Mai
23. Mai
24. Mai
25. Mai
26. Mai
27. Mai
28. Mai
29. Mai
30. Mai
31. Mai
1. Juni
2. Juni
3. Juni
4. Juni
5. Juni
6. Juni
7. Juni
8. Juni
9. Juni
10. Juni
11. Juni
12. Juni
13. Juni
14. Juni
15. Juni
16. Juni
17. Juni
18. Juni
19. Juni
20. Juni
21. Juni
22. Juni
23. Juni
24. Juni
25. Juni
26. Juni
27. Juni
28. Juni
29. Juni
30. Juni
1. Juli
2. Juli
3. Juli
4. Juli
5. Juli
6. Juli
7. Juli
8. Juli
9. Juli
10. Juli
11. Juli
12. Juli
13. Juli
14. Juli
15. Juli
16. Juli
17. Juli
18. Juli
19. Juli
20. Juli
21. Juli
22. Juli
23. Juli
24. Juli
25. Juli
26. Juli
27. Juli
28. Juli
29. Juli
30. Juli
31. Juli
1. August
2. August
3. August
4. August
5. August
6. August
7. August
8. August
9. August
10. August
11. August
12. August
13. August
14. August
15. August
16. August
17. August
18. August
19. August
20. August
21. August
22. August
23. August
24. August
25. August
26. August
27. August
28. August
29. August
30. August
31. August
1. September
2. September
3. September
4. September
5. September
6. September
7. September
8. September
9. September
10. September
11. September
12. September
13. September
14. September
15. September
16. September
17. September
18. September
19. September
20. September
21. September
22. September
23. September
24. September
25. September
26. September
27. September
28. September
29. September
30. September
1. Oktober
2. Oktober
3. Oktober
4. Oktober
5. Oktober
6. Oktober
7. Oktober
8. Oktober
9. Oktober
10. Oktober
11. Oktober
12. Oktober
13. Oktober
14. Oktober
15. Oktober
16. Oktober
17. Oktober
18. Oktober
19. Oktober
20. Oktober
21. Oktober
22. Oktober
23. Oktober
24. Oktober
25. Oktober
26. Oktober
27. Oktober
28. Oktober
29. Oktober
30. Oktober
31. Oktober
1. November
2. November
3. November
4. November
5. November
6. November
7. November
8. November
9. November
10. November
11. November
12. November
13. November
14. November
15. November
16. November
17. November
18. November
19. November
20. November
21. November
22. November
23. November
24. November
25. November
26. November
27. November
28. November
29. November
30. November
1. Dezember
2. Dezember
3. Dezember
4. Dezember
5. Dezember
6. Dezember
7. Dezember
8. Dezember
9. Dezember
10. Dezember
11. Dezember
12. Dezember
13. Dezember
14. Dezember
15. Dezember
16. Dezember
17. Dezember
18. Dezember
19. Dezember
20. Dezember
21. Dezember
22. Dezember
23. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
26. Dezember
27. Dezember
28. Dezember
29. Dezember
30. Dezember
31. Dezember
Leseempfehlungen von A–Z
Vorwort
Was soll man lesen? Welche Romane, Gedichte oder Theaterstücke lohnt es, wieder in die Hand zu nehmen oder erstmals für sich zu entdecken? Wie findet man Orientierung in den Unmengen von Büchern aus vergangenen und heutigen Tagen?
Das Jahr in Büchern möchte aus der Not eine Tugend machen und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, unerschrocken satte 366 Literaturtipps (Schaltjahre also inbegriffen) geben und Sie dazu einladen, viele Werke der Weltliteratur kennenzulernen. Natürlich geht es mir nicht darum, einen Kanon zu liefern und so zu tun, als ließe sich verbindlich auflisten, was man gelesen haben müsse. Nein, es ist eine durch und durch subjektive Auswahl dessen, was mir in meinem Leben, das zum Glück immer mit Büchern zu tun hatte, begegnet ist und was mir aus ganz unterschiedlichen Gründen gefallen hat.
Es ist eine Reise durch etliche – beileibe nicht alle – Regionen der Weltliteratur; blinde Flecken der Lektüre seien mir bitte nachgesehen. Vertrautes, ja Klassisches findet sich neben Unvertrautem. So möge Neugier entstehen, den eigenen Horizont zu erweitern und sich dem Entlegenen, dem manchmal zu Unrecht Vergessenem zuzuwenden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Literatur des späten 20. und des 21. Jahrhunderts – auch um zu zeigen, dass diese mehr an Beachtlichem aufzuweisen hat, als es Gegenwartsskeptiker gemeinhin vermuten.
Die Titel sind, wie es sich ergab, konkreten Tagen oder Jahreszeiten zugeordnet, die in den Büchern mal offensichtlich, mal versteckt eine Rolle spielen. Die knappen – eine Seite pro Titel – Inhaltshinweise sollen Lust darauf machen, die eigenen Regale wieder einmal abzuschreiten oder Buchhandlungen, Antiquariate und Bibliotheken aufzusuchen. Viele der empfohlenen Titel sind in unterschiedlichen Ausgaben aktuell lieferbar, und wenn nicht, ist es auf antiquarischem Weg nicht schwer, fündig zu werden.
Gehen Sie also mit mir durchs Jahr, auf dass sich die Frage »Was soll ich lesen?« nicht mehr so oft stellen möge.
Im Mai 2025
Rainer Moritz
1. Januar
Versagen im Examen
Goethevon Egon Friedell und Alfred Polgar
Silvester 1907/08, wir sind im Wiener Kabaretttheater Fledermaus. Kurz nach Mitternacht ist es so weit: Egon Friedell (1878–1938) und Alfred Polgar (1873–1955) feiern die Premiere ihres kurzen Theaterstücks Goethe. Es findet so großen Anklang, dass über zweihundert weitere Aufführungen folgen werden. Die beiden österreichischen Dichter tun an diesem Abend zur Freude ihres bildungsbürgerlichen Publikums zweierlei: Sie machen sich lustig über den Heiligenkult, mit dem Goethe inzwischen bedacht wird, sowie über die Germanistenzunft, die ehrfürchtig den Weimarer Dichterheros Goethe auf diesen Sockel gehoben hat.
Ein armer Schüler namens Züst steht vor seinem Literaturexamen, das seine Goethe-Kenntnisse auf den Prüfstand stellen soll. Züst hat zu diesem Thema nichts zu sagen und verflucht seinen Prüfungsgegenstand, was zur Folge hat, dass Goethe, gespielt von Friedell selbst, aus dem Jenseits auftaucht, sich an Züsts Freundin Linerl erfreut und sich bereit erklärt, einen »Jokus« mitzumachen: Er selbst wird als Prüfling auftreten und, wie könnte es anders sein, mit Glanz und Gloria bestehen.
Natürlich kommt es anders. Der in breitem Hessisch redende Olympier kann mit den detaillierten Nachfragen von Professor und Schulrat nichts anfangen. Auf die Frage, wann Goethe Wetzlar verlassen habe, weiß er nur Vages zu berichten, während die richtige Antwort »Am 23. September 1772, 5 Uhr nachmittags mit der Fahrpost« gelautet hätte. Und als es darum geht, welche »seelischen Erlebnisse« die Fortführung des Wilhelm Meister bewirkt hätte, antwortet er: »No, da hat er doch schon vom Verleger die 200 Taler Vorschuss uff’n zweiten Band gehabt, da hat er’n doch aach schreibe müsse.« Logische Folge: Goethe fällt beim Thema Goethe durch.
Goethe. Eine Szene erschien erstmals 1908 bei Carl Stern.
2. Januar
Liebe & Trauer
Wider die Naturvon Tomas Espedal
Bleiben wir beim Jahresanfang, bei Nachwirkungen der Silvesternacht. Eine Sache, wie sie alle Tage passiert: Eine Frau verlässt ihren Partner, der voller Liebesschmerz zurückbleibt. Eine scheinbar gewöhnliche Geschichte – doch nicht, wenn sie von dem Norweger Tomas Espedal (*1961) stammt.
Tomas, so heißt der Protagonist in Wider die Natur, ist Schriftsteller, Ende vierzig. In einer Silvesternacht verliebt er sich in Janne, Anfang zwanzig. Übergangslos verfallen beide in einen symbiotischen Rausch – obschon Tomas den Altersunterschied als »wider die Natur«, als entscheidendes Hindernis begreift.
Die Liebe zwischen Tomas und Janne ist nicht von Dauer. Der Schmerz bringt den Verlassenen dazu, auf sein Leben zurückzublicken. Auf die Jugendzeit, als er in einer Fabrik Webstühle reinigt. Auf die Begegnung mit der Schauspielerin Agnete, mit der er ein Kind zusammen hat. Diese bekommt mit einem anderen eine weitere Tochter, und als sie an Krebs stirbt, zieht Tomas die beiden Kinder auf.
Wider die Natur ist ein grandioser Text, der sich immer wieder auf die literarische Tradition bezieht. Die großen Liebenden des Mittelalters, Abaelard und Heloïse, bilden eine Referenz, doch auch Peter Handke und Espedals Landsmann Karl Ove Knausgård sind markante Anlaufstellen für den Schriftsteller Tomas.
Als Janne Tomas am Ende verlässt, dieser sich dem Alkohol und seiner Verzweiflung hingibt, wandelt sich der Stil – hin zu einer kompromisslosen Kondensation der Gefühle, hin zum Stakkato einer Trauer, die nicht wahrhaben will, dass das Glück sich entfernt. »Ich muss weitermachen, als ob alles normal wäre. Wie ist das möglich? Wie oft müssen wir weitermachen, als ob nichts passiert sei?«
Wider die Natur (Die Notizbücher) erschien 2011 im norwegischen Original Imot naturen (notatbøkene) und 2014 bei Matthes & Seitz, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel.
3. Januar
Sex mit Tieren
Bärvon Marian Engel
»Im Winter lebte sie wie ein Maulwurf, tief vergraben in ihren Papieren, und wühlte zwischen Karten und Manuskripten« – so beginnt Marian Engels Roman Bär. »Sie«, das ist die scheue Bibliothekarin Lou, die winters in Toronto in einem Kellerbüro ihrer Arbeit nachgeht, hin und wieder den Sex mit einem Vorgesetzten erträgt und vom Glück des Lebens wenig abbekommt. Nun aber im Sommer geht sie einer besonderen Tätigkeit nach, die sie aus ihrer Ödnis befreien soll: Auf einer entlegenen Flussinsel im nördlichen Ontario soll sie den Nachlass eines Colonels katalogisieren und sich zugleich um einen halbzahmen Braunbären im Nachbarhaus kümmern.
So weit, so gut. Doch die Kanadierin Marian Engel (1933–1985) macht aus diesem Setting einen der ungewöhnlichsten Romane der Weltliteratur. Lou gewinnt nach und nach das Vertrauen ihres pelzigen Weggefährten, und zwischen beiden entspinnt sich weit mehr als Freundschaft, mehr als eine platonische Liebe. Bär zeichnet nach, wie sich die beiden Protagonisten annähern und (explizit beschrieben) Sex miteinander haben – was Leserinnen und Leser seinerzeit aus der Fassung brachte.
Das Verblüffende an Engels Roman ist die Selbstverständlichkeit, mit der diese Vorgänge festgehalten werden. Wo in der Literatur die Beziehung zwischen Mensch und Tier oft rührselig und verkitscht daherkommt, geht es in Bär um etwas, was nach wenigen Seiten nichts Künstliches oder Schockierendes an sich hat. Dass hier Oralverkehr betrieben, dass hier penetriert wird, das ruft keine Empörung hervor. Man liest diese Passagen staunend – als sei es das Natürlichste der Welt. Engels zottiger Bär erfährt keine possierliche Vermenschlichung, und er taugt auch nicht als Symbol für was auch immer. Es ist, wie es ist.
Bär erschien 1976 im kanadischen Original Bear. Gabriele Brößkes Übersetzung folgte 1986 im Frauenbuchverlag, sie wurde 2005 im Unionsverlag und 2022 bei btb neu aufgelegt.
4. Januar
Gegen das Wasser
Sturmflutvon Margriet de Moor
Alles beginnt harmlos, im Winter 1953: Die Schwestern Armanda und Lidy, beide um die zwanzig, beschließen, für ein Wochenende ihre Rollen zu tauschen. Armanda hat nicht so recht Lust, zu ihrem Patenkind auf die niederländische Insel Schouwen-Duiveland zu fahren, und bittet ihre Schwester, den Besuch zu übernehmen. Währenddessen soll Armanda Lidys zweijährige Tochter hüten und bei ihrem Schwager Sjoerd bleiben.
Was als kleiner Ausbruch aus dem Alltagstrott gedacht ist, entwickelt sich über Nacht zu einer Katastrophe: Als Lidy sich mit dem Auto aufmacht, bewegt sich ein Unwetter auf den Südwesten der Niederlande zu – und führt zu einer (historisch verbürgten) Jahrhundertsturmflut, die ganze Landstriche von der Karte verschwinden lässt und knapp 2000 Menschenleben auslöscht.
Margriet de Moor (*1941), der mit Erst grau dann weiß dann blau der Durchbruch als europäische Erzählerin gelang, schafft es in ihrem Roman, die Figuren von der ersten Seite an in ein psychologisches Netz zu verwickeln, das immer enger und bedrohlicher wird. Als Leser weiß man es früh: Lidy überlebt das Unwetter nicht, und Armanda wird ihren Schwager heiraten, sobald Lidys Tod offiziell beurkundet ist. Trotzdem entwickelt sich eine Spannung, die weit mehr umfasst als Lidys Kampf gegen die Wassermassen und Armandas Unsicherheit, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll.
Sturmflut erzählt von unaufhaltsamen Schicksalsmächten und vom Versuch der Menschen, sich mit diesen zu arrangieren. Es geht um Leben und Tod, und es geht um die Hilflosigkeit, mit Verlust und Trauer zurechtzukommen. Ein Buch, dessen Bilder sich tief einprägen.
Sturmflut erschien 2005 im niederländischen Original De verdronkene und ein Jahr später bei Hanser, übersetzt von Helga van Beuningen.
5. Januar
Schauer & Komik
Das Phantom der Opervon Gaston Leroux
Mit dem Stoff sind die meisten vertraut, was vor allem mit seiner Popularisierung durch Andrew Lloyd Webbers und Richard Stilgoes Musical von 1986 zu tun hat. Weniger bekannt ist, dass diesem – und den zahlreichen anderen Adaptionen im Kino, Comic oder auf der Bühne – ein Roman zugrunde liegt. 1910 veröffentlichte Gaston Leroux (1868–1927) Das Phantom der Oper, mit dem er nachweisen wollte, dass das sagenumwobene Phantom kein Produkt überspannter Einbildung sei.
Leroux’ ausschweifendes Buch schwankt zwischen den Genres. Mal Schauer-, mal Kriminal-, mal Liebesroman, blickt es zurück auf die ersten Jahre der am 5. Januar 1875 eingeweihten Opéra Garnier am rechten Seineufer. Auf schwierigem Gelände errichtet, eignet sich das auf einem Grundwasserbecken stehende Gebäude mit seinen vielen Geschossen und Abzweigungen wunderbar dazu, Verwirr- und Gruselspiele zu inszenieren. Seine Ober- und Untergeschosse sorgen für rätselhafte Auf- und Abgänge, die die dümmlichen Direktoren, das Tanz- und Gesangsensemble sowie die Besucher in Ungewissheit lassen, was es mit Phantom Erik auf sich hat.
Was spielt sich wirklich in der Loge Nummer 5 ab? Welche Mittel setzt Erik ein, um die Liebe der Sängerin Christine Daaé zu gewinnen? Die grauenvollen Ereignisse, darunter Eriks skrupelloses Szenario, die Welt untergehen zu lassen, sofern seine Liebe unerfüllt bleibt, sind für die abgebrühte Leserschaft von heute weniger erschreckend als für Leroux’ Zeitgenossen. Für Spannung bleibt dennoch gesorgt, und nicht zuletzt ist Das Phantom der Oper ein komischer Roman – mit verschwundenen Pferden und einer Sängerin, die plötzlich auf der Bühne zu quaken beginnt.
Das Phantom der Oper erschien 1910 im französischen Original Le fantôme de l’Opéra; zwei Jahre später folgte die erste deutsche Übersetzung von Rudolf Brettschneider, die jüngste 2024 aus meiner Feder bei Reclam.
6. Januar
Enttäuschung in Brighton
Hangover Squarevon Patrick Hamilton
Hangover Square ist eine Elendsgeschichte, die von Anfang an keinen Zweifel daran lässt, dass ihre Hauptfiguren nur selten in der Lage sind, zu neuen Ufern aufzubrechen. Sie setzt Anfang 1939 im Londoner Stadtteil Earl’s Court ein und endet mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. In Earl’s Court versammeln sich die Underdogs der Gesellschaft, deren Lebensinhalt ums Immergleiche, um Whisky, Bier und Gin kreist.
George Harvey Bone, Hamiltons Hauptfigur, ist voller Schwächen und zieht dennoch unweigerlich Mitleid auf sich. Er ist mit einem besonderen Leiden geschlagen, mit einem »Geräusch im Kopf«, einem »Laut, den ein Geräusch hinterlässt, wenn es abrupt aufhört«. Seit längerem peinigen ihn solche »bekloppten« Momente, ihn, einen Mittdreißiger, der in einem schäbigen Hotelzimmer wohnt, mit Herzblut an einer Katze hängt und den Lockrufen des Alkohols nicht gewachsen ist. Patrick Hamilton (1904–1962) zeichnet einen ewigen Kreislauf, einen Kreislauf von Erniedrigungen, Illusionen und Enttäuschungen.
Als Georges Verhängnis erweist sich seine verblendete Liebe zu der Möchtegernschauspielerin Netta, die sich einen Spaß daraus macht, den Liebestrunkenen zum Narren zu halten. Früh ahnt man, dass sich George hoffnungslos in dieser Schwärmerei verlieren wird. Unaufhaltsam, wie an der Schnur gezogen, läuft sein Leben auf ein Desaster zu. Mit entsetzlicher Konsequenz schmiedet George sein eigenes Unglück, bleibt unbelehrbar: Am stärksten zeigt sich das, als er sich ausmalt, gemeinsam mit Netta ein »romantisches« Wochenende zu verbringen, im eleganten Brighton. Zweimal macht sich George mit Netta ins Seebad auf, und zweimal bleiben seine Erwartungen unerfüllt. Ein schlimmes Ende bahnt sich an.
Hangover Square. Eine Geschichte aus dem finstersten Earl’s Court erschien 1941 im englischen Original Hangover Square. Die deutsche Übersetzung von Miriam Mandelkow folgte 2005 bei Dörlemann.
7. Januar
Das Attentat
Der Fetzenvon Philippe Lançon
Philippe Lançon (*1963) ist Überlebender des Anschlags auf die Redaktion der Pariser Zeitschrift Charlie Hebdo vom 7. Januar 2015. Schwer verwundet – Kugeln zerfetzten seine untere Gesichtshälfte; unter einem sterbenden Kollegen liegend, stellte er sich tot – verbringt er Monate im Krankenhaus. Siebzehn komplizierte Operationen sind notwendig. Wochenlang darf er während dieses »Wiederherstellungsprozesses« nicht sprechen.
Der Fetzen beschreibt einen mühsamen Genesungsweg, einen Lebensrhythmus, bei dem das Opfer nur von Operation zu Operation zu denken vermag. »Zukunft« scheint es nicht zu geben. Es geht – wie der leidenschaftliche Proust-Leser deutlich macht – nicht um »wiedergefundene« oder um »verlorene« Zeit; es geht um die »unterbrochene« Zeit, um die völlige Ungewissheit, ob diese Unterbrechung je enden wird.
Erst das vierte Kapitel trägt die Überschrift »Das Attentat« und schildert in eindringlicher Lakonie, was an jenem Januarmorgen geschah. Davor beschreibt Lançon den unbeschwerten Vorabend, den er mit Freunden verbrachte. So gelingt es ihm, die Zäsur des Folgenden besonders drastisch vor Augen zu führen. Und natürlich verleitet diese Heraufbeschwörung des Attentats und seiner Vorgeschichte zwangsläufig dazu, über die Zufälle nachzudenken, die über das (Weiter-)Leben entscheiden.
Den Attentätern würdigt Lançon während seines Krankenhausaufenthalts keinen Gedanken. Der gegen seinen Tod Kämpfende erinnert sich, reflektiert, liest und versucht, das Gelesene auf sich und seine Erfahrungen zu beziehen. Der Fetzen ist ein nach vielen Seiten hin offenes Buch, das auf sein fast unvermeidliches Ende zuläuft: auf das Massaker im Pariser Bataclan-Theater Mitte November 2015.
Der Fetzen erschien 2018 im französischen Original Le lambeau und ein Jahr später bei Tropen, übersetzt von Nicola Denis.
8. Januar
Die Letzten
Im Schneevon Tommie Goerz
Nichts in diesem Dorf ist mehr, wie es einmal war. Nur die Alten erinnern sich an das Früher. Irgendwo in der Fränkischen Schweiz spielt diese Wintergeschichte. Max hört, während sich der Schnee über die Wege und Häuser legt, das Totenglöckchen. Einer von ihnen ist gestorben, sein Freund Schorsch, friedlich eingeschlafen.
Tommie Goerz (*1954) erzählt von Menschen, die mit der neuen Zeit nichts anzufangen wissen und von ihren Erinnerungen leben. Der Kaufmannsladen, die Metzgerei – längst verschwunden. Die Wirtschaft öffnet nur noch stundenweise in einem Hinterzimmer, und die Landwirtschaft lohnt sich nicht mehr. Jahrzehnte ist es her, dass am Rand des Dorfes eine Neubausiedlung entstand, doch die »Neubürger« sind noch immer Fremde: »Wenn man aus dem Dorf war, wusste man Bescheid, und wenn nicht, ging es einen auch nichts an.«
Voller Schmerz betrauert Max den Schorsch, einen gutmütigen Kerl, der die alten Apfelsorten, den Martini und den Rheinischen Krummstiel so mochte. In dessen Haus, wo seine Frau, die Maicherd, trauert, wird die Totenwacht abgehalten, wie es seit alters Brauch ist. Bis Mitternacht wachen die Männer; danach bis zum Morgengrauen die Frauen. Man erzählt sich zum Trost Geschichten aus Schorschs Leben, singt Lieder, trinkt Bier und öffnet eine Packung Mon Chéri.
Eine »Idylle« sei das, sagt ein »Städter«, der Max’ Stube mit seinen Habseligkeiten fotografiert. Doch Max weiß es besser; er kennt die düsteren Geheimnisse der Dörfler, über die ein Mantel des Schweigens gelegt wurde. Am Ende sitzt Max auf einer Bank, die der Schorsch und er aufgestellt haben. Er leert eine Cognacflasche, die ihm der Städter mitgebracht hat, und es will nicht aufhören zu schneien …
Im Schnee erschien 2025 bei Piper.
9. Januar
Störfaktoren
Streichhölzervon Ásta Sigurðardóttir
Sonntagabend bis Montagmorgen heißt die erste der insgesamt 13 Streichhölzer-Erzählungen von Sigurðardóttir, die 1951 bei Erscheinen einen handfesten Skandal auslöste. Denn sie erzählt von einer jungen Frau namens Ásta, die sich auf einer Party unmöglich macht und in einer dunklen Winternacht vor die Tür gesetzt wird. Ein ihr scheinbar wohlgesinnter Mann nimmt sie bei sich auf und vergewaltigt sie noch in derselben Nacht – eine, wenn man will, frühe #MeToo-Geschichte.
Von körperlicher und psychischer Gewalt, von Abtreibungen, Gelagen und Verelendung handeln viele der Geschichten. Niemand scheint den mal in Resignation versinkenden, mal vor Wut rasenden Figuren helfen zu können, auch nicht Gott, der verzweifelt angerufen wird. Da ist zum einen die triste, Hoffnung erstickende Großstadtwelt – wie in Die Schönheitskönigin, wo eine vom Genever zerstörte Frau sich an ihre große Zeit erinnert und sich nun an einen Zeitungsausriss klammert, der von ihrer blühenden Jugend berichtet. Und da ist zum anderen das Landleben, wo ein einsamer Mann sich nur noch wünscht, in seinem von Spekulanten bedrohten Häuschen sterben zu dürfen.
Ásta Sigurðardóttir (1930–1971) ist eine erbarmungslose Erzählerin, die nichts beschönigt und die Qualen ihrer Figuren mitunter bis zum kaum Erträglichen ausmalt. So wie ihr Leben oft kaum erträglich war. Auf einem abgelegenen Bauernhof in Westisland aufgewachsen, wirbelte Sigurðardóttir als unkonventionelle Bohémienne Reykjavík in den 1950er Jahren auf, hatte sechs Kinder und starb an ihren Alkoholexzessen.
Streichhölzer, 2025 verlegt bei Guggolz, basiert weitgehend auf dem im isländischen Original 1985 postum erschienenen Band Sögur og ljód. Die Erzählungen wurden zuerst zwischen 1951 und 1967 publiziert.
10. Januar
Die Nivea-Creme-Nonne
Der Schattenfotografvon Wolfdietrich Schnurre
Wenn es darum ging, die vermeintliche Tabula-rasa-Situation der deutschen Literatur nach 1945 zu belegen, fielen automatisch Namen wie Heinrich Böll, Wolfgang Borchert oder – Wolfdietrich Schnurre (1920–1989). Umso überraschender, als Schnurre 1978 die im August 1976 einsetzenden und am 10. Januar 1977 endenden Aufzeichnungen Der Schattenfotograf vorlegte. Kaum jemand hatte dem ›liebenswürdigen‹ Erzähler Schnurre einen derart kühnen Text zugetraut.
Ohne einer Nabelschau zu verfallen, rückt Schnurre sein Ich ins Zentrum, lässt seinen Reflexionen Spielraum, kommentiert das Zeitgeschehen, blickt in die eigene Werkstatt und lässt den Leser an privater Not – etwa an der Krebserkrankung seiner Frau Marina – teilhaben: »Augenfallen aufstellen. Anblicke horten. Bilder bewahren. Wahrnehmungen speichern. Wobei die Maserung meiner Schreibtischplatte durchaus mit potenziellen Weltreiseeindrücken in Konkurrenz treten sollte.«
Die Freiheit der Form und die Lust am flottierenden Denken machen das Faszinosum der Lektüre aus. Schnurre versteht es, alle Register der Leserverlockung zu ziehen. Man empfindet Rührung, wenn er die Liebe zu seiner Frau und zu seinem Kind festhält, wenn er begeistert Kafka, Bloch oder Benjamin zitiert oder sich mit jüdischen Traditionen befasst. Daneben steht Skurriles, so wenn der Kritiker Schnurre von verstörenden Geruchseindrücken beeinträchtigt wird: »Im Kino einmal neben einer nach Nivea-Creme duftenden Nonne gesessen. Es lief ›Die Jungfrau von Orleans‹.« Die Filmbesprechung musste er absagen. »Grund: Während des Schreibens den Nivea-Geruch nicht mehr loszuwerden vermocht. Da er sich mit Verreisen und Urlaub verband, war der verdiente Verriss in Frage gestellt.«
Der Schattenfotograf erschien 1978 bei List und wurde 2020 vom Berlin Verlag neu aufgelegt.
11. Januar
Sich dem Frost widersetzen
Winterliedvon Ludwig Christoph Heinrich Hölty
Sein bekanntester, durch Mozarts Zauberflöte ins kollektive Gedächtnis eingegangene Vers stammt aus dem Gedicht Der arme Landmann an seinen Sohn: »Üb’ immer Treu und Redlichkeit.« Lieber als diese zum Sinnbild preußischer Moral gewordene Zeile ist mir das Winterlied des jung an Schwindsucht verstorbenen Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–1776). Schubert und Reichardt haben es vertont – Zeichen der Popularität, die dem Klopstock-Verehrer Hölty von seinen Zeitgenossen entgegengebracht wurde.
Reiz gewinnt das Lied dadurch, dass es mit den Entbehrungen einsetzt, die ein frostiger Winter beschert: »Keine Blumen blühn, / Nur das Wintergrün / Blickt durch Silberhüllen, / Nur das Fenster füllen / Blümchen, rot und weiß, / Aufgeblüht aus Eis.« Ja, die Natur knausert mit ihren Schönheiten. »Kein Vogelsang« ist zu hören, kein »süßer Klang«; allenfalls ein paar Meisen schwirren vor dem Fenster herum.
Auch für die Liebe, die Minne, scheint es in dieser unwirtlichen Kälte kein Plätzchen zu geben. Doch zum Glück wissen sich die Liebenden zu behelfen. Sie fliehen den »Hain« und kehren ins Haus, in ihr Zimmer zurück. Das gut geheizte Drinnen lässt sich vom Außen nicht beeindrucken. Folglich schlägt die Schlussstrophe der Kälte ein Schnippchen: »Alles Kummers bar, / Werden wir fürwahr, / Unter Minnespielen, / Deinen Frost nicht fühlen, / Kalter Januar; / Walte immerdar.« Wer wirklich liebt, weiß sich zu helfen.
Höltys Winterlied mit seinen vier sechszeiligen Strophen, die jeweils drei Reimpaare aufeinanderfolgen lassen, gibt einen Ratschlag, der nichts von seiner Gültigkeit verloren hat.
Winterlied erschien zuerst im Musenalmanach für das Jahr 1778. Es wurde vielfach nachgedruckt, etwa in den von Walter Hettche herausgegebenen Gesammelten Werken und Briefen (Wallstein, 2009).
12. Januar
Zehn Jahre später
Drei auf dem Eisvon Tim Krabbé
Die Novelle erzählt von einem Moment des Innehaltens, der für das Leben des vierzigjährigen Pieter eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Zusammen mit seinem zehnjährigen Sohn Wouter hat er die Ferien in Israel abgebrochen, um einem seltenen Naturereignis beizuwohnen: Zu Hause regiert ein strenger Winter, ein Schlittschuhwinter; die Kanäle frieren zu, und es ist endlich wieder möglich, auf Kufen eine Elfstädtetour zu machen. Zehn Jahre ist es her, dass Pieter mit seiner Frau Elleke zuletzt auf dem Eis stand. Wenig später wurde ihr Sohn Wouter geboren; die Ehe hielt nicht. Inzwischen lebt man in freundschaftlichem Einvernehmen und beschließt, zusammen aufs Eis zu gehen.
Tim Krabbé (*1943) lässt die Lust am Eislaufen aufblitzen, eine Erfahrung, die den Kopf durchpustet und Seligkeit beschert. Pieter nutzt die Eislaufentspannung, um über Gott und die Welt nachzudenken – und über seinen Sohn, der am Lieblingssport des Vaters keinen rechten Gefallen findet. Mit nostalgischem Blick erinnern sich Pieter und Elleke an ihre zehn Jahre zurückliegende Eisbegehung – und Pieter kommt der Gedanke, dass diese Zusammenkunft kein Zufall sein kann, dass Elleke bewusst ihren zehnten Hochzeitstag auserwählt hat.
Natürlich – wir ahnen es – wird dieses Eislaufwunder nicht eintreten; natürlich wird es zu keiner plumpen Versöhnung kommen. Pieters Träumereien erweisen sich als Luftschlösser. Das ist betrüblich und sicher enttäuschend. Doch Tim Krabbé bietet eine Lösung an, die hier nicht verraten werden soll. Ein klein bisschen kitschig klingt es vielleicht, dieses holländische Wintermärchen – doch ist es nicht wohltuend, ab und zu daran zu glauben, dass auch Trennungen und Abschiede ihr Gutes haben?
Drei auf dem Eis erschien 2005 im niederländischen Original Drie Slechte Schaatsers und ein Jahr später bei Reclam Leipzig, übersetzt von Susanne George.
13. Januar
Das Gehör
Das Kalkwerkvon Thomas Bernhard
Das war mein erster Bernhard, Pflichtlektüre für ein Tübinger Seminar über deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Von der ersten Seite begeisterte mich, was ich da las: Wie es Thomas Bernhard (1931–1989) gelang, verschachtelte, kaum auseinanderzuhaltende, vom Konjunktiv beherrschte Sätze aneinanderzureihen und es so verunmöglichte, sich den Roman »auf die Schnelle« für die Seminarvorbereitung reinzuziehen, das war durch und durch ungewöhnlich.
Nein, Bernhards Prosa verlangt nach geduldigem Lesen, das sich von Wiederholungen und Abschweifungen nicht abschrecken lässt. Und sie zeigte mir früh, dass Literatur sich nicht nach dem Gutgemeinten, nach edlen Charakteren messen lässt.
Konrad, der Protagonist im Kalkwerk, ist ein Ekelpaket. Er arbeitet an einer bahnbrechenden Studie über das Gehör, nachdem er über zweihundert Dissertationen zum Thema für unzureichend befunden hat. Das Opfer seiner Forschungen ist seine gelähmte Frau, die mit ihm in einem alten Kalkwerk lebt und hilflos den sadistischen Experimenten ausgesetzt ist. Recht voran kommt der Möchtegernforscher aber freilich nicht. In Ermangelung von Geldeinkünften sieht er sich schließlich gezwungen, das Inventar des Kalkwerks zu veräußern. Am Ende eskaliert die Situation. An Weihnachten erschießt Konrad seine Gemahlin, worüber der Roman gleich zu Anfang prächtig spekuliert. Der Täter habe sich, wie im Jänner noch gemutmaßt wird, freiwillig gestellt – oder auch nicht.
Vorgetragen wird das alles von einem namenlos bleibenden Versicherungsvertreter, der Informationen über Konrad und das Geschehen sammelt und – warum auch immer – einen Rapport erstellt, verfasst in jenen wunderbar verschachtelten, kaum auseinanderzuhaltenden, vom Konjunktiv beherrschten Sätzen …
Das Kalkwerk erschien 1970 bei Suhrkamp.
14. Januar
Die Schuld abtragen
Also dann bis morgenvon William Maxwell
1920er Jahre, Lincoln im US-Bundesstaat Illinois. Ein Mord ist geschehen, an einem kalten Wintermorgen. Der Farmer Lloyd Wilson wurde von einer Kugel niedergestreckt, und wer den Schuss abfeuerte, ist klar: sein Nachbar Clarence Smith. Maxwells Ich-Erzähler versucht nachzuzeichnen, was diesem Mord vorausging, und er tut dies in zwei Anläufen. Zunächst aus der Perspektive eines alten Mannes, der sich Jahrzehnte später bemüht, das Vergangene in eine Ordnung (nicht: in Ordnung) zu bringen. Nach rund siebzig Seiten, in denen das Familiendrama angedeutet wird, setzt der Erzähler erneut zu einer Rekonstruktion des Geschehens an. Weil er sich schuldig fühlt gegenüber Clarence’ Sohn Cletus, mit dem er bis zu jenem Schuss befreundet war. Als sich die beiden in Chicago wiedersehen, sind sie unfähig, ein Wort miteinander zu wechseln. Wie hätte eine angemessene Reaktion ausgesehen? Wie wäre Cletus, der ein Drama schlimmster Art erlebt hatte, zu helfen gewesen?
Ihre Väter, Wilson und Smith, hatten als Bilderbuchfreunde gegolten. Bis sich Wilsons Gefühle verirrten und er seine Leidenschaft für Smiths Frau Fern entdeckte: Was folgte, war ein Ehebruch und der Betrug an einem Freund. Wilson wurde von seiner Frau verlassen und kam kaum mehr zurecht. Fern Smith verließ ihren Mann ebenfalls und hoffte – vergeblich – darauf, dass sie mit Wilson dauerhaft zusammen sein würde. Clarence verwahrloste, musste seinen Besitz aufgeben. Es blieb nur die Rache, der tödliche Schuss – und ein Selbstmord am Ende. William Maxwell (1908–2000) findet grausam klare Bilder für das Elend der Eheleute – und ihrer Kinder. Das Einsehen von Schuld, das Anerkennen von Schuld ist eine Sache. Eine andere, einzusehen, dass jeder Weg, sich die Vergangenheit zurechtzulegen, eine Täuschung ist.
Also dann bis morgen erschien 1980 im amerikanischen Original So long, see you tomorrow. Die deutsche Übersetzung von Benjamin Schwarz folgte 1998 bei Zsolnay.
15. Januar
Aprikosencocktails
Das Café der Existenzialistenvon Sarah Bakewell
Existenzialismus, das war mehr als eine Philosophie, das war ein Stil, eine Lebensform. Sarah Bakewell (*1963) zeichnet all das nach, zurückgehend bis zur Jahreswende 1931/32, als sich in der Pariser Rue Montparnasse Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Raymond Aron trafen und, wie es glaubhaft übermittelt ist, beim Diskutieren Aprikosencocktails schlürften. Arons Bericht von der – mit dem Namen Edmund Husserls verbundenen – Philosophie der Phänomenologie elektrisierte Sartre, der sich prompt nach Berlin aufmachte, um sich davon vor Ort ein Bild zu machen.
Warum sich Heidegger und Sartre bei ihrer Begegnung 1953 nichts zu sagen hatten, was den zu einer »Chiffre für eine ganze Epoche« gewordenen Streit zwischen Camus und Sartre ausmachte, was zur Entfremdung zwischen Sartre und Merleau-Ponty führte und was das vielfach porträtierte Paar Sartre/de Beauvoir zusammenhielt, sind Fragen, die für Bakewell nicht von den philosophischen Theoremen zu trennen sind. Existenzialismus ist vor allem angewandter Existenzialismus.
Bakewell scheut vor Wertungen nicht zurück. Wie sehr sie de Beauvoirs Geradlinigkeit bewundert und Merleau-Pontys »Aura des Wohlbehagens, die von ihm ausging«, oder sich an Heideggers Kaltherzigkeit reibt, so sehr rückt Sartre immer mehr ins Zentrum ihrer Analysen. Viel hat sie an seinem monströsen Wesen oder an seiner »unlesbaren« Flaubert-Studie auszusetzen, doch es mangelt ihr nicht an Hochachtung vor seiner permanenten Offenheit für Neues. Wer Bakewells Café der Existenzialisten angenehm berauscht verlässt, fühlt sich klüger als beim Betreten – und gut unterhalten.
Das Café der Existenzialisten. Freiheit, Sein & Aprikosencocktails erschien 2016 im englischen Original At the Existentialist Café. Freedom, Being and Apricot Cocktails und ein Jahr später bei C. H. Beck, übersetzt von Rita Seuß.
16. Januar
Ein einziger Schrei
Trutz, blanke Hansvon Detlev von Liliencron
Versunkene Städte haben es auch literarisch in sich und laden unweigerlich zur Mythenbildung ein. Es muss dabei nicht immer Atlantis sein. Rungholt in der nordfriesischen Küstenlandschaft gibt ebenfalls einiges her, jene Siedlung, die Mitte Januar 1362 von einer gewaltigen Sturmflut überspült wurde. Ihre Überbleibsel werden bis heute immer wieder im Wattenmeer freigelegt und erregen nicht nur die Gemüter der Heimatforscher.
Der Rungholt-Mythos wurde künstlerisch vielfach aufgegriffen, am eindrucksvollsten vielleicht von Detlev von Liliencron (1844–1909) in seiner Ballade Trutz, blanke Hans: »Heut bin ich über Rungholt gefahren, / Die Stadt ging unter vor fünfhundert Jahren. / Noch schlagen die Wellen da wild und empört, / Wie damals, als sie die Marschen zerstört.« Reich waren sie damals, die Siedler mit ihren immensen Kornvorräten. Wie zur »Blütezeit im alten Rom« ging es zu, überall protzender Reichtum, überall Tanz und Gesang, und mit höheren Mächten mochte man nichts mehr zu tun haben: »Die Rungholter wollten sich selbst regieren, / Und keine Zeit mehr mit Gott verlieren.«
Auch dem »Blanken Hans«, wie man friesisch die tosende Nordsee bezeichnet, wollten sie sich nicht beugen: Sie ballten »drohend die Fäuste« und trotzten den Fluten. Doch auf so viel Anmaßung kam die gerechte Strafe, der Untergang. Denn tief auf dem Grunde des Ozeans ruhte ein mächtiges Ungeheuer, das »einmal in jedem Jahrhundert« tief Atem holte und mit »gewaltigen Wassermassen« Menschen und ihre Siedlungen, Rungholt zum Beispiel, verschlang: »Ein einziger Schrei – die Stadt ist versunken, / Und Hunderttausende sind ertrunken. / Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, / Schwamm andern Tages der dumme Fisch.«
Trutz, blanke Hans erschien 1883 in Liliencrons Adjudantenritte und andere Gedichte und wurde in mehreren Werkausgaben nachgedruckt, etwa in den von Walter Hettche herausgegebenen Ausgewählten Werken (Wachholtz, 2009).
17. Januar
Wellenspiel
Für Einenvon Mascha Kaléko
Man liest aus unterschiedlichen Gründen. Um sich zu unterhalten, sich zu bilden, ein germanistisches Studium zu absolvieren – oder um sich von Texten aufwühlen zu lassen, weil man nicht umhinkann, sie aufs eigene Leben zu beziehen. Und wenn einem Prosastücke oder Gedichte in existenziellen Situationen begegnen, vergisst man sie gewiss nicht mehr …
Long, long ago bin ich so auf die Lyrikerin Mascha Kaléko (1907–1975) gestoßen. Damals, als ich mich heillos in eine Krankenschwester verliebte, die dummerweise mit einem anderen Mann zusammen war. Meine Hoffnungen wollte ich nicht begraben, selbst als ich in ihrer Wohnung an der Wand ein Gedicht – Für Einen – entdeckte. »Die Andern sind das weite Meer. / Du aber bist der Hafen. / So glaube mir: kannst ruhig schlafen, / Ich steure immer wieder her«, so setzte es ein, und wäre ich nicht von der Liebe geblendet gewesen, hätte ich es begriffen: Ich zählte zu den »Andern«, während der Konkurrent den sicheren Hafen verkörperte. Die Schlussstrophe machte es nicht besser: »Du bist der Leuchtturm. Letztes Ziel. / Kannst Liebster, ruhig schlafen. / Die Andern … das ist Wellenspiel.«
Meine Sympathie für die Jüdin Kaléko hat das nicht getrübt. Ihre leichten, mal heiteren, mal melancholischen Verse zeigen, wie genau diese von den Nazis 1938 ins Exil getriebene Autorin den Menschen ins Herz und in den Kopf zu schauen verstand. Im Januar 1933 war ihre erste Publikation, Das lyrische Stenogrammheft, erschienen. Von ihrer Popularität haben Kalékos »Verse vom Alltag« nichts eingebüßt. Das Publikum begreift oft sehr gut, wer ihnen ins Herz und in den Kopf schaut … Mit jener Krankenschwester bin ich, das Wellenspiel, heute auf Facebook befreundet.
Für Einen findet sich zuerst im Kleinen Lesebuch für Große (1935). 2012 erschienen bei dtv Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, herausgegeben von Jutta Rosenkranz.
18. Januar
Ortsumgehung
Das Zimmervon Andreas Maier
»Und ich beginne mit meinem Onkel in seinem Zimmer. Das ist der Anfang, aus dem sich alles ableitet. Das Zimmer, das Haus, der Ort, die Straße, die Städte, mein Leben, die Familie, die Wetterau und alles Weitere« – so setzt Das Zimmer ein, Auftakt eines auf elf Bände konzipierten Zyklus. Offenkundig erzählt Andreas Maier (*1967) von seiner eigenen Familie und will die Sicht- und Denkweise des »geburtsbehinderten« Onkels J. nachzeichnen, wie seine Tage abgelaufen sein könnten, damals, als die Studenten Anfang 1969 in Bad Nauheim ein wenig aufbegehrten.
Als Außenseiter läuft J. durchs Leben und steht unter der Obhut seiner Mutter. Er bewohnt ein kaum zugängliches Zimmer und nimmt schließlich sogar am Arbeitsleben teil, als ihm eine Handlangerstelle auf dem Frankfurter Postamt vermittelt wird. Maiers Erzähler begleitet den Onkel auf seinem mühsamen täglichen Weg nach Frankfurt, stellt sich vor, wie er die Arbeitsstunden übersteht, wie er gegen die Versuchung durch Bahnhofsprostituierte ankämpft und wie er seinen Leidenschaften huldigt: Luis-Trenker-Filmen, Heino, der Tasse Kaffee mit fünf Stück Zucker, den sinnlosen Verrichtungen in einer für ihn eigens eingerichteten Werkstatt, dem innig geliebten »nazibraunen« VW Variant Kombi und der Einkehr in traditionsreiche Waldwirtschaften, deren Bierdunst bis weit hinter Bad Nauheim zu riechen ist.
Maiers Roman leistet Außergewöhnliches: Er entdeckt eine Kindheitslandschaft wieder, setzt seinem Sonderlingsonkel ein Denkmal, ohne zu idealisieren oder zu denunzieren, und schafft nebenbei ein Bild jener Zeit, als die Wetterau ein »Land noch ohne Ortsumgehungsstraßen« war.
Das Zimmer erschien 2010 bei Suhrkamp.
19. Januar
Eine Abfolge von Fehlern
Tage- und Notizbüchervon Patricia Highsmith
1941 beginnt Patricia Highsmith (1921–1995) damit, ihr Leben, Lesen und Schreiben zu protokollieren, um zu verstehen, »warum ich dies & das tue«. Am Ende werden es achttausend Seiten, von denen diese Ausgabe einen kleinen Teil umfasst.
Als Studentin in New York kommt sie mit der Boheme in Kontakt. Sie entwickelt Ehrgeiz, eignet sich die Weltliteratur an und schreibt wie besessen. 1950 legt sie den Roman Zwei Fremde im Zug vor, der weltweit Aufsehen erregt, und zwei Jahre besetzt sie ein ganz anderes Terrain: Unter Pseudonym veröffentlicht sie Salz und sein Preis (später: Carol), den Roman einer lesbischen Beziehung. 1955 schließlich folgt mit Der talentierte Mr. Ripley der erste Band der bis heute kultisch verehrten Serie.
All diese Aktivitäten lassen ihr Zeit, ins Nachtleben einzutauchen und sich zu betrinken. Ihre Promiskuität ist legendär, und ohne Scheu steht sie dazu, Frauen zu lieben. 1945 fertigt sie eine Tabelle ihrer Liebhaberinnen an, die Alter, Körperbau oder Haarfarbe auflistet.
Auch Männer tauchen im Liebesleben auf. Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd: »Sie zu küssen ist immer, als würde man eine gebratene Flunder küssen.« Hinter diesen nervenaufreibenden Versuchen, in der Liebe Erfüllung zu finden, steckt die Sehnsucht, Einsamkeit zu überwinden. Im Januar 1983 heißt es lapidar, dass die Liebe vielleicht eine Illusion sei und diese Haltung der »Versuch, Kummer zu vermeiden«.
Die Tagebücher wühlen auf, auch wegen ihrer ressentimentgeladenen, antisemitischen Urteile. Die Obsessionen des Schreibens und Liebens dominieren. Manchmal sorgt ein Pyjamakauf für Lebensfreude, manchmal der Verzehr von Würsten und Bier in Innsbruck für Übelkeit. Das Resümee wird bitterer: »Mein Leben ist eine Abfolge unglaublicher Fehler.«
Tage- und Notizbücher erschien 2021, herausgegeben von Anna Planta und übersetzt von Melanie Walz, pociao, Anna-Nina Kroll, Marion Hertle und Peter Torberg, bei Diogenes und als Her Diaries and Notebooks. 1941–1995 in den USA.
20. Januar
Worte und Wörter
konkrete poesievon Eugen Gomringer
In keinem progressiven Deutschunterricht durfte er fehlen, der am 20. Januar 1925 in Bolivien geborene, in der Schweiz aufgewachsene und 2025 in Bamberg verstorbene Eugen Gomringer. 1953 kreierte er den Begriff ›Konkrete Poesie‹ und entwarf das Programm einer Lyrik, die die Sprache selbst zum Gegenstand machte und nichts davon wissen wollte, »Stimmungen« wiederzugeben oder Naturphänomene einfühlsam zu beschreiben. Nichts als die Sprache selbst sollte verhandelt werden.
Die weltumspannende Bewegung der Konkreten Poesie, die mit visuellen, optischen und phonetischen Mitteln arbeitete, revolutionierte die Lyrik, und wenn Schülerinnen und Schüler vor die Aufgabe gestellt wurden, ein Gedicht Gottfried Kellers mit einem Eugen Gomringers zu vergleichen, ließ sich die Bandbreite der Gattung gut aufzeigen. 1972 versammelte Gomringer in der berühmt gewordenen Anthologie konkrete poesie eigene Verse und die seiner Wegfährten, darunter Helmut Heißenbüttel, Franz Mon, Friedrich Achleitner und Ernst Jandl.
Gomringers bekanntestes, viel zitiertes Gedicht umfasst in fünf Zeilen vierzehnmal das Wort »schweigen«, doch das eigentliche Schweigen steckt in der Mitte des Gedichts, in einer Lücke, einer weißen Leere.
Dass sich auch die grandioseste Sprachspielerei nicht völlig von Inhalten lösen kann und bei ihren Lesern über Assoziationen politische oder gesellschaftliche Gedankenspielereien auslöst, gehört zum Paradox des Genres. In »du blau / du rot / du gelb / du schwarz / du weiss / du« genügen einfachste Mittel, um Alltagsrassismus und dessen Überwindung in Worte zu fassen, ohne dass diese Worte explizit ausdrücken müssten, worum es ihnen geht. Das Konkrete wird so sehr konkret.
konkrete poesie. deutschsprachige autoren. anthologie erschien 1972 bei Reclam.
21. Januar
Ein unsittliches Angebot
In Lovevon Alfred Hayes
Ein Mann, Ende dreißig, sitzt in einer Bar und erzählt einer Zufallsbekanntschaft von dem Unglück, das ihn »wie eine Wolke umhüllt«. Das ist der Rahmen, den Alfred Hayes (1911–1985) ohne viel Aufwand skizziert und den sein Erzähler rasch mit Inhalt füllt. In einem Taxi lernte er eine junge Frau kennen, die bereits manchen Schlag zu verdauen hatte. Eine früh geschlossene Ehe scheiterte; ein Kind, die fünfjährige Tochter Barbara, lebt inzwischen bei ihren Eltern, während sie in einem stets unaufgeräumten Apartment ihre Melancholie pflegt.
Ist es Liebe, was die beiden verbindet? Darüber scheinen sie sich nicht im Klaren zu sein. Das fragile Gerüst ihrer Beziehung gerät ins Wanken, als die Frau in einem Club ein unmoralisches Angebot erhält: Der Textilunternehmer Howard bietet ihr für eine Liebesnacht eintausend Dollar. Die Umworbene weist das Ansinnen entrüstet zurück, um schließlich doch auf Howards Avancen einzugehen, Gefallen am ihr gebotenen Luxus zu finden und ihrem alten Geliebten den Laufpass zu geben.
In Love erzählt von Liebesleid, das man zu kennen meint. Eifersucht, Besessenheit, Verzweiflung, Zudringlichkeit – alle Register werden gezogen, zumal sich die junge Frau, ohne mit offenen Karten zu spielen, dem Verstoßenen, ihrem »Lückenbüßer«, plötzlich wieder zuwendet und beide einen heillos deprimierenden Ausflug an die Küste von Jersey unternehmen.
Es bleibt offen, was von den drei Akteuren zu halten ist. Sie stehen auf unsicherem Boden, werden mit der »Last ihrer Melancholie« nicht fertig: »Es war wie in einem schlechten Film, wenn so etwas im Film überhaupt noch vorkam. Aber vor allem war es wie in einem schlechten Leben.« Elizabeth Bowen nannte den Roman ein »kleines Meisterwerk«. Recht hatte sie.
In Love erschien im amerikanischen Original 1953 und drei Jahre später unter dem Titel Liebe lud mich ein … in Carl Bachs Übersetzung auf Deutsch. 2015 folgte Matthias Fienborks Neuübertragung bei Nagel & Kimche.
22. Januar
Horrorshow
Clockwork Orangevon Anthony Burgess
Verstörte Reaktionen erntete Anthony Burgess (1917–1993), als er Clockwork Orange veröffentlichte. Zu eigenwillig schien der in einer fernen, nicht mehr vom Kalten Krieg bestimmten Zukunft angesiedelte Plot und zu aberwitzig die Idee, eine auf dem Russischen und dem britischen Slang der Zeit basierende Jugendsprache, den Nadsat, zu erfinden. An Aktualität hat dieses vor allem um Gewalt kreisende Buch kaum verloren. Natürlich sind seit seinem Erscheinen in allen Kunstformen, vom Internet zu schweigen, derart viele Exzesse von Gewalt beschrieben worden, dass Burgess’ im Winter beginnende Geschichte viel von ihrer schockierenden Wirkung verloren hat. Und dennoch: Wie sich der in Beethovens Musik vernarrte Erzähler Alex und sich seine um ihn scharende Jugendgang an Drogen berauschen, Schlägereien anzetteln und sich über Frauen hermachen, ist eine Ansammlung sinnlos brutaler Szenen, die wie ein Vorgriff auf Kommendes wirkt. Heikler wird es, wenn sich Clockwork Orange – nachdem Alex zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird – im Fortgang zu einem quasi moralphilosophischen Roman entwickelt. Diese Passagen haben Patina angesetzt.
Nichts verloren von seiner Faszination hat Clockwork Orange dort, wo die Sprache selbst ins Zentrum rückt. Ulrich Blumenbach, der letzte Übersetzer des Romans, bringt Burgess’ Nadsat-Kunstsprache in ein adäquates Deutsch. Selbst wenn man nicht zum Glossar greift, wo Nadsat-Begriffe wie »bugattig« (reich) oder »horrorshow« (gut) erläutert werden, ist es ein Genuss, sich auf Satzperioden wie »Ich mach schlimme Sachen, bin am Krasten und Tolschocken und Schlitzen mit der Britwa und gönn mir gelegentlich ein Rein-raus-rein-raus« einzulassen und sich das Gemeinte zusammenzureimen. Da strahlt Clockwork Orange kräftiger denn je.
Clockwork Orange erschien 1962 im englischen Original A Clockwork Orange. 1972 folgte die erste deutsche Übersetzung (Uhrwerk Orange) von Walter Brumm, 2013 die bislang letzte von Ulrich Blumenbach bei Klett-Cotta, mit dem Zusatz »Die Urfassung«.
23. Januar
Das Glück des anderen
Winterglückvon Friederike Mayröcker
Wie trist eisige Tage im Januar auch sein mögen, wie verschlossen sich die Natur zeigt und den Menschen auf sich selbst zurückwirft: Manchmal blitzt dennoch Hoffnung auf, zeigen sich Phänomene, die sogar ein »Glück« verheißen. Die Wienerin Friederike Mayröcker (1924–2021) hat ein Gedicht geschrieben, das genau davon handelt. Derart Außergewöhnliches tut sich auf, dass es der religiösen Bilder bedarf, um es zu fassen: »eine Erlösung eine Offenbarung jetzt diese / Stimme wieder zu hören Vogelstimme jetzt dieses / Gezwitscher, etwas wie Paradiese blühten / auf ich vergösse die / Tränen.«
Der Vogel, mit dessen Erscheinung seit jeher Transzendentes verbunden wird, und seine Stimme verheißen nichts weniger als eine »Offenbarung«. So zumindest klingt es in der ersten Strophe von Winterglück. Doch die darauffolgende Leerzeile lässt erahnen, dass es beim Konjunktiv (»vergösse«) bleiben wird.
Die zweite, um einen Vers längere Strophe setzt mit einem »aber« ein – und das Ich muss erkennen, dass es mit dem Vogelruf nicht gemeint ist: »dieses / Winterglück / ist mir nicht zugedacht jemand / anderer an einem anderen Ort wird es wird dieses Gezwitscher / Vogelstimme Stimme empfangen an meinerstatt.« Daraus spricht keine Hoffnungslosigkeit. Die Zeilen des Gedichts werden länger, komplexer in ihrem Satzbau, und sie laden dazu ein, von sich selbst abzusehen. Das »Winterglück« wird einem anderen zuteil, und das lyrische Ich trauert deswegen nicht, ist indirekter Empfänger des Glücks. Der Binnenreim des letzten Verses – »Stunde Sekunde« – hallt wie ein Echo nach.
Winterglück erschien 1986 in dem Band Winterglück. Gedichte 1981–1986 bei Suhrkamp und findet sich in den von Marcel Beyer herausgegebenen Gesammelten Gedichten. 1939–2003 (Suhrkamp, 2004).
24. Januar
Ungewisse Entwicklung
Anton Reiservon Karl Philipp Moritz
Der »psychologische Roman« Anton Reiser ist Moritz’ Autobiografie, die sich eng an seine ersten beiden Lebensjahrzehnte hält und versucht, seine »innere Geschichte« abzubilden. Von Anfang an zeichnet der Text die Leiden eines aus kleinbürgerlichen Verhältnissen entstammenden Kindes nach. Früh entdeckt Anton die Möglichkeit, sich mittels seiner Einbildungskraft über die Miseren hinwegzuheben. Eine Hutmacherlehre endet unerfreulich; er macht einen Selbstmordversuch und kehrt gedemütigt in seine Heimatstadt H(annover) zurück. Geplagt von Hypochondrie und Melancholie, sieht sich Anton ständig wechselnden Gefühlsströmen ausgesetzt. Allmählich fasst er Fuß in H. und darf in die hohe Schule eintreten.
Karl Philipp Moritz (1756–1793) schildert selbst »kleinscheinende Umstände« des Alltags, um zu zeigen, was das Leben seines Alter Ego ausmacht. Nach einem Eklat wird ihm die Logis aufgekündigt, er verwahrlost zusehends. Der Roman ist auch pädagogisches Lehrstück, den Lehrern und Erziehern »nicht ganz unnütze Winke gebend«, wie sie mit ihren Zöglingen »behutsamer« vorgehen könnten.
Erfolge und Rückschläge wechseln sich ab, bis Anton H. niedergedrückt verlässt. Reisen führen ihn in verschiedene Orte, wo er seine Leidenschaft für die Bühne ausleben will, ohne der »Vernunft den Sieg zu geben«. Dieses »Lebensbedürfnis« lässt ihn der Speich’schen Theatertruppe nachfahren. Bei »schneidender Kälte« reist er nach Leipzig, wo er jedoch nur noch eine »verstreute Herde« von Schauspielern antrifft. Konträr zum Modell des Entwicklungsromans bleibt so am Ende die Frage, welchem Ziel sich Reisers Lebensweg zuwenden wird, unbeantwortet.
Anton Reiser erschien in vier Teilen von 1785 bis 1790 bei Maurer.
25. Januar
Die Frauen dahinter
Vor aller Augenvon Martina Clavadetscher
Wer sind die Frauen, die Männern Modell standen, doch deren Leben kaum jemand interessierte, obwohl sie »vor aller Augen« waren? Die Schweizerin Martina Clavadetscher (*1979) hat diese Frage keine Ruhe gelassen und eine aufregende kunstgeschichtliche Reise unternommen.
Ihre Spurensuche gilt bekannten und unbekannten Gemälden. Da sehen wir Rembrandts Badende Frau und lesen mit einem Mal, wer diese war: Hendrickje Stoffels, eine der Unzucht mit Rembrandt angeklagte Frau, die den arbeitsscheuen und saufenden Maler aus vielen Bredouillen rettete, indem sie eine Handelskompagnie für Gemälde gründete, Rembrandt anstellte und ihn so vor seinen Gläubigern schützte.
Natürlich kommt ein solches Buch nicht ohne die berühmtesten Frauendarstellungen der Kunstgeschichte aus. Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring darf nicht fehlen und Édouard Manets oft skandalisierte Olympia bekommt neue Konturen, wenn man um die Geschichte des Modells Victorine Meurent weiß, die auch in Manets nicht minder berühmtem Das Frühstück im Freien zu sehen ist.
Es sind bewegende Geschichten, die Clavadetscher zu erzählen hat, Geschichten, die dazu nötigen, über den »männlichen Blick« auf Frauenkörper nachzudenken. Fast ganz am Ende widmet sie sich Ferdinand Hodlers kühnen Sterbebettporträts seiner am 25. Januar 1915 verstorbenen Geliebten Valentine Godé-Darel. Wenn die Todkranke nun zu Wort kommt, führt sie Klage über die Besessenheit ihres malenden Gefährten, der sie ausweide, anstatt sie mit dem Herzen in den Tod zu begleiten. »Halt meine Hand, Ferdinand. Leg den Stift weg und halt bitte meine Hand! Ein letztes Mal den Regen sehen. Nur das.«
Vor aller Augen erschien 2022 im Unionverlag.
26. Januar
Elend in Harlem
The Street / Die Straße von Ann Petry
Die Straße, das Debüt von Ann Petry (1908–1997), verkaufte sich – was zuvor keiner afroamerikanischen Autorin gelungen war – über eine Million Mal. Lutie Johnson, Petrys Protagonistin, ist eine junge schwarze Frau, die sich in den 1940er Jahren in Harlem durchzuschlagen versucht. Nachdem ihre früh eingegangene Ehe mit Jim, der sich mit einer anderen Frau vergnügte, gescheitert ist, sucht sie zusammen mit ihrem Sohn Bubb eine Wohnung. Die kleinen, überteuerten Wohnungen in Harlem sind heruntergekommene Verschläge, die keinen Dollar wert sind.
Von all dem lässt sich Lutie nicht unterkriegen; sie bildet sich weiter, dreht jeden Cent zweimal um, kümmert sich um ihren aufgeweckten Sohn und setzt lange darauf, aus eigener Kraft ihr Schicksal zu meistern. An Widerständen mangelt es nicht: Da wird sie, als ihr eine Karriere als Nachtclubsängerin in Aussicht gestellt wird – am 26. Januar 1934 durften Schwarze erstmals das neu eröffnete Apollo-Theater in Harlem betreten –, schamlos betrogen. Da begegnen ihr Weiße, die in jeder gutaussehenden schwarzen Frau automatisch ein Flittchen sehen. Da ist das abgewirtschaftete Harlem, in dessen Metzgereien es nur das Fleisch gibt, das woanders keine Abnehmer findet. Da gibt es die dreisten Zudringlichkeiten gleich mehrerer »Verehrer«, denen sich Lutie erwehren muss.
Die Straße ist ein packend zu lesendes Buch mit einem schaurigen Figurenarsenal, darunter Hauswart Jones, der die Wohnungsnot von Frauen ausnutzt, danach giert, mit Lutie ins Bett zu gehen, und ihren Sohn zum Kleinkriminellen machen will; oder Mrs. Hedges, die heimliche Regentin des Mietshauses, die ein Bordell betreibt – unvergessliche Gestalten allesamt.
The Street / Die Straße erschien 1946 im amerikanischen Original The Street und 1982 unter dem Titel Die Straße, übersetzt von Marinette Chenaud, erstmals auf Deutsch. 2020 folgte Uda Strätlings Neuübersetzung bei Nagel & Kimche.
27. Januar
Klare Strukturen
Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27. 1. 1968von Peter Handke
Nur sehr eingefleischte Anhänger des 1. FC Nürnberg, der Clubberer, werden sich, ohne das Internet zu konsultieren, daran erinnern, gegen wen ihre Mannschaft am 27. Januar 1968 im DFB-Pokal antrat. Das Auswärtsspiel der Nürnberger bei Bayer Leverkusen besaß keine Auffälligkeiten, die eine Aufnahme ins Goldene Buch des deutschen Fußballs gerechtfertigt hätten. Nürnberg gewann durch Tore von Strehl und Starek souverän mit 2 : 0 und zog in die nächste Runde ein.
Sein Alleinstellungsmerkmal erhielt dieses Match durch den jungen Peter Handke (*1942), der es in seinem Gedicht Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27. 1. 1968 verewigte. Sechs Zeilen, die Namen der Spieler, die Uhrzeit des Spielbeginns – mehr hat das Gedicht nicht aufzuweisen. In der Tradition der Konkreten Poesie stehend, setzt es auf die Schönheit der Mannschaftsaufstellung im heute ausgestorbenen 2–3–5-System.
Seinen besonderen Reiz erhalten die Verse dadurch, dass sie sich von der Realität auf dem Leverkusener Rasen lösen. Denn statt des Abwehrspielers Leupold lief damals Kollege Hilpert auf, wie der Literaturwissenschaftler Volker Bohn herausfand. Dass Leupold in der 76. Minute eingewechselt wurde (allerdings nicht für Hilpert), mag zu Handkes Verwirrung beigetragen haben. Das en détail zu erhellen bleibt Aufgabe der Germanistik. Der bereits verstorbene Hilpert kann dazu nicht mehr befragt werden, Helmut Leupold aber schon.
Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27. 1. 1968 erschien 1969 in Handkes Gedichtband Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt (Suhrkamp).
28. Januar
Bäumchen wechsel dich
Fehler machenvon Gabriel Josipovici
So reich die Literaturgeschichte an Texten ist, die von Beziehungsdesastern handeln, so gekonnt erfindet Gabriel Josipovici (*1940) – auf den Spuren von Mozarts Ende Januar 1790 uraufgeführter Oper Così fan tutte – das Rad neu und breitet eine Perlenschnur aus, auf der die Figuren von Kapitel zu Kapitel die Positionen (und die Partner) wechseln.
Eine Handvoll Menschen, englische Intellektuelle, die auf die vierzig zugehen, bildet das Personal. Man isst und trinkt zusammen, lässt die Vergangenheit Revue passieren und erkennt schnell, dass auf nichts im Leben Verlass ist. Charlie und Bea zum Beispiel trennen sich routinemäßig alle paar Wochen; Beas Schwester Dorothy hingegen, eine prinzipienfeste Frau, die am besten mit dem Philosophen Blaise Pascal verheiratet wäre, scheint mit Tony eine Traumehe zu führen. Als jedoch ein gemeinsamer Freund, Alfonso, indiskret daran erinnert, dass die Dinge während des Studiums noch ganz anders lagen – Dorothy Charlie und Tony Bea in den Hafen der Ehe führen wollte –, tut sich ein amüsantes Chaos auf.
Tony fühlt sich mit einem Mal von seiner anspruchsvollen Gattin überfordert und schlüpft bei seiner Sekretärin unter. Ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel setzt ein, und Josipovici hat offenkundig Freude daran, einen Reigen vorzuführen, an dem man Gott sei Dank nicht beteiligt ist. Nur wenn Alfonsos Frau, die Foodexpertin Deirdre, aufzutischen beginnt, möchte man an dieser Intellektuellentafel mit von der Partie sein.
Ein Roman der theaterreifen Dialoge, die vor Esprit funkeln, ist das. Fehler machen handelt von permanent zu treffenden Entscheidungen, die fast immer falsche Entscheidungen sind … was fast schon wieder tröstlich ist.
Fehler machen erschien 2009 im englischen Original Making Mistakes und ein Jahr später bei Haffmans/Zweitausendeins, übersetzt von Katja Scholtz.
29. Januar
Eines Wintertags
spaziergang zu allen jahreszeitenvon Reiner Kunze
In der DDR war Reiner Kunze (*1933) ein schlecht gelittener, bespitzelter Autor, der endgültig in Ungnade fiel, als er 1976 im Westen seinen Prosaband Die wunderbaren Jahre veröffentlichte, dessen Alltagsbeobachtungen mit dem DDR-System auf sublime Weise abrechneten. Ein Jahr später kam Kunze selbst in die Bundesrepublik, schrieb dort weiter und galt vielen fortan als konservativer Autor.
Seine Gedichte – 1955 hatte er die ersten veröffentlicht – leben von ihrer Verknappung, von Raffungen, die mit bewusst wenig Aufwand die Gefühlswelten ausloten. spaziergang zu allen jahreszeiten ist so ein Konzentrat, das nicht mehr als fünf, auf zwei Strophen verteilte Verse umfasst, ein Wintergedicht, das einen Abschied beschreibt, wo eben Zweisamkeit herrschte.
»Noch arm in arm / entfernen wir uns voneinander«, so fängt das Gedicht an. Das verräterische »noch« kündet von dem, was bald nicht mehr sein wird. Eine Trennung, der Tod scheint zu nahen, obschon man noch Arm in Arm miteinander geht. Die zweite Strophe blickt weiter in die Zukunft, registriert mit nüchternem Ton, dass die Zahl der gemeinsamen Spaziergänge endlich ist: »Bis eines wintertags / auf dem ärmel des einen / nur schnee sein wird.«
Wo gerade noch die Arme, die Ärmel der Wintermäntel miteinander verschränkt waren, wird – das Futur spricht – künftig Leere sein. Der eine oder andere – niemand weiß es – muss dann allein seiner Wege gehen. Wo menschliche Wärme einst zu spüren war, liegt nur noch Schnee auf dem Mantelärmel – ein Schnee, der nichts davon ahnt, dass er eine Leere bedeckt. So findet Kunze in diesem Liebesgedicht ein zartes Bild für einen unaufhaltsamen Verlust.
spaziergang zu allen jahreszeiten erschien 1998 bei S. Fischer in dem Gedichtband ein tag auf dieser erde.
30. Januar
Vorbei, die Jahre der Freiheit
Nora Webstervon Colm Tóibín
Nein, diese Nora Webster ist keine Frau für Sentimentalitäten. Sie hat ihren Mann Maurice, einen angesehenen Lehrer, beim Sterben begleitet, und sie weiß danach nicht recht, wie sie sich und ihre vier Kinder in einer südirischen Kleinstadt Ende der 1960er Jahre durchbringen soll. Dennoch gibt sich die Mittvierzigerin keine Blöße, versinkt nicht in Trauer.
Alles steht nun auf dem Prüfstand. Wird sie für die Kinder aufkommen, ihr Leid trösten können? Schweren Herzens tritt sie eine Stelle im Büro an und gerät mit der Rückkehr in die Berufstätigkeit in eine ungeliebte Tretmühle. Was immer Nora widerfährt, sie kämpft – eine Frau, die sich weder von keifenden Vorgesetzten noch von neugierigen Verwandten etwas vorschreiben lässt. Wie sie es von ihrem Mann gewöhnt war, versucht sich Nora über alles eine Meinung zu bilden – wissend, dass Frauen nicht nur in der irischen Provinz jener Jahre eine solche Haltung nicht so einfach zugestanden wird.
Sie nimmt Gesangsunterricht, erschließt sich die klassische Musik, kommt ohne die Traumwelten von Musik und Film nicht aus. Trotz des Respekts, den sie erfährt, bleibt sie eine einsame Frau, dahintreibend »in einer See von Leuten, wenn der Anker gelichtet war und das Ganze seltsam zwecklos und verwirrend erschien«. Colm Tóibín (*1955) verfügt über einen geschulten Blick für die Kleinigkeiten des Alltags, für die unscheinbaren Mosaiksteine, die ein Lebensbild ausmachen, und er lässt seine Heldin nicht im luftleeren Raum agieren. Die einsetzenden Konflikte in Nordirland, der ›Blutsonntag‹ vom 30. Januar 1972, als im nordirischen Derry englische Soldaten Bürgerrechtsdemonstranten kurzerhand erschießen – auch das zieht nicht spurlos an Nora Webster vorüber.
Nora Webster erschien 2014 im englischen Original und zwei Jahre später bei Hanser, in der Übersetzung von Giovanni und Ditte Bandini.
31. Januar
Geglücktes Kommen
Voxvon Nicholson Baker
Gleich nach Erscheinen im Januar 1992 kam Vox auf die Bestsellerliste. Telefonsex – darum geht es – war damals eine aufregende Sache, und Nicholson Baker (*1957) verdanken wir den Klassiker dazu. Er umfasst das Telefonat zweier einsamer Menschen – Jim und Abby –, die sich in epischer Ausführlichkeit darüber unterhalten, was ihr Leben, keineswegs nur in erotischer Hinsicht, ausmacht. Quer über den amerikanischen Kontinent reichen ihre nächtlichen Geständnisse, die leichter fallen, als wenn man sich in einem Café gegenübersäße. Natürlich baut Baker von Anfang an einen Spannungsbogen auf, der die zum Voyeur werdenden Leser dazu zwingt, sich die Intensivierung des Gesprächs auszumalen und auf die Orgasmen der beiden zu warten. Und sie kommen wirklich, nach hundertsechsundachtzig Seiten: »Oh! Nnnnnnnn! Nnn! Nnn! Nnn! Nnn! Nnn!« »Es spritzt raus. Ich kann nicht anders! Ah! Ah! Oooooooo.«
Bakers erzählerische Mittel setzen auf eine eher herkömmliche Rein-raus-Schilderung, mit starker Betonung des Vokals O, der aber immerhin durch die exzessive Nutzung des benachbarten Konsonanten N – wir sehen Abbys klappernd zusammengebissene Zähne vor uns – einen gewissen Kontrast erfährt. Der Unterschied liegt allein im Kopf der Leser, die allein wissen, dass die beiden »nur« davon sprechen und allenfalls dabei Hand an sich legen. Aber nicht nur Abby hat ihren Spaß, auch Jim kommt zum Orgasmus. »Ich hab dich kommen hören, da bin ich auch gekommen« – so einfach geht das. Zwei Seiten später ist übrigens alles vorbei. Die erschöpften Gesprächspartner tauschen Telefonnummern aus. Abby hat im Haushalt zu tun (»Da muss eine ganze Ladung Handtücher in die Wäsche«); beide bedanken sich artig, ehe der Vorhang fällt: »Sie legten auf.«
Vox erschien 1992 im amerikanischen Original und bei Rowohlt, übersetzt von Eike Schönfeld.
1. Februar
Eine Tüte voller Dollar
Das stille Landvon Tom Drury
Dafür, dass Pierre Hunter gerade einmal Mitte zwanzig ist, hat er einiges erlebt. Seine Eltern sind früh verstorben, und als er nach dem College in seine Heimat zurückkehrt, steht sein junges Leben auf der Kippe: Ein harmlos anmutender Schlittschuhlauf endet um ein Haar tödlich, und nur der tatkräftigen, rätselhaften Stella Rosmarin ist es zu verdanken, dass Pierre nicht im eiskalten Wasser umkommt.
Tom Drury (*1956) versteht es, realistische Passagen magisch zu überblenden und so seinen vom Schicksal nicht begünstigten Figuren Tiefe zu geben. Dass »jeder Erfolg die Bedingungen für seinen eigenen Niedergang« schaffe, ist Pierres »einzige Lebensweisheit«. Die Figuren führen knappe Dialoge, in der eigentümlichen Landschaft einer karstigen Hochebene. Ohne dass Pierre zu den obskuren (Klein-)Verbrechern der Region zählen würde, gerät er in verhängnisvolle Situationen. In einer Silvesternacht landet er sturzbetrunken auf der falschen Party, führt einen Münztrick vor und soll danach wegen Hausfriedensbruch angeklagt werden. Wenig später, als er trampend seine Cousine in Kalifornien besucht, gerät er mit einem Pick-up-Fahrer aneinander. Pierre wehrt sich, setzt seinen Gegenspieler außer Gefecht und entwendet eine Tüte mit 77 000 Dollar. Der Bestohlene heftet sich an seine Fersen, und die Schlinge zieht sich zu.
Zwischen all dem mischen sich eindringliche Bilder der Einsamkeit. Etwa wenn Stella eine Lichterkette aus »kleinen Deko-Lämpchen in der Form von Eicheln« um einen Bonsai schlingt: »Es war nichts Besonderes mit dieser Lichterkette, aber Stella hatte sie hier im Haus gefunden und konnte bei diesem Licht besser nachdenken.«
Das stille Land erschien 2006 im amerikanischen Original The Driftless Area und 2015 bei Klett-Cotta, übersetzt von Gerhard Falkner und Nora Matocza.