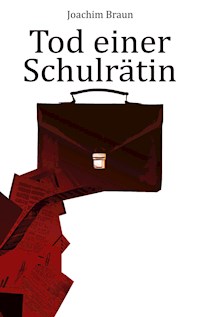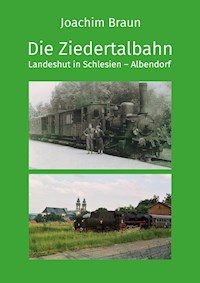9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der erste Eltern-Ratgeber zur Pubertät,der sich nur mit Mädchen beschäftigt. Was passiert bei Töchtern in der Pubertät? Wie schaffen Eltern den Rollenwechsel, wie überstehen sie die Ablösungskonflikte? Was tut man am besten bei typischen Alltagskonflikten wie Zickenalarm, Styling-Kontroversen, erste Liebe, Sex und Verhütung, null Bock auf Schule, zu viel Zeit vor dem Computer oder bei Facebook? Wie begegnet man Pubertätsrisiken wie Essstörungen, frühe Schwangerschaft, Alkohol und Drogen, Depressionen und Mobbing? Mit einer Menge Hintergrundwissen und vielen praktischen Tipps unterstützen die Psychologin Kirsten Khaschei und der Psychotherapeut Joachim Braun die Eltern heranwachsender Töchter. Fallgeschichten und O-Töne machen diesen Ratgeber zu einem hilfreichen Begleiter durch eine turbulenteEntwicklungsphase, in der Mädchen sich auf ihrem individuellen Weg zur Frau finden müssen – und Eltern erfahren: Wir sind nicht allein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Joachim Braun • Kirsten Khaschei
Mädchen in der Pubertät
Wie Töchter erwachsen werden
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Nika
Gemeinsam neue Lebensräume erobern
Wenn Mädchen (und ihre Eltern) in die Pubertät kommen
Stehen mehrere Erwachsene zusammen, plaudern angeregt über ihre Kinder und fällt irgendwo plötzlich das Stichwort «Pubertät», dann kann man fast sicher sein, welche Reaktionen kommen: «Was? Ihr Armen!», «Oje, und dann noch eine Tochter!», «Wie alt? Vierzehn? Da habt ihr ja noch was vor euch!», «Und darfst du ab und zu auch noch mal ins Badezimmer?», «Na? Wie oft zickt ihr euch jeden Tag an?», «Geht sie etwa gern in die Schule? Keine Sorge, das nächste Lehrergespräch kommt bestimmt …», «Hängt eure auch die ganze Zeit nur im Internet herum?»
Selten hört man im Alltag etwas Schönes, Wertschätzendes oder Nachdenkliches über die Pubertät. Wesentlich öfter ist die Erwachsenen-Perspektive von plakativen Sprüchen oder einem leicht genervten Gefühlsgemisch bestimmt, das von Ratlosigkeit bis zu abgeklärter Distanz oder von spöttischen Kommentaren bis zu verzweifeltem Galgenhumor reicht.
Vor einigen Jahren erzählte eine Freundin, Klassenlehrerin in einer 8. Klasse, von ihren Schülerinnen und Schülern: «Sie können zwar manchmal echt anstrengend sein, aber ich mag sie! Wie sie da vor mir sitzen, manche so wütend und motzig, andere total matt, antriebslos oder müde, mit ihren Pickeln und frisch gewaschenen Haaren, frech oder schüchtern, aufgedreht oder traurig, geschminkt und gestylt oder extra cool, ein bisschen arrogant oder vollkommen desinteressiert. Und doch versuchen sie alle auf ihre Art nur eins: so gut wie möglich irgendwie erwachsen zu werden!»
Wie schön, das zu hören! Für pubertierende Mädchen und Jungen ist es nämlich unglaublich wichtig, in ihrem Alltag auf Erwachsene zu treffen, die ihnen mit einer grundsätzlich positiven und wohlwollenden Haltung begegnen. Wie sonst sollen sie lernen, sich selbst zu mögen, mit diesen komischen Stimmungsschwankungen, die kein Mensch versteht? In diesem sich so eigenartig fremd anfühlenden Körper, von dem man noch gar nicht recht weiß, ob der irgendwann noch mal schön wird oder nicht?
Verständlicherweise wird es den wenigsten Eltern gelingen, eine solche positive und wohlwollende Haltung auch in den hitzigsten Hochphasen pubertärer Familienstreitereien und Auseinandersetzungen zu wahren. Wer bleibt schon cool, wenn ein 13-jähriges Mädchen um Mitternacht immer noch nicht zu Hause ist? Jeden Tag neue Forderungen aufstellt? Einfach nie zufrieden ist? Keine Möglichkeit auslässt, einen selbst oder andere vor den Kopf zu stoßen?
Tatsächlich würden Sie Ihrer Tochter auch gar keinen Gefallen tun, wenn Sie in solchen Momenten ruhig und freundlich blieben, schließlich sucht sie ja gerade die Auseinandersetzung und tut so ziemlich alles, um Mutter oder Vater mal endlich richtig auf die Palme zu bringen. Und warum das alles? Um sich von Ihnen zu lösen, um einen eigenen Standpunkt im Leben zu finden, um so gut wie möglich erwachsen zu werden.
Erwachsenwerden, mit einer Extraportion Power
Einen eigenen, erwachsenen Standpunkt zu finden, das ist für Jugendliche ein anstrengender und kräftezehrender Prozess, der auf vielen Ebenen stattfindet. Deshalb sind sie oft müde und antriebslos und scheinen doch in manchen Momenten vor Lebensenergie und Kraft nur so zu strotzen! Wer weiß, wahrscheinlich hat sie die Natur mit einer Extraportion Power ausgestattet, um alle diese Umbrüche bewältigen zu können. Erwachsen werden heißt, sich Stück für Stück von kindlichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen zu verabschieden; lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen; vom kleinen Mädchen zur jungen Frau zu werden; verschiedene körperliche und seelische Entwicklungen zu erleben und zu verarbeiten, die man sich selbst nicht ausgesucht hat. In der Pubertät passieren sie einfach, und man muss sich irgendwie damit arrangieren.
Auch deshalb sind mütterliches und väterliches Wohlwollen so wichtig. Man kann davon ausgehen, dass jedes pubertierende Mädchen versuchen wird, es so gut wie möglich hinzubekommen, erwachsen zu werden. Aber nicht immer ist das so einfach, mit der eigenen körperlichen und psychischen Entwicklung Schritt zu halten und sich entsprechend verantwortungsbewusst zu verhalten. Im Gegenteil: Manche Anläufe, sich vernünftig und erwachsen zu benehmen, scheitern an den eigenen chaotischen Gefühlszuständen in der Pubertät. Andere enden mit Streit und Tränen. Oder es fehlt schlichtweg die Erfahrung und Routine, bestimmte Situationen oder Aufgaben erfolgreich und unaufgeregt zu managen. Ob zu Hause, in der Schule oder im Freundeskreis: Solange Jugendliche pubertieren, müssen sie immer wieder Kritik, Enttäuschungen und Rückschläge einstecken, in der Welt der Erwachsenen, aber auch in der Klasse oder in der Clique unter Gleichaltrigen.
Jugendliche können gar nicht genug Unterstützung bekommen
Deshalb können Mädchen im Elternhaus gar nicht genug Wertschätzung bekommen. Trotz aller Widerborstigkeit sind sie sehr empfindlich und leicht verletzbar. Kein Wunder: Sie befinden sich in einem sensiblen Spannungsfeld zwischen Kind- und Erwachsensein. Die Pubertät ist eine bewegte, verunsichernde Zeit des Umbruchs; ein Prozess, der bei Mädchen etwa zwischen 9 und 13 Jahren beginnt und mit dem Übergang in die Adoleszenz oder auch Nachpubertät im Alter von etwa 17 Jahren endet. Eltern sind also als Begleiter und Unterstützer eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses gefragt, der nicht von heute auf morgen geschieht, sondern Zeit braucht und verschiedene Höhen und Tiefen durchläuft, bevor er wirklich abgeschlossen ist, heutzutage ist das meist mit Anfang 20 der Fall. Die Jahre des Erwachsenwerdens sind für Eltern und ihre Töchter eine besondere und manchmal auch anstrengende Zeit.
Es ist eben nicht leicht, selbständig zu werden, wenn man das Gefühl hat, Vater oder Mutter würden einem alles verbieten, was auch nur ansatzweise Spaß macht. Wenn man sich eigentlich schon wie 18 fühlt, aber trotzdem zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein soll. Und wenn man sich sogar am Wochenende an elterliche Vorgaben halten soll, die aus Sicht des jugendlichen Party-Volkes so gar keinen Sinn ergeben.
Stellen Sie sich vor, Sie wollten endlich durchstarten, und dann sind da zwei Leute, die Ihnen nur Steine in den Weg legen. Und gleichzeitig fühlen Sie sich so klein und hilflos und spüren ganz deutlich, dass Sie trotz allem auf diese beiden angewiesen sind. Das kann sehr frustrierend und verunsichernd sein und macht oft auch ungemein wütend.
Selbstzweifel und schlechtes Gewissen: Eltern haben’s auch nicht leicht
Aus Sicht der Eltern ist das Familienleben mit einer pubertierenden Tochter ebenfalls eine Gratwanderung. Wie soll man das Vertrauen aufbringen, dass die Tochter schon weiß, was gut für sie ist und was nicht, wenn sie gleichzeitig mitten im Winter in hauchdünnen Nylonstrumpfhosen und hochhackigen Pumps aus dem Haus will, um durch den Schnee zur nächsten Bushaltestelle zu stöckeln?
Haben Sie schon mal versucht, jemandem eine Grenze zu setzen, der felsenfest davon überzeugt ist, bereits vollkommen erwachsen zu sein? Was soll man als Mutter oder Vater dazu sagen, dass die 14-jährige Tochter in den Osterferien allein mit ihrer Freundin nach Berlin fahren will, aber zu Hause einen größeren Lebensmittel-Einkauf nicht übernehmen kann, weil ihr dazu nach eigenen Worten der Überblick über den Haushalt fehlt? Pubertät ist eine Zeit, die nicht nur den jugendlichen Erfindungsreichtum befeuert, sondern auch das kreative Reaktionsvermögen bedrängter Eltern herausfordert. Das strengt an, ist nervig, ärgerlich, frustrierend.
Wie schnell hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man etwas verbietet, was andere Eltern doch offenbar, ohne mit der Wimper zu zucken, erlauben? Elterliche Selbstzweifel, die Sorge, etwas falsch zu entscheiden, unangemessen zu reagieren oder in der Rolle der Erziehenden versagt zu haben, das alles gehört zu den Nebenwirkungen der Pubertät, mit denen Sie sich als Eltern auseinandersetzen und manchmal auch plagen müssen.
Denn Jugendliche wollen und werden ausprobieren, was geht, um sich selbst zu spüren und zu finden. Sie provozieren, sie ziehen sich zurück, sie gehen erste intensive Freundschaften und Beziehungen ein und tun gleichzeitig so, als sei das Leben zu Hause vollkommen uninteressant und unwichtig. Sie erleben Abenteuer, Erfolge und Niederlagen. Und bei Mutter und Vater checken sie aus, wie weit man gehen kann, wenn man verhandelt, widerspricht, kämpft, Absprachen für ungültig erklärt oder wichtige Dinge verschweigt. Alle diese Experimente, Konflikte und Lernprozesse, die Jugendliche in der Pubertät erleben und ausfechten, dienen letztendlich nur dem Zweck, auf eigenen Beinen zu stehen.
Reduziert man die elterliche Rolle auf das Wesentlichste, dann stellt Sie die Pubertät vor die Aufgabe, Ihre heranwachsende Tochter bei der Suche nach sich selbst, einem starken Selbstbewusstsein, einer eigenen Identität zu begleiten und zu unterstützen. Mädchen wollen sich in ihrer neuen Rolle als junge Frau zurechtfinden und wohl fühlen können. Sie benötigen also nicht nur Unterstützung dabei, zu lernen, wie man sich vernünftig und erwachsen verhält, sondern sie brauchen auch liebevollen Zuspruch auf dem komplizierten Weg der körperlichen Veränderungen vom Kind über die pubertierende Jugendliche zur jungen, geschlechtsreifen Frau.
Auch wenn coole Mädchen oft das Gegenteil spiegeln: Eigentlich sind Eltern jetzt noch einmal so richtig gefragt
Nun machen es viele Töchter ihren Eltern nicht unbedingt leicht, Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Sie kommen nicht einfach frisch gestylt aus dem Badezimmer auf Mutter oder Vater zu und sagen: «Liebe Mama, lieber Papa, ich möchte so gern unabhängig und selbstbewusst in meiner weiblichen Rolle werden. Ihr wisst darüber so viel mehr als ich und habt schon so viele gute und schlechte Erfahrungen gemacht, ich tue gern alles, was ihr sagt!»
Das wäre ja auch komisch. Dann hätte man als Mutter oder Vater so gar nichts von der Pubertät, wo bleibt denn da der Austausch der Generationen? Stellen Sie sich vor, dass jede Meinungsverschiedenheit, die Sie zu Hause erleben, jeder kleine oder große Zickenalarm, mit dem Sie konfrontiert sind, jeder Ärger, den Sie Ihrer Tochter gegenüber hegen, auf einen schlichten, aber gut verschlüsselten Appell hinweist, der im Prinzip lautet: «Helft mir, eine erwachsene Frau zu werden.» Dies ist die zentrale Botschaft, die Ihnen Ihre Tochter, gut getarnt, bei jeder Gelegenheit aufs Tablett packt.
Bei dem Chaos, das manchmal schneller, als man denkt, durch die Pubertät über eine Familie hereinbrechen kann, fällt es Eltern zuweilen schwer, diese zentrale Botschaft im Auge zu behalten und dazu noch einen kühlen Kopf zu bewahren. Beides hilft aber, um der Tochter auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben etwas zuzutrauen und eine gute Begleitung zu sein.
Um die vielen verschiedenen Entwicklungsschritte und die damit verbundenen Gefühle von Eltern und Töchtern zu entwirren, haben wir dieses Buch geschrieben.
Wir haben uns bemüht, Ihnen Handlungsorientierungen und möglichst konkrete Ratschläge zu vermitteln. Aber jeder Mensch, jeder Konflikt ist so einzigartig, dass sich Situationen zwischen Töchtern und Eltern vielleicht ähneln, aber niemals exakt wiederholen. Insofern gibt es keine jederzeit anwendbaren Rezepte, aber viele Ideen und Denkanstöße, wie Sie als Mutter oder Vater reagieren können.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie und Ihre Tochter der Pubertät mit Gewinn und Lebensfreude begegnen können, mal gemeinsam, mal jeder für sich. Und dass Sie auf diesem spannenden, komplizierten, manchmal schwierigen, manchmal albernen und lustigen Weg immer daran denken: Nobody is perfect, erst recht nicht pubertierende Töchter und deren Eltern!
Das erste Kapitel befasst sich mit Mädchen in der Entwicklungsphase Pubertät, es handelt von körperlichen und psychischen Veränderungen, Schönheitsidealen, Gefühlen und der Suche nach dem Selbst, von besten Freundinnen und Zickenalarm. Wenn Sie als Eltern verstehen, was Ihre Tochter bewegt, können Sie ihr gelassener begegnen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Traumjob Eltern, mit der Rolle, die Sie als Mutter oder Vater einer pubertierenden Tochter auszufüllen haben, ob alleinerziehend oder in einer Beziehung lebend, und mit der Lebenssituation, in der Eltern mit der Pubertät ihrer Töchter konfrontiert werden.
Im dritten Kapitel steht im Vordergrund, wie Eltern die vielen verschiedenen Herausforderungen des Alltags meistern können. Was ist zu tun, wenn es immer wieder Streit gibt? Wann ist es ratsam, die Zügel anzuziehen, und wann sollte man sich besser auf Samtpfötchen zurückziehen? Wie übersteht man Kämpfe um Taschengeld, Computerzeiten und Party-Marathons?
Das vierte Kapitel handelt von den Risiken der Pubertät, von Schulverweigerung, Drogenmissbrauch, Online-Sucht und manchem mehr.
Entwicklungsphase Pubertät
Mit wie viel Jahren die Pubertät beginnt und endet, wann und in welcher Ausprägung die körperlichen Veränderungen passieren und wie sich ein Mädchen dann jeweils in Beziehung zu seiner Mutter und seinem Vater verhält, das ist individuell so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Manche Mädchen verabschieden sich ziemlich unaufgeregt von ihrer Kindheit und wachsen ganz selbstverständlich in ihre neue Rolle als junge Frau hinein. Andere suchen die Auseinandersetzung mit so ziemlich allen Menschen, die ihren Weg kreuzen, um die Kindheit hinter sich zu lassen und mehr über sich und das Leben der Erwachsenen zu erfahren. Aufgrund dieser Einzigartigkeit verzichten einige Wissenschaftler darauf, die Pubertät in Zeitgrenzen einzuteilen. Sie sprechen von einem einzigen, fließenden Prozess, der im Alter von etwa 10 Jahren beginnen und mit über 20 Jahren beendet sein kann. Wir dagegen ziehen eine grobe zeitliche Einteilung der körperlichen und psychischen Entwicklungsphasen vor, weil sich so besser nachvollziehen lässt, wie sich junge Mädchen schrittweise körperlich, emotional und sexuell entwickeln.
Auf zu allerlei Abenteuern
Die Pubertät bei Mädchen, ein Überblick
Jugendliche in Deutschland kommen immer früher in die Pubertät. So lag das Durchschnittsalter bei Mädchen zum Zeitpunkt ihrer ersten Menstruation vor knapp hundert Jahren noch bei 14,5 Jahren, heute setzt der Zyklus im Durchschnitt mit 12 Jahren ein, dann haben bereits 43 Prozent aller Mädchen ihre erste Regel bekommen. Einen ähnlichen Trend erkennen die Wissenschaftler übrigens auch bei Jungen, die zum Zeitpunkt ihres ersten Samenergusses ebenfalls etwa 12 Jahre alt sind. Vermutlich hängt die früher einsetzende Geschlechtsreife mit der guten Ernährungssituation sowie dem durchweg hervorragenden Gesundheitszustand von Mädchen und Jungen zusammen. Als nachgewiesen gilt: Je mehr Körperfett im weiblichen Körper vorhanden ist, desto eher setzt auch die erste Regelblutung ein.
Im Großen und Ganzen verläuft der Pubertätsprozess bei Mädchen in drei Stadien:
Die Vorpubertät, die bei Mädchen etwa zwischen dem 9. und 11. Lebensjahr liegt; bei einigen aber auch erst zwischen 10 und 12 Jahren;
Die Kernphase der Pubertät, die sich etwa vom 12. oder 13. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr erstreckt;
Die Nachpubertät oder auch Adoleszenz, die mit ihren Nachwirkungen sogar noch über das 20. Lebensjahr hinausgehen kann.
«Puber» ist lateinisch und heißt Schamhaar, «pubertas», ebenfalls lateinisch, bedeutet Geschlechtsreife. Der Begriff Pubertät im engeren Sinn orientiert sich also hauptsächlich an den körperlichen und sexuellen Veränderungen. Der Begriff Adoleszenz dagegen bezieht sich eher auf den seelischen und emotionalen Prozess und wird häufig stellvertretend für die Phase der Nachpubertät verwendet, eine Zeit, in der die körperliche Entwicklung zwar weitgehend abgeschlossen ist, die emotionale Loslösung von den Eltern jedoch noch nicht vollständig bewältigt wurde.
Wie schon erwähnt verläuft jede Pubertät individuell, dennoch können sich Eltern, was die körperlichen Veränderungen betrifft, an bestimmten Durchschnittswerten orientieren:
Die Schambehaarung wächst von etwa 8,5 bis 12,5 Jahren.
Das Brustwachstum beginnt im Alter von 9 bis 13,5 Jahren.
Der Weißfluss, der auf Pubertätshormone hinweist, setzt mit etwa 9,5 bis 15,5 Jahren ein.
Die erste Menstruation haben Mädchen im Alter von 10 bis 15,5 Jahren, die meisten mit 11, 12 oder 13 Jahren.
Die körperliche Entwicklung ist mit ungefähr 17 Jahren abgeschlossen.
Ganz wichtig zu wissen ist: Innerhalb dieser Entwicklungsspannen hat jedes Mädchen sein eigenes Tempo, und das ist gut so. Sind die Freundinnen schon weiter oder noch nicht so weit, so kann das bei manchen Mädchen und damit möglicherweise auch bei Ihnen als Eltern die Besorgnis auslösen, die Entwicklung verlaufe nicht «normal». Doch wie man oben sieht, sind die Zeitspannen sehr groß und weit gefasst, sodass nur in seltenen Fällen etwas mit der Entwicklung vielleicht wirklich nicht stimmt (siehe Kasten). «Normal» ist hier jedenfalls ein sehr weites Feld.
In der Pubertät verändert sich das Aussehen und damit auch das Körperempfinden. Dieser Prozess ist kompliziert und kostet die meisten Mädchen eine Menge Energie, da er einerseits eng mit der Entwicklung von Selbstwertgefühlen verknüpft ist, andererseits aber auch sehr häufig von Selbstzweifeln, Schamgefühlen und einer ausgeprägten persönlichen Empfindlichkeit begleitet wird. Für die meisten Mädchen ist es jetzt wichtig, möglichst «normal» zu sein und sich über die vielen Veränderungen mit Freundinnen austauschen zu können. Ein sehr früher oder besonders später Beginn der Pubertät kann ein Anlass zu großem Kummer sein, da die meisten Mädchen unter dem Druck stehen, genau wie die anderen sein zu wollen.
Insofern sollten Sie Ihre Tochter besonders bei einer verzögerten Pubertät seelisch unterstützen, um eventuell belastende Minderwertigkeitsgefühle aufzufangen. Tröstend sollte sein, dass jede Pubertät einzigartig ist und bei manchen Mädchen einfach später beginnt. Und oft holen sie dann innerhalb weniger Monate alles auf, was ihnen die Freundinnen voraushaben. Sprechen Sie darüber, dass der Körper keine Maschine mit An- und Ausschaltknöpfen ist, sondern ein kompliziertes lebendiges Wunderwerk, das nach eigenen Regeln funktioniert, die man nicht immer sofort versteht, die aber immer einen Sinn ergeben!
Aus medizinischer Sicht können Sie sich an einen Kinder- und Jugendgynäkologen wenden, wenn die ersten Pubertätszeichen bei Ihrer Tochter bereits vor dem 8. Lebensjahr auftreten, wobei die Ursache der «Pubertas praecox» in 80 Prozent der Fälle ungeklärt bleibt, oder wenn im Alter von 14,5 Jahren noch keinerlei Anzeichen einer Brustentwicklung zu sehen sind.
Die Vorpubertät
Der Eintritt in die Pubertät ist bei Mädchen eng mit einer erhöhten Selbstbeobachtung des eigenen Körpers verknüpft. Bei jüngeren Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren ist diese Beobachtung oft noch recht kindlich und unbefangen, bei älteren Mädchen kann sie eine Menge widersprüchlicher Gefühle auslösen. Rein biologisch gesehen ist es vor allem die verstärkte Produktion des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen, welche die verschiedenen pubertären Entwicklungsprozesse auslöst.
Viele Mädchen brauchen jetzt Zeit für sich, wollen nicht mehr einen so engen Kontakt zu Eltern und Geschwistern, sondern einfach ihre Ruhe haben! Rumms, ist die Zimmertür zu, schwupp, die Musik laut aufgedreht. Und Stress droht, wenn man als Mutter oder Vater eine Viertelstunde später in der Tür steht und anmahnt, dass die Hausaufgaben noch nicht erledigt sind oder der Hamsterkäfig mal wieder saubergemacht werden müsste.
Den neuen, für Sie zunächst noch fremden Wunsch nach Rückzug und Intimität sollten Sie akzeptieren. Dies zeigt das Bedürfnis nach Alleinsein, um eigenständiger zu werden. Noch vor kurzem hat das kleine Mädchen so ziemlich jedes Erlebnis mit Mama oder Papa geteilt, nun demonstriert die verschlossene Zimmertür einen jungen Menschen, der sich im Zuge der Ablösung in den nächsten Jahren zunehmend vor seinen Eltern verschließen wird. Für Sie als Eltern mag dies ungewohnt sein. Doch andererseits: Ist es nicht auch toll, dass sich Ihre Tochter erste Eigenständigkeiten zutraut? Dies ist auch Ihr Verdienst, und es ist schön, dass Sie Ihr Kind als Mutter oder Vater schon so weit begleitet haben.
Die Sache hat allerdings einen Haken, den Sie als Eltern vermutlich in der nächsten Zeit wahrnehmen werden: Wer sich auf die eigenen Beine stellen will, muss Widerstand gegen das entwickeln, was Erwachsene sagen. Man will sich nicht mehr alles von seinen Eltern gefallen lassen! So einfach ist das. Mit zunehmender Eigenständigkeit bekommen pubertierende Mädchen immer mehr Lust, sich von ihrer Familie weg zu orientieren, auf zu neuen Abenteuern, ob in der Phantasie oder im wirklichen Leben. Jetzt kommt die intensive Zeit der besten Freundinnen, die möglichst alles zusammen machen, sogar aufs Klo gehen. Man sitzt nebeneinander in der Schule, geht gemeinsam zum ersten Mal allein shoppen, schminkt und stylt sich gegenseitig. Oft schwärmen Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren auch für einen ganz bestimmten Jungen aus ihrer Klasse oder der Parallelklasse. Insgesamt interessieren sie sich immer mehr für Gleichaltrige und weniger für das, was ihnen die Eltern erzählen oder mit ihnen unternehmen wollen.
Die sexuelle Entwicklung ist ein seelischer und körperlicher Prozess, der schon im Säuglingsalter beginnt, und zwar mit den ersten sinnlichen Erfahrungen beim Stillen oder dem schönen Gefühl, nackt nach Herzenslust auf dem Wickeltisch strampeln zu dürfen. Kinder haben ein angeborenes sexuelles Potenzial und gleiche oder ähnliche sexuelle Reaktionen wie Erwachsene. Kleine Jungen können zum Beispiel eine Erektion haben oder Mädchen lustvolle Gefühle empfinden, wenn sie auf einem Kissen herumrutschen. Aber Kinder schreiben diesen Erlebnissen eine ganz andere Bedeutung zu als Erwachsene: Für Kinder ist sie einfach Teil einer spontanen, neugierigen, lustvollen Sinnlichkeit, die sich auf den ganzen Körper bezieht. Schon im 2. Lebensjahr fangen Kinder an zu verstehen, dass es zwei Geschlechter gibt und dass man Mädchen bzw. Frauen und Jungen bzw. Männer aufgrund bestimmter Eigenschaften und Merkmale unterscheiden kann. Interessanterweise sind es in diesem Alter meist die Haare und Bekleidung, anhand derer kleine Kinder die Geschlechter unterscheiden. Erst mit etwa 5 Jahren begründen die Kinder Geschlechtszuordnungen mit genitalen Unterschieden. Im Vorschulalter von etwa 5 bis 6 Jahren sollten Kinder Begriffe für ihre Gefühle, ihren Körper und ihre Genitalien kennen, die allgemeinverständlich sind und ein dem Alter angemessenes Wissen über Zeugung, Schwangerschaft und Geburt haben. Insgesamt beschäftigen sich Kinder zwischen 3 und 6 Jahren auf unterschiedlichste Art und Weise mit den Geschlechterrollen. Sie beobachten zum Beispiel zu Hause, was der Vater als Mann tut und wie sich die Mutter als Frau verhält. Alles, was das Kind über die Aufgaben- und Rollenverteilung von Frauen und Männern im eigenen Haushalt erfährt, kombiniert es im Großwerden mit dem, was es selbst über das Verhalten und die Gefühle als Junge oder Mädchen erfährt. Das Erleben elterlicher Beziehungen spielt für die Sexualerziehung der Kinder ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Kinder beobachten zum Beispiel, wie zärtlich, respektvoll, ungezwungen usw. die Eltern bzw. Erwachsenen miteinander umgehen. Gegen Ende der Kindergartenzeit, spätestens zu Beginn der Grundschule ist es dann so weit: Die meisten Mädchen und Jungen konzentrieren sich auf das eigene Geschlecht und grenzen sich dazu deutlich vom anderen Geschlecht ab. Mit dem Eintritt in die Pubertät wird diese Abgrenzung aufgehoben, ein neues Interesse am anderen Geschlecht erwacht. Die sexuelle Entwicklungsphase, die nun folgt, ist ein Abschied von der Kindheit und der Eintritt ins Erwachsenenalter.
Die Pubertät
Mit etwa 12, 13, 14 Jahren, dem Beginn der eigentlichen Pubertät, läuft die Hormonproduktion bei Mädchen auf Hochtouren. Der Körper nimmt deutlich weiblichere Formen an, was für viele Mädchen ein großes Problem ist. Heftiger als zuvor brechen sich Launen und Stimmungsschwankungen Bahn und machen den Alltag für die Mädchen selbst, aber auch für ihre Geschwister und Eltern häufig zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Lachanfälle, Wutausbrüche, Tränen: Das Leben tobt, und nicht immer versteht man, ob und was man gerade falsch gemacht hat.
Viele Mädchen beginnen jetzt sich auszuprobieren und sind neugierig darauf, was es mit der Liebe auf sich hat. Sie schwärmen für Jungen, aber nicht mehr nur in ihrer Phantasie. Sie stylen und schminken sich, um Aufmerksamkeit zu erregen, sie flirten, verlieben sich, bekommen ihren ersten Kuss, machen körperliche Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, erleben die ersten Enttäuschungen, Trennungen und Liebeskummer. Aber es gibt auch die Mädchen, die angesichts der vielen ungewohnten Gefühle und Veränderungen erst einmal vorsichtig werden, die eher schüchtern sind und sich lieber noch keine Flirts oder einen Freund zutrauen wollen. Und beides ist vollkommen normal und angesichts der vielen Situationen und Bewährungsproben angemessen.
Insgesamt wird die Beschäftigung mit dem eigenen Körper und mit dem Aussehen jetzt viel intensiver als in der Vorpubertät, gleichzeitig bekommen die Fragen rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität eine neue Bedeutung und Ernsthaftigkeit. Wie sehe ich aus? Ist mein Busen okay? Bin ich zu dick? Will ich schon einen Freund haben? Weiß ich genug über Verhütung?
Für Eltern ist es oft nicht leicht, das plötzliche und sprunghafte Erwachsenwerden ihrer Kinder zu akzeptieren, geschweige denn, sich darüber zu freuen. Eigentlich würden sie ihrer Tochter gerne mehr Freiheiten zugestehen, aber bitte ein bisschen kontrolliert. Schließlich möchte man sie vor schlechten Erfahrungen, Enttäuschungen und Niederlagen bewahren. Doch da kann es durchaus sein, dass Sie die Rechnung ohne ihre pubertierende Tochter gemacht haben. Die wird nämlich ziemlich bald merken, woher der elterliche Wind weht. Der Tochter geht es ja gerade darum, endlich mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben zu bekommen. Sie will sich nicht mehr in ihre eigenen Entscheidungen hineinreden lassen. Auch nicht ein bisschen!
Diese Phase, in der es um Eigenständigkeit und die Entscheidungsgewalt über das eigene Leben geht, kann die Eltern und Jugendlichen stark fordern, denn nun treten Meinungsverschiedenheiten und Konflikte klarer und heftiger hervor als in den Monaten oder Jahren zuvor. So kann es zum Beispiel sein, dass sich Ihre pubertierende Tochter in den extremsten Varianten weiblichen Verhaltens ausprobiert und sich dabei, zumindest Ihrer Meinung nach, klischeehaft verhält. Auch das ist typisch Pubertät!
Man kann sich bildhaft vorstellen, dass die Mädchen als Metapher fürs Erwachsenwerden einen neuen riesigen Raum betreten. Dieser Raum bietet unendlich viele Verhaltensmöglichkeiten, Plätze und geheimnisvolle Ecken, an denen man sich aufhalten kann. Um ihn zu erobern, müssen sich viele Mädchen erst einmal orientieren. Das tun sie häufig, indem sie die Grenzen dieses Raumes austesten, in die dunkelsten Ecken schauen und markante Plätze inspizieren, die ihnen auf ihrer Entdeckungstour begegnen. Dass sie sich in diesem neuen Raum manchmal extrem klischeehaft stylen und verhalten, ist sozusagen Teil dieses Eroberungsprozesses.
Die Adoleszenz (Nachpubertät)
Mit etwa 17 Jahren sind die körperlichen Veränderungen weitgehend abgeschlossen, und wahrscheinlich kann Ihre Tochter Ihnen nun im wahrsten Sinn des Wortes auf Augenhöhe begegnen. Nun beginnt die mitunter recht lange Zeit der Nachpubertät oder Adoleszenz, die bis über das 20. Lebensjahr hinausgehen kann und den rein geistigen und emotionalen Prozess umfasst, der mit der Ablösung von Ihnen als Eltern verbunden ist.
Dass heute viele junge Erwachsene mit Mitte oder Ende 20 noch keine feste berufliche Position mit einem entsprechenden Status innehaben und damit oft auch noch nicht über ein eigenes geregeltes Einkommen verfügen, macht diese teilweise jahrelange Ablösungsphase im Gegensatz zu früheren Generationen manchmal zu einer Belastungsprobe für Eltern und Kinder. Es hat sich immer mehr eingebürgert, dass junge, bereits ausgebildete Erwachsene noch sozial und finanziell abhängig von ihren Eltern sind (Generation Praktikum). Das ist eine schwierige Situation, in die unsere Arbeitswelt Jugendliche und ihre Eltern heute bringt.
Die große Herausforderung der Adoleszenz besteht für Eltern und Kinder darin, sich gemeinsam darauf vorzubereiten, dass das Kind eines Tages das Haus verlässt, möglichst ausgestattet mit einem sicheren Selbstvertrauen und der Zuversicht, das Leben getrost in die eigenen Hände nehmen zu können. Egal, ob es darum geht, sich für einen bestimmten Ausbildungsweg zu entscheiden, einen Beruf zu ergreifen, eine dauerhafte Beziehung einzugehen oder ein selbstbestimmtes Leben als Single zu führen.
Falls Sie und Ihre Tochter auf eine turbulente und anstrengende Pubertät zurückblicken, so kann es nun gut sein, dass die ewigen Auseinandersetzungen auf einmal spürbar nachlassen. Doch die Nachpubertät garantiert nicht unbedingt Ruhe und Frieden im Haus. Auch mit 17, 18 Jahren oder später können zwischen Jugendlichen und ihren Eltern ordentlich die Fetzen fliegen, manchmal gerade dann, wenn die Pubertät vorher einigermaßen geordnet und ruhig verlaufen ist.
Nehmen Sie auch diese Konflikte als positives Zeichen wahr, auch wenn sie anstrengend sind. Sie zeigen, dass Ihre Tochter eigenständig denkt, selbstbewusst handelt und als Erwachsene anerkannt und behandelt werden möchte. Während es für ein 14-jähriges Mädchen vielleicht noch in Ordnung war, hinsichtlich ihres Outfits und Stylings kritisiert und korrigiert zu werden, wird sich das eine 17-Jährige nicht mehr gefallen lassen. Und auch, welchen Freund sie sich aussucht, möchte sie gern allein entscheiden. Warum auch nicht?
Ihre Aufgabe als Eltern besteht nun darin, Ihrer Tochter immer mehr Freiheiten einzuräumen. Denken Sie daran: Ihre Tochter ist kurz davor, sich vollkommen abzunabeln und ihr eigenes Leben aufzubauen. Sie ist es, die sich mit ihrem Freund wohl fühlen will, sie ist es, die ihn küsst. Da ist die elterliche Meinung nicht mehr gefragt, oder wollen Sie ihn etwa auch küssen? In der Adoleszenz geht es darum, die allerletzten Pubertätsgefechte auszukämpfen und durchzustehen. Die Pubertät ist zu Ende, wenn Ihre Tochter sich weitgehend unabhängig fühlt und gelernt hat, eigenverantwortlich zu handeln: in Bezug auf ihre eigenen Bedürfnisse, in Bezug auf die Beziehungen zu anderen Menschen und in Bezug auf Ausbildungs- und Berufsentscheidungen.
Das bedeutet nicht, dass der Rat der Eltern von nun an unerwünscht oder verboten ist. Worum es geht, ist die Selbständigkeit und Autonomie Ihrer Tochter, die jetzt gewahrt werden sollte. Ratschläge auf Augenhöhe, vielleicht sogar die Bitte um einen elterlichen Rat, sind aus Sicht der erwachsenen Tochter verständlicherweise etwas vollkommen anderes als ungebetene, einmischende Ratschläge aus heiterem Himmel.
Mit dem Erreichen der Volljährigkeit Ihrer Tochter haben Sie als Eltern ohnehin keine gesetzliche Grundlage mehr, ihr ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben oder zu verbieten. Ihre Tochter trägt nun die volle Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Sie darf alle Entscheidungen selbst treffen, auch über ihre Schul- und Ausbildungslaufbahn, sie kann Verträge abschließen, Kredite aufnehmen, sie darf uneingeschränkt wählen gehen oder Auto fahren. Kurzum: Sie gilt juristisch als erwachsen, was aber auch bedeutet, dass sie nun nach dem allgemeinen Strafrecht für mögliche Straftaten belangt werden kann. Auch deshalb ist es wichtig, dass Heranwachsende mit dem Erreichen ihrer Volljährigkeit bestimmte Kompetenzen erworben haben.
Von Kopf bis Fuß im Umbruch
Die körperlichen Veränderungen und was sie für Mädchen bedeuten
Die körperlichen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf das eigene Aussehen und Selbstbewusstsein spielen bei Mädchen in der Pubertät eine zentrale Rolle. Im Prinzip sind sie rund um die Uhr ein Thema. «Hilfe, ich habe einen riesigen Pickel, und gerade heute, wo ich das Referat in Geschichte halten muss» (… dabei können Sie ohne Ihre Brille nichts Auffälliges entdecken …), «Ich muss schnell duschen, meine Haare sind schon wieder fettig» (… hat sie sich nicht gerade erst gestern Abend ihre Haare gewaschen? …), «Ich esse heute nichts mehr, meine Oberschenkel sind viel zu dick!» (… Entschuldigung, bei Kleidergröße 36 muss man diese Diätanwandlung nicht verstehen, oder? …). Anstrengend ist es, dieses eitle pubertäre Drehen um sich selbst! Als wenn es nichts Wichtigeres im Leben gäbe!
Die Sache ist aber: Für Ihre Tochter gibt es in bestimmten Phasen tatsächlich nichts Wichtigeres als Pickel, Haare, Busen, Bauch, Beine, eine gute Figur und die ewig wiederkehrende Frage: Wie sehe ich aus? Sich selbst schön zu finden, alle diese Veränderungen in den verschiedenen Körperzonen anzunehmen und sich damit wohl zu fühlen, um dann darauf ein gesundes weibliches Selbstbewusstsein aufzubauen, das ist eine der großen Herausforderungen für Mädchen in der Pubertät.
Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Jugendsexualität 2010 hat das Körperempfinden von Mädchen und Jungen zwischen 14 und 17 Jahren untersucht und dabei festgestellt, dass sich die Einstellung zum eigenen Körper deutlich nach dem Geschlecht unterscheidet. Während für Jungen Fitness eine wichtige Rolle spielt, ist es bei Mädchen vor allem ein gestyltes Äußeres. Gleichzeitig sind Mädchen sehr viel häufiger von den gesellschaftlich vorgelebten Schönheits- und Schlankheitsnormen betroffen. Ein Viertel aller befragten Mädchen empfindet sich als zu dick, und nur sehr wenige meinen, dass sie zu dünn seien. Nicht einmal die Hälfte aller Mädchen in der befragten Altersgruppe mag der Aussage «Ich fühle mich wohl in meinem Körper» zustimmen.
Die Studie hat auch einen Zusammenhang zwischen dem Körperempfinden der Jugendlichen und der Atmosphäre im Elternhaus beobachtet. Je mehr sich Mädchen zu Hause ernst genommen fühlen, desto positiver ist ihr Empfinden gegenüber dem eigenen Körper. Von den Eltern ernst genommen zu werden und ein gutes Körpergefühl und Selbstbewusstsein zu haben, dies hängt also eng miteinander zusammen.
Das heißt: Sie können als Mutter oder Vater Ihre Tochter unterstützen, indem Sie die pubertäre Besorgnis um das eigene Aussehen nicht als eitles Getue abtun, sondern erkennen, dass diese Phase ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem gesunden weiblichen Selbstbewusstsein ist. Natürlich müssen Sie deshalb nicht ständig vor der verschlossenen Badezimmertür stehen oder ein Shampoo nach dem anderen kaufen. Jetzt ist es gefragt, die Tochter für die körperlichen Veränderungen, mit denen sie sich gerade so schwer tut, wertzuschätzen. Denn als Pubertierende steht sie unter einem massiven Druck, den überall verbreiteten weiblichen Schönheitsidealen möglichst nahe zu kommen.
Im Verlauf der Pubertät rücken erfahrungsgemäß nach und nach verschiedene Körperzonen in den Fokus des pubertierenden Mädchens. Ein 11-jähriges Mädchen zeigt seiner Mutter vielleicht stolz das erste Schamhaar oder die größer werdenden Brustwarzen, ein 13-jähriges Mädchen hat möglicherweise Fragen zur Menstruation oder braucht Trost, weil es so weh tut. Je nach Alter und Beziehung zu Ihnen als Eltern kann Ihre Tochter das Bedürfnis verspüren, mit Ihnen über ihren Körper und die vielen komischen und ungewohnten Dinge, die da gerade passieren, zu sprechen oder aber auch gerade nicht.
Hormone, die Botenstoffe der Pubertät,
das Gehirn, eine Baustelle,
Haut und Haare, ständig unter Beobachtung,
Achsel- und Schamhaare, nicht sehr beliebt,
der Busen, zu groß, zu klein, genau richtig?
Beine und Hüften, die weiblichen Rundungen,
die weiblichen Geschlechtsorgane, viel zu entdecken,
Weißfluss, Menstruation und Zyklus, alles Frauensache.
Wie ein Mädchen mit seinem sich wandelnden Körper zurechtkommt, auch das ist individuell so verschieden wie der Verlauf der Pubertät. Was individuell nicht verschieden ist, ist das meistens nicht direkt formulierte, aber trotzdem vorhandene Bedürfnis aller pubertierenden Jugendlichen, von ihren Eltern geliebt und ernst genommen zu werden. Mutter und Vater stehen hier vor der Aufgabe, der mit sich und ihrem Aussehen hadernden Tochter das Gefühl zu geben, ein ganz besonderes Mädchen zu sein, das auf seine ganz besondere Art attraktiv und schön ist und außer ihrem Aussehen noch viele andere Eigenschaften hat, die es zu einem interessanten Mädchen bzw. einer interessanten jungen Frau machen. Dabei nehmen die Eltern im übertragenen Sinn eine ähnlich unermüdliche Rolle ein wie der Zauberspiegel im Märchen, der jeden Tag mehrmals gefragt wird: «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?» Und die Eltern antworten: «Du bist für uns die Schönste (Klügste, Sportlichste, Attraktivste …) im ganzen Land …»
Wir haben auf den nächsten Seiten die wichtigsten körperlichen Veränderungen der Pubertät zusammengetragen und jeweils dazugestellt, was diese Veränderungen für die Mädchen bedeuten können (nicht müssen) und wie Sie sich als Eltern dazu verhalten können (nicht müssen).
Botenstoffe der Pubertät: die Geschlechtshormone
Verschiedene Hormone beeinflussen von Geburt bis ins hohe Alter die Entwicklung von Körper und Psyche, unser Aussehen und unsere Stimmung, und in der Pubertät läuft die Produktion der Geschlechtshormone auf vollen Touren. Bei Mädchen ist es vor allem das weibliche Geschlechtshormon Östrogen, welches die körperlichen Veränderungen auslöst. Als die Hormone in ihrer Rolle als Botenstoffe Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurden, war das übrigens eine medizinische Sensation, das Wort ist vom griechischen «hormao» abgeleitet und bedeutet «antreiben, anregen».
Hormone werden von Drüsen gebildet und wandern von dort als Botenstoffe in die Blutbahn. Während der Pubertät geben das Zwischenhirn und die Hirnanhangdrüse bestimmte Hormone an die Eierstöcke weiter. Dort sorgen diese Hormone dann dafür, dass die Eierstöcke aktiv werden und Östrogen und Progesteron bilden können. Beide Hormone sind für den weiblichen Monatszyklus wichtig.
Eine zentrale Rolle spielt das müde machende Hormon Melatonin, welches im jugendlichen Körper täglich ein bis zwei Stunden später gebildet wird als bei Erwachsenen. Während die meisten Erwachsenen also abends müde und kaputt ins Bett fallen, machen sich Jugendliche oft noch topfit auf den Weg zu einer Party. Doch die Strafe folgt auf dem Fuße: Am nächsten Morgen kommen Jugendliche, melatoninbedingt, nur schwer aus dem Bett. Erst gegen Mittag sieht die Welt wieder anders aus. Deshalb müsste, zumindest aus Sicht der Hormonforschung, die Schule für Jugendliche eigentlich erst zwei Stunden später anfangen.
Die Haut verändert sich, der Busen wächst, die Geschlechtsorgane entwickeln sich, und dabei kann vor Einsetzen der ersten Menstruation die Brust weh tun, der Bauch zwicken, oder es kann im Unterleib ziehen. Neben all diesen körperlichen Entwicklungsprozessen, die die Hormone jetzt antreiben, haben sie vor allem eine heftige «Nebenwirkung», nämlich Stimmungsschwankungen. Die sind für Mädchen häufig genauso überraschend, nervig und unverständlich wie für Eltern. Warum muss man plötzlich heulen, wenn doch gerade noch die Welt in Ordnung war? Woher diese Wut und Gereiztheit? Egal, man hat einfach schlechte Laune und kann eigentlich niemandem so richtig erklären, warum! Zum Glück hat man ab und zu auch heftige positive Gefühle wie nicht enden wollende Lachanfälle, totale Verliebtheit oder fröhlichen Übermut.
Sich über die guten Gefühle freuen, die schlechte Laune nicht persönlich nehmen und da sein, wenn die hormonelle Achterbahnfahrt mal besonders turbulent wird! Teilweise lassen sich die Wirkungen der Hormone eben wirklich nur schwer oder gar nicht kontrollieren.
Vielleicht hilft Ihnen dieses Wissen dabei, die eine oder andere Auseinandersetzung etwas gelassener zu nehmen. Es hat also wenig Sinn, der Tochter ihre Launen vorzuwerfen, sie kann schließlich nicht viel daran ändern. Worauf Sie aber achten können, ist ein respektvoller gegenseitiger Umgangston. Denn schlechte Laune und Stimmungsschwankungen hin oder her: Eltern müssen nicht als Blitzableiter herhalten.
Voll im Umbau: das Gehirn
Nicht nur die Hormone verursachen pubertäre Gefühls- und Verhaltensauffälligkeiten, auch das Gehirn hat einen Anteil daran. Mehr aus Zufall entdeckten Wissenschaftler mit Hilfe der Kernspintomographie (einem bildgebenden Verfahren zur Darstellung innerer Organe), dass sich jugendliche Gehirne während der Pubertät noch einmal grundlegend in ihrer Struktur verändern, sich tatsächlich morphologisch umbauen. Dies wiederum kann Auswirkungen auf das Denken, Fühlen und Handeln haben.
Sie können zum Beispiel unkonzentriert, vergesslich und zerstreut sein. Oder Probleme damit haben, außer den eigenen Bedürfnissen auch noch die Interessen anderer Familienmitglieder wahrzunehmen (das Fachwort dafür heißt «pubertärer Egozentrismus»). Auch die Fähigkeit, vorauszuplanen oder Entscheidungen zu treffen, kann vorübergehend beeinträchtigt sein. Das bedeutet im Alltag: Selbst ein einfacher Plan wie «erst chatte ich ein bisschen, dann lerne ich Mathe und danach räume ich mein Zimmer auf» kann während der pubertären Umbauarbeiten im Gehirn zu einem komplizierten Unterfangen werden, dessen Umsetzung häufiger auf der Strecke bleibt, als es Eltern lieb ist. Einmal mit dem Chatten angefangen, vergisst man nicht nur die Zeit, sondern auch die am nächsten Tag anstehende Mathearbeit.
Wenn Sie das Gefühl haben, die Planungsfähigkeit Ihrer Tochter sei gerade sehr eingeschränkt, dann fragen Sie Ihre Tochter, ob sie bei bestimmten Aufgaben oder Vorhaben Unterstützung gebrauchen kann. Überlegen Sie am besten gemeinsam, wie Ihr Part dabei aussehen könnte. Vielleicht stellen Sie zusammen einen Zeitplan auf? Oder helfen bei einer To-do-Liste, um bestimmte Ziele, die Ihre Tochter verfolgt, in konkrete Handlungsschritte zu unterteilen? Dann fühlt sich Ihre heranwachsende Tochter ernst genommen und kann selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen will. Und sie wird sich auch nicht wie ein kleines Kind behandelt oder kontrolliert fühlen, wenn Sie sich nach dem Stand der Planung erkundigen.
Ständig unter Beobachtung: Haut und Haare
Die hormonelle Umstellung beeinflusst auch Haut und Haare. Die erhöhte Ausschüttung vor allem der weiblichen Geschlechtshormone kann die Talgdrüsen vorübergehend zu einer Überproduktion anregen. Da die Talgdrüsen überall dort auf dem Körper sind, wo Haare und Härchen wachsen, fetten sie Haut und Haare in der Pubertät vermehrt ein. Verstopfen die einzelnen Drüsenausgänge, so entstehen unreine Haut, Mitesser und Pickel.
Weil übrigens in der Pubertät nicht nur auf der Haut, sondern im ganzen Körper Drüsen aktiv werden, kann es auch sein, dass pubertierende Jugendliche sehr viel stärker schwitzen als sonst.
Sie müssen jeden Tag aufs Neue den Kampf gegen Pickel und fettige Haare aufnehmen und peinlichst genau darauf achten, dass sie bloß keine Schwitzflecken bekommen. Der peniblen Selbstbeobachtung entgeht nichts! Auch Erwachsene werden genauestens unter die Lupe genommen, was Schweißbildung und Pickel betrifft, allen voran Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Eltern. Nicht jedes Mädchen ist übrigens gleichermaßen von Pickeln oder starkem Schwitzen betroffen, manche Mädchen haben kaum Probleme mit ihrer Haut.
Was aber bei den meisten auf jeden Fall ansteht, ist häufiges Verschwinden im Bad, stundenlanges Duschen, Haarewaschen und Föhnen sowie ausgiebiges Verwenden von Deo und Parfüms. Typisch Pubertät, das stimmt! Und gleichzeitig ist dieses Verhalten der Ausdruck eines ganz bestimmten Bedürfnisses, nämlich die vielen unkontrollierbaren Veränderungen, die der eigene Körper da gerade durchmacht, durch den gezielten und selbstbestimmten Einsatz von Kosmetika unter Kontrolle zu bekommen, um sich so wieder etwas sicherer zu fühlen.