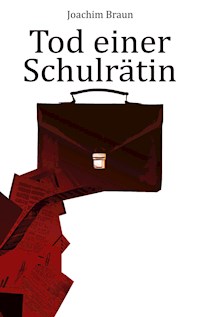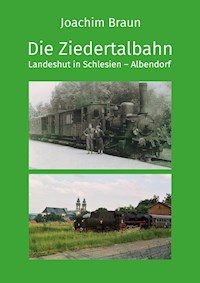Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geschichte der Brücken in Vorpommern. Einführung in die Entwicklung des Brückenbaues. Einzeldarstellung von Brücken an 38 Standorten von Lietzow bis Altentreptow und von Ribnitz-Damgarten bis zu den Oderbrücken. Besondere Berücksichtigung von Kriegsschäden und provisorischer Wiederinstandsetzung. Brückeneinstürze. Neubauten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel oben: Karniner Brücke 1992 (J. Braun)
Titel unten: Brücke in Gartz nach dem Einsturz am 19.9.1926 (Slg E. Hefter)
Vorsatzbild: Meiningenbrücke um 1970 (Zeichnung H. Radau)
Rücktitel: Brücke in Wolgast 2014 (J. Braun)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Landverkehrswege und Wasserstraßen in Vorpommern
Entwicklung des Brückenbaus
Holz- und Steinbrücken
Eisen-, Stahl- und Stahlbetonbrücken
Bewegliche Brücken
Brückenpfeiler
Behelfsbrücken und Kriegsschäden
Ausgewählte Brücken in Vorpommern:
Kahldenbrücke Demmin
Meyenkrebsbrücke Demmin
Eisenbahnbrücke Demmin (Peene)
Tollensebrücken Demmin
Straßenbrücke Loitz
Kleinbahnbrücke Jarmen
Straßenbrücke Jarmen
Autobahnbrücke Jarmen
Straßen- und Kleinbahnbrücke Anklam
Eisenbahnbrücke Anklam
Brücken in Ueckermünde
Eisenbahnbrücke Pasewalk (Uecker)
Autobahnbrücke Pasewalk
Straßenbrücke Zecherin
Eisenbahnbrücke Karnin
Eisenbahnbrücke Zinnowitz
Straßen- und Eisenbahnbrücke Wolgast
Straßenbrücke Wieck (b. Greifswald)
Steinbecker Brücke Greifswald
Eisenbahnbrücke Greifswald (Ryck)
Eisenbahn- und Straßenbrücke bei Stralsund (Ziegelgrabenbrücke und Strelasundbrücke)
Hochbrücke bei Stralsund
Eisenbahn- und Straßenbrücke bei Zingst (Meiningenbrücke und Kloerbrücke)
Straßenbrücke Nehringen (Trebel)
Straßenbrücke Gartz (Oder)
Straßenbrücken Mescherin und Gryfino (Greifenhagen)
Autobahnbrücken Kołbaskowo (Colbitzow)
Eisenbahnbrücke Altentreptow (Tollense)
Passbrücke Ribnitz-Damgarten (Recknitz)
Eisenbahnbrücke Damgarten (Recknitz)
Autobahnbrücke über den Großen Landgraben (b. Klempenow)
Autobahnbrücke über die Trebelniederung (b. Tribsees)
Brücken zur Hafeninsel Stralsund
Peene-Süd-Kanal-Brücke Dersewitz
Eisenbahn- und Straßenbrücke Lietzow (Jasmunder Bodden)
Brücken in Torgelow (Uecker)
Brücken in Eggesin (Randow)
Forstbrücke Liepe (Uecker)
Literatur und Quellen
Danksagung
I. Einleitung
Brücken sind technische Objekte und werden üblicherweise in der Fachliteratur für Bauingenieure und Statiker abgehandelt. Sie sind aber auch ein Teil unserer Kultur- und Technikgeschichte und unter diesem Blickwinkel treten Holzbalken und Stahlprofile, Masse und Statik, Geometrie und Form etwas in den Hintergrund und die Wechselwirkung zwischen Mensch und Geschichte, Hindernis und Brückenschlag, Aufbau und Vernichtung rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Nachforschungen zu dieser Seite der Brücken in Vorpommern haben zum Entstehen der vorliegenden Abhandlung geführt.
Das Überqueren einer Brücke markiert einen Einschnitt in jeder Reise. Man ist noch hüben oder eben schon drüben. Es wurde ein Fluß, eine Bahnstrecke oder ein Tal überwunden. Voller Urlaubsfreude hat man auf das im Sonnenlicht glitzernde Wasser des Peenestroms, des Meiningenstromes oder des Strelasundes geblickt. Oder man wartete ungeduldig vor der hochgeklappten Brücke, bis sie sich endlich wieder senkte und die Fahrt weitergehen konnte. Manch einer mag schaudernd an Theodor Fontanes berühmtes Gedicht „Die Brück am Tay“ oder an die Erzählung des Ingenieurs Max Eyth zur selben Katastrophe denken.1 Wenige Reisende halten kurz inne, um sich ein Brückenbauwerk genauer anzusehen. Und doch kennen wir starke Anziehungspunkte für die Besucher Vorpommerns. Hier müssen die Wiecker Brücke in Greifswald und die Karniner Brücke genannt werden, welche beliebte Hintergrundkulissen für Urlaubsfotos bilden.
Hölzerne Waagebalkenklappbrücke über die Tollense in Klempenow. 1932 abgebrochen (Slg. Fuhrmann)
Die Einheimischen leben mit ihren Brücken, ihrer Form, die zum Stadt- oder Landschaftsbild gehört, ihren technischen Vorzügen und Problemen und den Erlebnissen und Geschichten, die es dazu gibt. Die Brücke war eben nicht schon immer da. Früher mag es eine teure Fähre gegeben haben, später war dann die schmale Holzfahrbahn vorhanden, für deren Benutzung man Brückenzoll entrichten musste; vielleicht verlief im Fluß sogar eine Landes- oder Staatsgrenze; Zöllner kontrollierten Reisende und Fuhrwerke, Brückenwärter bewegten mit Menschenkraft schwere Balkenparallelogramme und Eisenträger, und schließlich hat sich an manchem Flussübergang das Schicksal der Vorfahren entschieden. Und dann waren die Brücken auch ein Ort des Wissensaustausches über die eigene und die weite Welt: da waren die weitgereisten Schiffer und Fuhrleute, die auf das Öffnen oder Schließen der Brücke warteten, da waren der Brückenwärter und die Zöllner, da waren die Frauen, die im Fluß die Wäsche wuschen und die Angler – an der Brücke war immer etwas los.
Als Denkmal erhaltene alte Holzbrücken und moderne Stahlbetonbrücken zeigen dem vergleichenden Betrachter, dass von den Ingenieuren eine gewaltige Entwicklung in konstruktiver und ästhetischer Hinsicht vollzogen wurde. Wichtigster Gesichtspunkt waren vor der Eleganz und der Einfügung in die Umgebung jedoch stets die Steigerung der Tragfähigkeit, die Vergrößerung der Spannweite sowie die Materialeinsparung und die Senkung der Baukosten.
Obwohl sie zu Vorpommern gehören wie die Sakralbauten, Gutshäuser und Tagelöhnerkaten, wie Alleen, Sandstrände, Seen, Flüsse und die Boddengewässer, fanden sie bisher nur wenig Beachtung. Wir lernen diese Kulturdenkmäler nun näher kennen. Zu Fuß gehen wir über die Brücken, bleiben in der Mitte stehen und schauen in die Tiefe. Wir klettern seitlich die Böschung hinab und sehen auf die Konstruktion hoch, welche die Last des Verkehrs zu tragen hat, oder das Öffnen und Schließen ermöglicht. Wir sitzen am Flußufer bei den Einheimischen und hören die Geschichten, die sich hier zugetragen haben. Brückenbau bedeutet das Ringen mit den Naturgewalten Wasser, Wind und Eis, mit Sumpf und Moor sowie mit menschlicher Fehleinschätzung und mangelndem Wissen um Materialeigenschaften oder Statik, und wir blicken auf diesen verlustreichen Kampf zurück. Schließlich lesen wir von so manchem Brückenprojekt, das unausgeführt in den Archiven verschwand.
Nicht alle Brücken Vorpommerns lernen wir kennen. Der eine oder andere Leser mag seine heimatliche Brücke vermissen. So konnten die zahlreichen Bauwerke, welche in der einstigen Hauptstadt Pommerns Stettin die Oderarme überspannen, nicht behandelt werden. Über sie berichten Abhandlungen zur Stettiner Stadtgeschichte. Viele neue Überführungen im Zuge der Autobahn 20 fehlen, um den Rahmen des Buches nicht zu sprengen. Auf dem Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns weist jener Verkehrsweg 131 Überführungen und 80 Autobahnbrücken auf.2 Allerdings werden mehrere große Brückenbauwerke dieser Autobahn in Vorpommern im Einzelnen dargestellt. Pläne und Beschreibungen mancher älteren Brücke wurden vernichtet oder lagern unzugänglich in Archiven, so daß die Schilderung in diesen Fällen lückenhaft bleiben muß. Insgesamt werden 38 große und kleine Brücken des Landes dokumentiert. Bei der Bildauswahl stehen die Bauwerke der Vergangenheit im Vordergrund. Technische Zeichnungen werden bewußt nur in geringem Umfang wiedergegeben, um den Umfang und das Format des Buches nicht zu sprengen. Die im Text genannten Abmessungen von Brücken und ihren Komponenten fußen auf Angaben in der Literatur, die in manchen Fällen bei verschiedenen Quellen Abweichungen aufweisen Zum besseren Verständnis der Einzeldarstellungen wird ein Überblick über die Verkehrswege Vorpommerns sowie der Entwicklung des Brückenbaues im Allgemeinen vorangestellt.
1 Eyth, Max: Die Brücke über die Ennobucht. Stuttgart 1888
II. Landverkehrswege und Wasserstraßen in Vorpommern
Den geografischen Rahmen dieser Abhandlung bildet der vorpommersche Teil der preußischen Provinz Pommern in den Grenzen bis 1945, wie er im Historischen Atlas von Pommern eingezeichnet ist.3 Er reicht im Norden von Kap Arkona bis Treptow a. d. Tollense (Altentreptow) und Gartz im Süden und von der Oder im Osten bis Damgarten und zu den Flüssen Recknitz und Trebel im Westen. Regierungssitz und Zentrum dieses Gebietes war bis 1945 Stettin. 1947 wurde der Begriff „Pommern“ auf Befehl der sowjetischen Militäradministration verboten und das Land als „Mecklenburg“ bezeichnet. „Den Bewohnern Vorpommerns versuchte man in der DDR geradezu, das Gedächtnis zu entreißen. Sie sollten nicht nur vergessen in Pommern geboren zu sein, sondern sogar den Namen Pommern selbst“, so der polnische Historiker Jan M. Piskorski 1999.4 Später bildete es Teile der DDR-Bezirke Rostock und Neubrandenburg. 1990 entstand das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Vorpommern ist geprägt durch das Vorhandensein großer Inseln wie Rügen und Usedom, der Halbinsel Darß sowie zahlreicher Flüsse, die zum Teil auch von der Schiffahrt genutzt wurden oder auch heute noch als Wasserstraße gelten. Hier muß neben der Oder in erster Linie die Peene genannt werden, die von Malchin bis zur Mündung in den Peenestrom der Schiffahrt dient. Überhaupt war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts der Warentransport auf den Flüssen einfacher als auf den schlechten Straßen. So gab es früher auch Schiffahrt auf Recknitz, Trebel, Tollense und Uecker. Die große Zahl von Flüssen und die Inseln lassen die Bedeutung des Brückenbaus für diese Region deutlich werden.
Seit dem Mittelalter verlaufen bedeutende von den Wirtschaftsbeziehungen der Hanse geprägte Handelsstraßen durch das Land. Wo sie Flüsse zu überwinden hatten, wuchsen Siedlungen und Städte. An erster Stelle soll hier die Straße Lübeck - Rostock - Stralsund über Ribnitz und deren Fortsetzung nach Stettin über Greifswald, Anklam und Ueckermünde genannt werden. Auch die Verbindung Anklam - Rostock über Demmin und Gnoien hatte für die Hanse schon im 15. Jahrhundert eine Bedeutung. Zu dieser Zeit überquerte man die Flüsse mit Fährkähnen, wobei die Lasten meist vom Fuhrwerk auf den Kahn und auf der anderen Seite wieder vom Kahn auf ein Fuhrwerk umgeladen wurden, was sehr teuer und zeitaufwendig war. Der im Mittelalter einsetzende Brückenbau bedeutete hier einen großen Fortschritt, welcher von den Fährleuten allerdings stark bekämpft wurde.
In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die meist gepflasterten Landstraßen auf den wichtigsten Verbindungen asphaltiert und es entstand das Reichsstraßennetz. 1938 erhielt Vorpommern mit der Fertigstellung der Reichsautobahn Berlin - Stettin den ersten Autobahnabschnitt, der einen großen Brückenbau über die beiden Oderarme einschloß. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand für viele Jahre die Wiederherstellung der zerstörten Brücken im Vordergrund. Weitere große Straßenprojekte folgten erst mit der Freigabe des letzten Teilstücks der Autobahn A 20 am 7. Dezember 2005, welche zahlreiche große Brücken unter anderem bei Jarmen und bei Pasewalk umfasst. Den krönenden Abschluß stellt bisher der Bau der zweiten Rügenanbindung mit einer Hochbrücke dar, welche am 19. Oktober 2007 feierlich eröffnet wurde. Heute verfügt das Land über zahlreiche leistungsfähige Verkehrswege unter Einbindung moderner Brückenbauten, welche näher beschrieben werden.
Unmaßstäbliche Skizze von Vorpommern. Die Ziffern verweisen auf die Einzeldarstellung der Brücken (J. Braun)
Frühzeitig entstanden in Vorpommern wichtige Eisenbahnlinien; genannt seien die Strecke Berlin - Stralsund - Saßnitz über Pasewalk wie auch die Berliner Nordbahn Berlin - Stralsund über Neustrelitz. Wie wir sehen werden, bereitete der weithin sumpfige Untergrund Vorpommerns den Brückenbauern nicht nur bei den Eisenbahnen zu allen Zeiten erhebliche Schwierigkeiten. Ergänzt wurden die Hauptbahnen durch einige wenige Nebenbahnen, jedoch durch ein dichtes Netz überwiegend schmalspuriger Kleinbahnen. Hervorgehoben seien hier neben der Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn die Anklam - Lassaner Kleinbahn, die Greifswald - Grimmener Eisenbahn (Normalspur), die Greifswald - Jarmener Kleinbahn, und die Demminer Kleinbahnen Ost und West. Zahlreiche Überschneidungen von Schienen- und Wasserwegen sind also im Land entstanden, welche bemerkenswerte technische Bauwerke aufweisen.
2 DEGES: Bundesautobahn A 20
3 Vollack: Historischer Atlas . . .
4 Piskorski: Pommern im Wandel der Zeiten
III. Entwicklung des Brückenbaus
a. Holz- und Steinbrücken
Vor allem Holzbrücken spielten in Vorpommern eine bedeutende Rolle. In ihrer einfachsten Form, die aus Stämmen bestand, welche über Gewässer oder Geländeeinschnitte gelegt wurden, begleiteten sie die Entwicklung der Verkehrswege in aller Welt. Bei längeren Stützweiten rammte man Stämme senkrecht in den Untergrund und gewann so einen Zwischenpfeiler. Pfeiler einer hölzernen Brücke über die Peene aus dem 9. Jahrhundert wurden von Archäologen beim „Alten Lager“ in Menzlin nachgewiesen. Waren hiesige Holzbrücken noch von einfacher Form, so wurde dagegen in Amerika ihr Bau zu gewaltigen Ausmaßen vorangetrieben. Statisch ausgefeilte Holzgitterkonstruktionen, hier sei der Howe-Träger genannt, ermöglichten die Aufnahme großer Lasten wie sie im Eisenbahnbetrieb auftreten, und somit die Überbrückung breiter und tiefer Geländeeinschnitte. In Deutschland bestand die erste Elbebrücke für die Eisenbahn bei Wittenberge aus 14 hölzernen Howe-Trägern von 42–56 m Spannweite.5 Längere freie Stützweiten sind mit Holzbrücken aber nur schwer umsetzbar. Nachteilig bei derartigen „Trestlework-Brücken“ war unter anderem ihre fehlende Feuerfestigkeit. Sie konnten durch aus Dampflokomotiven herabfallende Glutnester, Blitzschlag oder Brandstiftung in Brand geraten. So brannte der aus 14 Öffnungen mit einer Pfeilerhöhe bis zu 57 m bestehende Portage-Viadukt der Erie-Bahn in den USA 1875 ab und wurde durch einen eisernen Viadukt ersetzt.6
Die beim Bau der Holzbrücken gewonnenen statischen Erfahrungen spielten auch bei der Konstruktion der ersten Stahlbrücken eine Rolle. Im Hinblick auf die Schiffahrt, die früher auch auf kleineren Wasserläufen betrieben wurde, kamen in Vorpommern allerdings meist hölzerne Klappbrücken zur Ausführung.
Die Kunst Bogenbrücken aus behauenen Steinen zu bauen, war schon 1600 v. Chr. bekannt. Die Römer hinterließen uns vollkommene Steinbrücken und Aquädukte. In Deutschland wurde der Bau von Steinbrücken mit großer Perfektion in funktioneller und ästhetischer Hinsicht fortgesetzt. Bekanntestes Beispiel hierfür ist die 78 m hohe Göltzschtalbrücke im Vogtland. Dem Betrachter, der fasziniert vor diesem Bauwerk steht, wird allerdings auch klar, dass der Bau noch größerer Brücken in dieser Bauweise schon vom Arbeits-, Zeit- und Materialaufwand wie auch von der Belastung des Untergrundes her kaum vorstellbar ist. In Vorpommern wurden lediglich kleine Steinbrücken im Stadtbereich angelegt, beispielsweise bei der Überbrückung des ehemaligen Festungsgrabens in Greifswald.
b. Eisen-, Stahl- und Stahlbetonbrücken
Die Entwicklung eiserner Brücken begann in Deutschland im Jahr 1796 mit dem Bau einer gusseisernen Straßenbrücke über das Striegauer Wasser bei Laasan in Niederschlesien. Es handelte sich hierbei um eine Bogenbrücke von 13 m Spannweite, einer Bogenhöhe von 2,9 m und einer Breite von 6 m. Die 47 t schwere Brücke wurde von der im Besitz des Grafen August v. Burghaus befindlichen Hütte in Malapane/Oberschlesien gefertigt. Dessen Schwiegersohn, der Graf Friedrich Wilhelm v. Reden sowie der in Oberschlesien tätige schottische Hütteningenieur John Baildon leiteten den Guß und den Aufbau des Bauwerkes. Es war nach der Brücke von Coalbrookdale aus dem Jahr 1779 erst die zweite eiserne Brücke in Europa. Ihre Form und die zugrundeliegenden statischen Annahmen weisen noch auf steinerne Bogenbrücken hin. Fünf gusseiserne Bögen von 15 m Länge trafen im Herbst 1796 an der Baustelle ein und wurden mit einem Abstand von 1,35 m nebeneinander eingebaut. Das Jahr 1945 brachte die Zerstörung dieses unersetzlichen technikgeschichtlichen Denkmales, als es unter der Überfahrt eines Panzers zusammenbrach.7 Genau 50 Jahre nach der Zerstörung wurden im Rahmen der Regulierung des Striegauer Wassers etwa 5 t Brückenteile geborgen und in Żary eingelagert.
Zweite eiserne Brücke in Europa bei Laasan in Niederschlesien. Auf der Brücke Kohlefuhrwerke auf ihrem Weg vom Waldenburger Kohlerevier zur Oder (Slg. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi)
Während man in England, dem Mutterland des eisernen Brückenbaues, in den folgenden Jahren zahlreiche an Ketten hängende Brücken großer Spannweite errichtete, übersprang man in Deutschland diesen Entwicklungsschritt. Brückeneinstürze und Verformungen zeigten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, daß gusseiserne Bogenbrücken und Hängebrücken den Belastungen und Schwingungen durch fahrende Züge auf Dauer nicht stand hielten. Inzwischen hatte man aber das viel elastischere und mit Stahl vergleichbare Schmiedeeisen zur Verfügung. Aus diesem hatte der Ingenieur Robert Stephenson im Jahr 1850 eine Kastenbrücke mit einer Spannweite im Strombereich von 2 x 139,5 m konstruiert. Die Kästen entstanden aus zusammengenieteten Platten aus Schmiedeeisen, nachdem sich in Versuchen das kastenförmige Profil gegenüber kreisrunden oder ovalen Röhren als belastbarer erwiesen hatte. Die Fahrbahn befand sich im Inneren des Kastens. Bis 1970 beeindruckte die Britannia-Brücke mit ihren klaren Formen. Durch Fahrlässigkeit in die Brücke eingedrungener Jugendlicher geriet der Innenanstrich in Brand und die Eisenkonstruktion glühte auf ganzer Länge aus.
In Deutschland gelang es 1857 eine Kastenbrücke zu bauen, die statt aus schweren Gußplatten aus einem offenen versteiften Gitterwerk von kleinen schmiedeeisernen Stäben besteht. Die nur noch in Teilen im Ursprungszustand vorhandene Weichselbrücke bei Dirschau besitzt sechs Öffnungen von jeweils 130,90 m und wurde von dem preußischen Regierungsbaurat Carl Lentze (1801-1883) entworfen. 8
Ein bekanntes dramatisches Lehrbeispiel für die mit dem neuen Baustoff, den eisernen Brückenüberbauten und den statischen Berechnungen verbundenen Gefahren ereignete sich am 28. Dezember 1879 um 19.00 in Schottland. Unter dem Druck eines Sturmes der Windstärke 11 stürzte ein nahezu ein Kilometer langes Segment der erst zwei Jahre alten Eisenbahnbrücke über den Firth of Tay in die Tiefe und riß mit dem gerade überfahrenden Zug 75 Menschen in den Tod. Theodor Fontane hat in seinem Gedicht “Die Brück am Tay“ das Unglück dem Wirken dreier Hexen zugeschrieben; tatsächlich waren aber Schlamperei bei der Bauausführung, falsche Annahmen über den Winddruck sowie mangelhafte Wartung die Ursache. Das Herunterfallen von Teilen aus der neuen Brücke wurde ignoriert. Gußteile waren fehlerhaft oder wiesen Dellen und Löcher auf, die verspachtelt oder ausgegossen und mit Ofenfarbe überstrichen waren. Zugproben nach dem Einsturz zeigten, daß die Gußrohre oft nur ein Drittel der geforderten Zugspannung aushielten.9 Wie später wieder der Untergang der "Titanic“ beendete dieses Ereignis eine Epoche unbegrenzten Vertrauens der Zeitgenossen in die vollständige Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit der Naturkräfte durch menschliche Konstruktionen. Auch in Vorpommern haben Naturgewalten den Brücken böse mitgespielt und den Ingenieuren ihre Grenzen aufgezeigt.
Weichselbrücke Dirschau 2004 (J.Braun)
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahmen das Wissen über die Belastbarkeit des neuen Materials wie auch die Kenntnisse der Statik des Brückenbaues rasch zu. Sie ermöglichten die Abkehr von Kastenbrücken und den Weg zu noch leichteren und leistungsfähigeren Trägerbrücken. Hierbei kann sich die Fahrbahn unterhalb, oberhalb oder auch im Brückenträger befinden, der die Verkehrslast trägt. Es entstanden unterschiedliche Formen der Stahlträger; zu den einfachsten gehören die Parallelträger mit gleich langem Ober- und Untergurt, die durch ein Fachwerk in allen Ebenen miteinander verbunden sind. Ist der Obergurt kürzer, spricht man von einem Trapezträger. Größere freie Spannweiten erfordern in der Regel Bogenbrücken. Der Bogenverlauf zeigt meist die geometrische Form einer Parabel, weshalb diese Überbauten auch als Parabelträger bezeichnet werden. Besonders charakteristische Bogenträger entwickelten die Baumeister Johann Wilhelm Schwedler (1823-1894) und Friedrich August v. Pauli (1802-1883). Der Schwedler-Träger beschreibt einen im Scheitel abgeflachten Bogen. Da Schwedler preußischer Baumeister war, wurden seine Konstruktionen im preußischen Pommern besonders häufig ausgeführt. Eine sehenswerte Kette solcher Träger ist in den Überresten der Dömitzer Eisenbahnbrücke erhalten geblieben. Ein weiterer bogenförmiger Stahlüberbau ist der Langersche Balken, der in Vorpommern bei der Straßenbrücke in Jarmen und bei der Meyenkrebsbrücke zur Ausführung kam. Der Pauliträger weist einen bogenförmigen Ober- und Untergurt auf, so dass eine Linsenform entsteht. Der Brückenbauer Heinrich Gerber (1832-1912), ein Schüler Paulis, entwickelte diese Trägerform weiter. Beeindruckende Pauliträger in moderner geschweißter Ausführung findet man heute bei den Hamburger Elbebrücken. Darüber hinaus sind besondere Brückenformen, bei welchen Brückenfelder mit Gelenken verbunden werden, ohne sich an dieser Stelle auf einen Pfeiler zu stützen, mit dem Namen Gerber verbunden. Brücken nach dem Gerberprinzip wurden über die Ostoder in Gryfino erbaut, in Wolgast, bei den Autobahnbrücken über die Oder und im Bereich der Strelasundquerung nach der Zerstörung einzelner Brückenfelder. Neben dem Brückenbau entwickelten die genannten Ingenieure auch den Stahlhochbau zu bisher unbekannten Dimensionen weiter, wie wir sie beispielsweise in der Bahnhofshalle in Frankfurt/Main sehen.
Schwedler-Träger im Zuge der Elbebrücke Dömitz 2015 (J.Braun)
Pauli-Träger. Brücke über die Norderelbe in Hamburg 2013 (J.Braun)
Entscheidende Schritte zu größeren und leichteren Brückenträgern waren die Einführung des Bessemer-Verfahrens 1855, des Thomas-Konverters ab 1879 und des Siemens-Martin-Ofens in den Hüttenwerken, welche erst die Herstellung größerer Stahlprofile möglich machten. Stahl verdrängte um 1890 das Schmiedeeisen aus dem Brückenbau. Allerdings setzte sich der Begriff „Stahl“ im Schrifttum nur zögerlich durch, so daß zeitgenössische Beschreibungen noch lange von eisernen Brücken sprechen, obwohl diese aus Stahl gefertigt waren. Erst 1924 wurde Stahl als technische Norm definiert.10
Waren bis um 1930 die Verbindungen von Stahlteilen stets genietet, so gelang 1929 erstmals die Herstellung einer Eisenbahnbrücke von 10 m Stützweite mit ausschließlich geschweißten Verbindungen.11 Schon 1935 lieferte die Firma Dörnen Brückenbau in Dortmund-Derne vollständig geschweißte Blechbrückenträger aus St 37 von 53 m Länge und 3,70 m Höhe für die Ziegelgrabenbrücke bei Stralsund. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte man in der SBZ vorübergehend wieder zu Nietverbindungen zurück, da die materiellen Voraussetzungen zum Schweißen großer Stahlprofile nicht mehr gegeben waren (Eisenbahnbrücke in Frankfurt/Oder, Meyenkrebsbrücke Demmin).
Oderbrücke in Gartz am 19.9.1926. Zehn Minuten nach dieser Aufnahme stürzte die Brücke ein (Slg E. Hefter)
Eine Besonderheit in Vorpommern stellte die 1926 erbaute Oderbrücke bei Gartz dar. Ihre Überbauten entstanden aus dem neuen Baustoff Eisenbeton, der auf die Patente des Gärtners Joseph Monier (1823-1906) von 1867 zurückgeht. Das dramatische Schicksal dieses Bauwerkes brachte das verwendete Baumaterial ungerechtfertigter Weise in Verruf. Dennoch setzte sich vor allem bei kleineren Bahnbrücken die Walzträger-in-Beton-Bauweise durch. Die Hälfte der Brückenüberbauten wurden vor dem Ersten Weltkrieg in dieser Form errichtet.12 Heute sind Spannbetonbrücken und Walzträger in Betonummantelung unverzichtbare Komponenten des Eisenbahnbrückenbaus.
Die weitere Entwicklung des Stahlbaues griff wieder auf den kastenförmigen Träger zurück, wobei der Kasten nun aus vollwandigen Stahlblechen zusammengeschweißt wurde. Auf dem schmaleren Träger liegt die von Dübeln gehaltene breitere stählerne Fahrbahnplatte, welche in Längs- und Querrichtung verlaufende Versteifungsrippen besitzt. Solche Fahrbahnplatten werden als „orthotrope Platte“ bezeichnet. Die erste große vollverschweißte Straßenbrücke Europas mit orthotroper Fahrbahnplatte war die 1954 gebaute Weserbrücke bei Porta Westfalica.13 1956 wurde dann eine solche Brücke mit einer Stützweite von 261 m in Belgrad ausgeführt.14 Noch größere Stützweiten ermöglichen die an Pylonen hängenden seilverspannten Kastenbrücken. Der aus Mühlhausen/Thüringen stammende Ingenieur Johann August Roebling (1806-1869), ein ebenso genialer wie tyrannischer Mann, entwickelte in den USA das Luftspinnverfahren zur Herstellung von Tragseilen jeden gewünschten Umfanges aus Drähten und löste damit die schweren und kaum noch handhabbaren Ketten im Bau von Hängebrücken ab. Sein größtes Brückenprojekt ist die 1834 m lange Brooklyn-Brücke über den East River in New York, die aber erst von seinem Sohn William am 24. Mai 1883 fertiggestellt werden konnte.15 Das jüngste Beispiel einer seilverspannten Stahlkastenbrücke in Deutschland stellt die 2007 dem Verkehr übergebene neue Rügenbrücke bei Stralsund dar. Bemerkenswert ist, dass bis heute der Material- und Arbeitsaufwand für den Bau einer großen Brücke ständig abgenommen hat, während sich der Aufwand für statische Berechnungen vervielfacht hat.
Brooklyn-Brücke New York 2005; Blick von Manhattan (postdlf aus englischsprachiger Wikipedia)
c. Bewegliche Brücken
Die klassische Form der im Hinblick auf die Schiffahrt in Vorpommern oft erforderlichen beweglichen Brücke ist die hölzerne Waagebalkenklappbrücke, die auch als Holländer- oder Portalbrücke bezeichnet wird. Für größere Spannweiten entstanden zweiarmige Klappbrücken. Bekanntester Vertreter dieser Bauform in der Region ist die Brücke von Wieck bei Greifswald. Für die üblichen Fuhrwerke genügten diese Bauwerke bis in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Allerdings waren sie den schwereren Lasten des Kraftverkehrs mit Lastwagen und Bussen nicht gewachsen, so dass die Holzbrücken an den wichtigsten Verkehrswegen nach 1920 durch Stahlklappbrücken mit Betonfahrbahnen, untenliegendem Gegengewicht und elektromechanischem Antrieb ersetzt wurden. Solche Brücken entstanden in Vorpommern mit einarmiger oder zweiarmiger Klappe.
Für Eisenbahnen kamen hölzerne Waagebalkenbrücken wegen der hohen Lasten nicht in Frage. Als erste Vertreter einer eisernen Waagebalkenklappbrücke entstanden die Kleinbahnbrücke über die Peene der Anklam - Lassaner - Kleinbahn in Anklam sowie die Eisenbahnbrücke über die Uecker in Pasewalk. Weitaus verbreiteter waren damals dagegen Drehbrücken aus Flusseisen oder Stahl. Diese konnten entweder um einen mittig gelegenen oder um einen außermittig gelegenen Pfeiler gedreht werden. Um den Drehzapfen herum gab es eine Rollbahn für eine größere Zahl von Walzen oder Rollen, welche die Brücke nach dem Absenken der Endlager trugen. Die Drehung derartiger Brücken erwies sich als kräftezehrend und zeitraubend. Hinzu kam ein rascher Verschleiß der beweglichen Lager und der Rollen durch Schwingungen und das Schlagen der Achsen beim Befahren der Brücken. Eine Lösung dieser Probleme fand der Baumeister Johann Wilhelm Schwedler. Seine neue Drehbrückenkonstruktion wurde zum ersten Mal im Deutschen Reich im Jahre 1863 in Anklam umgesetzt. Mehrere Brücken dieses Typs entstanden in den Folgejahren auch in Vorpommern.16 Die letzte Vertreterin einer solchen von Hand bewegten Drehbrücke brach man erst 2011 in Loitz ab.
Während bei den Straßenbrücken um 1920 einarmige oder zweiarmige stählerne Klappbrücken weite Verbreitung fanden, wählte die Reichsbahn verschiedene Lösungen. In Anklam entstand eine Rollklappbrücke der Bauart Scherzer, bei der Ziegelgrabenbrücke in Stralsund entschied man sich für eine Waagebalkenklappbrücke aus Stahl und in Karnin entstand die erste Hubbrücke im Deutschen Reich. Jüngste Beispiele einer beweglichen Brücke sind in Vorpommern die sowohl dem Straßen- wie auch dem Bahnverkehr dienende Brücke in Wolgast und die neue Eisenbahnklappbrücke in Anklam.
d. Brückenpfeiler
Eine besondere Herausforderung für den Bau größerer Brücken stellt der in Vorpommern oft sumpfige und wenig tragfähige Baugrund dar. Grundlage für den Pfeilerbau sind seit dem Altertum in den Untergrund gerammte Bündel von Holzpfählen, auf denen die Brückenpfeiler aufgebaut werden konnten. Eichenholz weist unter Wasser eine sehr lange Standfestigkeit und Belastbarkeit auf. Noch heute sind in der Peene am Alten Lager die hölzernen Reste einer Wikingerbrücke vorhanden. Zahlreiche ältere Brückenpfeiler in Vorpommern ruhen bis jetzt auf hölzernen Pfählen.
Eisenbahndrehbrücke der früheren Westpreußischen Kleinbahnen in Rybina im Weichseldelta 2010. Die Brücke wurde 1905 von der Dortmunder Union gebaut. Sie hat eine Länge von 43,40 m und wird bis heute von zwei Männern mit Muskelkraft gedreht. (J. Braun)
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird im Pfeilerbau der Senkkasten, auch als Caisson bezeichnet, eingesetzt. Es handelt sich hierbei um unten offene und von oben über eine Schleuse zugängliche Kästen, welche auf den Flußgrund aufgesetzt werden. Da das Innere der Kästen unter Überdruck gehalten wird, welchem allerdings auch dort arbeitende Menschen ausgesetzt sind, kann kein Wasser eindringen. Vom Inneren des Kastens aus können Arbeiter den Flußgrund ausgraben, wobei der Kasten immer tiefer sinkt und der Zugang nach oben verlängert werden muß. Ist tragfähiger Grund erreicht, kann der Caisson mit Beton aufgefüllt werden und bildet somit das Fundament für einen Brückenpfeiler. Das Verfahren wird auch als Druckluftgründung bezeichnet. Daneben können Brückenpfeiler innerhalb in den Boden gerammter Spundwände gebaut werden, welche eine bedingt wasserdichte Baugrube gewähren.
Inzwischen haben mit Stahl armierte Betonpfähle die Rolle der Eichenpfähle übernommen. Stählerne Hülsen, die zunächst an der Spitze geschlossen sind, werden tief in den Untergrund gerammt. Wenn tragfähiger Untergrund erreicht ist, wird die Spitze geöffnet, ein Stahlgerüst in die Hülse eingebracht und unter Einpressen von Beton die Hülse aus der Erde gezogen. So ruht die in besonders sumpfigem Terrain erstellte Autobahnbrücke über das Trebeltal mit 530 m Länge auf Ramm- und Bohrpfählen von 61 cm Durchmesser, welche bis 19 m tief in den Untergrund ragen. Wo Rammen aus Rücksicht auf die Natur oder angrenzende Bauten nicht möglich ist, können Atlaspfähle eingesetzt werden. Hierbei schneidet ein langer Gewindeschneider Gewindegänge von der Oberfläche bis zum tragfähigen Grund in das Erdreich. Beim Zurückdrehen des Gewindeschneiders wird durch das Innere Beton gepreßt, so daß ein Betonpfahl mit schraubenartiger Oberfläche entsteht, der auch eine zentrale Stahlarmierung erhalten kann. Wo die Pfähle unter Wasser erstellt werden müssen, stehen die erforderlichen Maschinen auf Pontons.
e. Behelfsbrücken und Kriegsschäden
In wenigen Tagen des Aprils 1945 fegte die Furie des Krieges mit unvorstellbarer Brutalität und mittelalterlichen Verwüstungen über Vorpommern hinweg. Hier bleibt die Zerstörung nahezu aller Brücken angesichts des Leidens und Sterbens der Menschen nur eine Randnotiz der Geschichte. Unbedeutende Flüsse und Gewässer gaben schwach besetzten Abwehrstellungen der Wehrmacht einen Namen, der für wenige Tage im Wehrmachtsbericht erschien. Man sprach von der „Randow-Wotan-Stellung“ und der „Peene-Linie“. Die Sprengung der Brücken und der Abwehrkampf am Flussufer verschafften den Flüchtlingen und der Zivilbevölkerung einige Stunden Vorsprung auf dem Weg zur rettenden Elbe. Wehrmacht, Hitlerjugend und Volkssturmeinheiten zahlten hierfür jedoch noch wenige Tage vor Kriegsende einen hohen Blutzoll. Wie zu Vorzeiten waren Städte oder Landstriche zu Inseln geworden, welche nur mit Booten oder Fähren zu erreichen waren. Im Rückblick ist es interessant, wie man damals trotz Mangels an allen Baustoffen mit einfachen Mitteln die überlebenswichtigen Verkehrswege wieder befahrbar machte und die zahlreichen Lücken schloß.
Holzbrücken, die von in den Flussgrund gerammten Pfahlrosten getragen wurden, konnten relativ schnell hergestellt werden; waren für den Schwerlastverkehr jedoch wenig geeignet. In manchen Fällen wurde hierbei die Schiffahrtsöffnung durch die Holzpfeiler zunächst geschlossen, in anderen Fällen verband man die feste Holzbrücke mit einem auf Booten oder Fährprähmen ruhenden Brückensegment, welches bei Bedarf herausgeschleppt werden konnte und so die Durchfahrt von Schiffen ermöglichte (Meyenkrebsbrücke, Behelfsbrücke Anklam). Auch vollständig auf Pontons oder Kähnen liegende Holzbrücken wurden behelfsweise errichtet (Ziegelgrabenbrücke).
Zur Instandsetzung kriegszerstörter Eisenbahnbrücken besaß die Reichsbahn sogenanntes Brückengerät. Es handelte sich hierbei um Fachwerkbrückenteile, die durch eine große Zahl von Schrauben der Gewindegröße M 30 zu Brückenträgern größerer Länge zusammengeschraubt werden konnten. Das schwerste Einzelteil wog nur 3,5 t und war somit gut transportabel und handhabbar. Nach ihren Konstrukteuren und Herstellern werden diese Träger als RW-Gerät (Roth-Waagner) aus St 37 und SKR-Gerät (Schaper - Krupp - Reichsbahn) bezeichnet. Das R-Gerät der Krupp-Brückenbauanstalt Rheinhausen ist eine Weiterentwicklung des SKR-Gerätes durch Konrad Sattler mit dem tragfähigeren Stahl 52.17 1960 entwickelten Krupp und MAN die D-Brücke, welche bis heute Verwendung findet. Die Brückengeräte ermöglichten Stützweiten bis 160 m. Unter Verwendung solcher Teile konnten verbliebene Lücken in Brückenzügen in vielen Fällen beseitigt werden, indem man abgestürzte, aber unversehrte Brückenträger anhob und wieder auf ihre Lager setzte und dann verbliebene Lücken durch den Einbau von Brückengerät schloß.
SKR-Gerät bei der Wiederherstellung der Dnjeprbrücke im Zuge der Strecke Kiew - Poltawa - Charkow 1943 (W. Hollnagel; Slg. Eisenbahnstiftung)