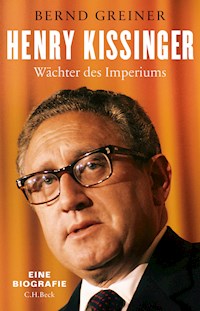12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ohne die schützende Hand der USA würde die Welt im Chaos versinken, heißt es oft. Bernd Greiner unterzieht diese These einem Praxistest. Wie sehen die Weltgegenden anschließend aus, in denen Washington seit 1945 eingegriffen hat? Die Bilanz ist ernüchternd. Die Vereinigten Staaten haben die meisten Kriege geführt, sie sind Spitzenreiter beim Sturz missliebiger, auch demokratisch gewählter Regierungen, unzählige Menschen mussten ihr Leben lassen, Gesellschaften wurden traumatisiert und Staaten ruiniert. Es ist an der Zeit, über Konsequenzen zu diskutieren. Denn die globalen Herausforderungen unserer Zeit werden ohne die USA nicht zu bewältigen sein. Aber unter Washingtons Führung erst recht nicht. Wer Menschenrechte, Freiheit und Demokratie auf Washingtons Art verteidigt, beschädigt diese Werte im Kern. Zu diesem Ergebnis kommt der renommierte Historiker Bernd Greiner in seiner weltumspannenden Analyse amerikanischer Ordnungspolitik seit 1945. Er zeigt, wie sich in den USA der Anspruch ausbildete, als Hüter der internationalen Ordnung aufzutreten. Er zeigt auch, wie die Vorstellung entstand, Stabilität gebe es nur auf der Grundlage amerikanischer Überlegenheit. Und er liefert eine kritische Bilanz der amerikanischen Ordnungspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. Europa sollte sich im ureigensten Interesse auf seine Kraft besinnen – auf eine Politik, der es nicht um die brachiale Durchsetzung, sondern um den Ausgleich von Interessen geht. Und auf eine Politik ohne Lagerdenken und Überlegenheitsdünkel, ohne Anspruch auf Dominanz und Gefolgschaft. Also jenseits amerikanischer Haltungen, Ansprüche und Praktiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bernd Greiner
Made in Washington
Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben
Verlag C.H.Beck
Inhalt
Vorwort – Ein anderer Blick
Für Gott und das Gute – Auf dem Weg zur Führungsmacht
Eine Welt nach amerikanischer Fasson
«America First», Verlustängste und Sicherheitsphantasien
Casino Royale – Zocken mit Nuklearwaffen
Tagträume im Pentagon
Ein Tanz um das goldene Kalb
Spiel mit dem Feuer
Perpetuum Mobile
Unter anderem Guatemala – Putschisten und weitere Stellvertreter
Iran und Guatemala
Der unaufhaltsame Aufstieg der CIA
Schiffbruch vor Kuba
Auf Gewalt gegründet – Südvietnam, Indonesien, Lateinamerika
Unter Tyrannen
Die offenen Adern Lateinamerikas …
Ein Appell an und aus Europa
Gewinnen um jeden Preis – Kriege in der Dritten Welt
Der gewollte Krieg
In der Glaubwürdigkeitsfalle
Krieg gegen die Zivilbevölkerung
Tote Zonen
«Killing Fields»
Selbstblockade – Reformen im Leerlauf
Skandale und Reformen
Die Selbstentmachtung des Kongresses
Alleinige Supermacht – Baupläne für eine «Neue Weltordnung»
Vorwärts in die Vergangenheit
Über den Kosovo zum Irak
Verbrannte Erde – Zwei Jahrzehnte «Krieg gegen den Terror»
Ideologen auf dem Kriegspfad
Angriffskrieg
Verbrechen als Prinzip
Fortsetzung folgt – Die Macht der Angst
Fetisch Rüstung
Tickende Zeitbomben
Selbstnarkotisierung
Nachwort – Gedanken zu einer Unabhängigkeitserklärung
Dank
Anhang
Anmerkungen
Vorwort
Für Gott und das Gute
Casino Royale
Unter anderem Guatemala
Auf Gewalt gegründet
Gewinnen um jeden Preis
Selbstblockade
Alleinige Supermacht
Verbrannte Erde
Fortsetzung folgt
Nachwort
Literatur
Quellenverzeichnis und Abkürzungen
Bildnachweis
Personen-, Orts- und Sachregister
In Erinnerung an August Jacobi (1896–1975)
Vorwort
Ein anderer Blick
Zu reden ist über die Schattenseiten des amerikanischen Jahrhunderts. Über die Tatsache, dass Unzählige ihr Leben lassen mussten, dass Gesellschaften traumatisiert und dass Staaten ruiniert wurden, weil die USA ihren Anspruch auf Ordnung der Welt durchsetzen wollten. Keine andere Nation ist seit 1945 derart rabiat aufgetreten. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die meisten Kriege geführt, wiederholt Angriffskriege vom Zaun gebrochen und das Völkerrecht mit Füßen getreten, sie geben heute noch das meiste Geld für Rüstung aus und unterhalten weltweit mehr Militärstützpunkte als alle anderen Staaten zusammen, sie sind einsamer Spitzenreiter beim Sturz missliebiger, auch demokratisch gewählter Regierungen. Darüber nachzudenken, welche Konsequenzen diese Bilanz haben sollte und müsste, versteht sich eigentlich von selbst. Und es ist alles andere als selbstverständlich, werden neuerdings doch wieder große Hoffnungen auf Washington gesetzt – als könnte man das Offensichtliche ignorieren oder zu Kollateralschäden einer vermeintlich unabdingbaren Führung erklären.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs treten die USA wie ein vom Schicksal auserwählter Hüter von Freiheit und Stabilität auf. Worauf gründet ihr Anspruch? Wieso betrachtet man sich selbst als Norm, die für alle anderen richtungsweisend und verbindlich sein soll? Welche Mittel kommen zum Einsatz? Und vor allem: Zu welchem Preis? Diese Fragen werden in neun Kapiteln diskutiert. Ein jedes steht für sich und kann unabhängig von den anderen gelesen werden. Zusammen fügen sie sich zu einem Gesamtbild mit einer streitbaren Schlussfolgerung: Ohne die USA ist eine neue Weltordnung nicht zu haben. Aber unter ihrer Führung schon gar nicht.
Zum besseren Verständnis amerikanischen Ordnungsdenkens lohnt ein Blick in die turbulenten Jahre zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Von dieser Zeit handelt das erste Kapitel: «Für Gott und das Gute: Auf dem Weg zur Ordnungsmacht». Scheinbar unversöhnliche Lager standen sich damals gegenüber: «Interventionisten» und «Isolationisten», Befürworter und Gegner des Beitritts zum Völkerbund, Unterstützer und Kritiker von Hochrüstung. Ihre Kontroversen hielten das Land in Atem, die Gemeinsamkeiten indes sind ungleich aufschlussreicher. Alle Beteiligten einte die Panik vor dem Verlust von Amerikas Einzigartigkeit – dass das Experiment «Neue Welt» entweder an der Bösartigkeit äußerer Feinde oder an hausgemachten Widersprüchen scheitern könnte und dass die «redeemer nation», im göttlichen Auftrag der Welt zum Erlöser bestimmt, sich im Falle eines Scheiterns an Gott versündigen würde. Maßlose Ängste waren die ständigen Begleiter des tugendhaft überfrachteten Selbstbildes, Überidentifikation mit dem Guten und Dramatisierung des Bösen gingen Hand in Hand. Nicht umsonst sprechen Historiker von einer Obsession in prekärer Nähe zu Hysterie und Paranoia.[1] Ein Verlangen nach «totaler Sicherheit» war darin eingeschrieben, ebenso die Neigung, Verlustängste als Mittel der politischen Mobilisierung auszubeuten. Das meiste Kapital heimsten am Ende jene Angstunternehmer ein, die Amerikas Existenz hauptsächlich von außen bedroht sahen und das politische Immunsystem mit einer Mixtur aus Religion, Moral und imperialem Auftrumpfen stärken wollten. Wenn die Nation überleben soll, so ihre Zauberformel, muss sie global als Ordnungsmacht auftreten – also militärisch dominieren. Nur dann wird sich die Macht des Lichts gegen die Kräfte der Finsternis behaupten können.
Am 6. August 1945 fielen die Würfel endgültig zugunsten der «Interventionisten». Dass Präsident Harry Truman über die nukleare Einäscherung Hiroshimas hellauf begeistert war und vom «größten Ding in der Geschichte» sprach, spiegelte die Erwartungen des Weißen Hauses. Im unmittelbaren Umfeld des Präsidenten galt die Atombombe als außenpolitischer Quantensprung. Mit ihr, so hieß es allenthalben, hätte man einen «Royal Straight Flash» in der Hand, ein unschlagbares Blatt beim Pokern um Macht, Einfluss und Hegemonie.[2] Die Allmachtphantasien wurden von der Realität alsbald eingeholt und als solche entlarvt. An den Folgen amerikanischer Atompolitik hingegen trägt das Land wie der Rest der Welt bis heute schwer. Am Rüstungswettlauf sind auch zahlreiche andere Großmächte mit Überzeugung und Entschiedenheit beteiligt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Amerikas Ordnungspolitik auf Gewalt gegründet war und diesen Makel nie wieder loswurde. Nie wieder loswerden konnte, um genau zu sein, weil der politische Zugewinn prall gefüllter Atombunker bis heute allzu verlockend ist.
Wann, wie und warum Atompoker gespielt wurde, ist im zweiten Kapitel nachzulesen: «Casino Royale: Zocken mit Nuklearwaffen». Wie alle, die im Laufe der Zeit die einschlägigen Spielregeln lernten, stecken die USA seit Beginn des Atomzeitalters in einer Falle. Man weiß, dass Nuklearwaffen den eigenen Untergang heraufbeschwören können – trotzdem basteln Planungsstäbe und andere Militärexperten seit Jahrzehnten an Szenarien für einen begrenzten, kontrollierten und am Ende gewinnbaren Krieg. Man weiß, dass jeder «Sieg» mit Hekatomben von Toten auf allen Seiten bezahlt würde – und klammert sich dennoch an die Illusion, aus militärisch stumpfen Waffen hin und wieder politischen Mehrwert schlagen zu können. Man weiß, dass die Kopie eigener Waffensysteme durch die Gegenseite nur eine Frage der Zeit ist – und will dennoch nicht von der fixen Idee lassen, sich mit technologischen Durchbrüchen einen vorübergehenden Vorteil zu verschaffen. Das gemeinhin zur Entschuldigung vorgetragene Argument ist so alt wie die besagte Politik selbst: Waffen werden gehortet, weil man einander nicht traut, also muss zuerst das Misstrauen aus der Welt. Umgekehrt wird eher ein Schuh daraus: Sobald Waffenkammern entrümpelt werden, versiegt die Urquelle des Misstrauens. Dass außer den USA auch andere in die Pflicht zu nehmen wären, ist kein Einwand. Washington hat durch Desinteresse, Unterlassung und ungezählte Querschüsse entscheidend zur Verstetigung des toxischen Kreislaufs beigetragen.
Als Nuklearmacht stiegen die USA – seit 1945 ohnehin die unbestrittene Nummer Eins – in eine noch höhere Gewichtsklasse auf. Sie meldeten geopolitische Ansprüche an und gingen Verpflichtungen ein, die sie sich mit konventionell ausgerüsteten Streitkräften schwerlich hätten leisten können.[3] Ablesbar ist diese selbst verordnete Aufwertung an der Karriere des Adjektivs «vital». Niemals zuvor hatte man derart häufig und penetrant über «lebenswichtige Regionen» jenseits der eigenen Grenzen gesprochen.
Auf diese Weise wurden nicht nur zusätzliche Reibungspunkte geschaffen; man glaubte auch, den neuen Status ständig unter Beweis stellen zu müssen. Glaubwürdig war dieser Logik zufolge nur, wer seine Machtmittel gerade an Orten ohne erkennbare strategische, wirtschaftliche oder politische Bedeutung zur Geltung brachte. Zentrum und Peripherie galten in diesem Sinne als gleichwertig, die Symbolik der Tat färbte vom einen auf das andere ab. Immer schien es ums Ganze zu gehen, überall lauerten angeblich existenzbedrohende Gefahren, noch im hintersten Winkel mussten Grenzen gezogen und Ansprüche verteidigt werden. Unter der Hand, so die Historikerin Barbara Tuchman, wurde das Streben nach Glaubwürdigkeit bis zur Selbsthypnose aufgebläht.[4] Den Nutzen hatten «Putschisten und weitere Stellvertreter» (dargestellt im dritten Kapitel) auf allen Kontinenten, den mit Abstand größten Schaden jene Länder, in denen die USA Staatsterroristen gewähren ließen oder sich selbst zu Komplizen machten. Näheres ist im vierten Kapitel («Auf Gewalt gegründet: Südvietnam, Indonesien, Lateinamerika») zu erfahren.
Seit der Wende zur globalen Ordnungsmacht geistern drei Vorgaben wie Untote durch Washingtons Außenpolitik. Erstens: Vorherrschaft ist unverzichtbar. Stabilität gibt es nur auf der Grundlage amerikanischen Übergewichts und unter der Voraussetzung, dass die USA mehr auf die Waage bringen als Störenfriede oder ernsthafte Konkurrenten; Sicherheit basiert auf militärischer Dominanz und wird in erster Linie mit militärischen Mitteln hergestellt. Zweitens: Eine Ordnungsmacht muss den Willen zur Gewalt demonstrieren, andernfalls entgleitet ihr die Ordnung. Wirksame Außenpolitik kann nur betreiben, wer das Handwerk der Einschüchterung, Nötigung und Erpressung beherrscht und den Rest der Welt von seiner Bereitschaft zum Risiko überzeugt – das Wagnis eines Einsatzes von Nuklearwaffen eingeschlossen. Drittens: Macht beruht auf Angst. Oder auf dem Wissen von Opponenten, im Fall eines militärischen Kräftemessens nicht mithalten zu können. Also bleibt der Frieden gewahrt, solange andere mehr Angst vor dem Krieg haben als man selbst. Und weil Amerika von der Unsicherheit derer zehrt, die seine Interessen nicht teilen, gehört die Inszenierung von Unberechenbarkeit zur hohen Kunst der Diplomatie. Wie schnell daraus ein Krieg gegen Zivilisten, ein nach internationalem Recht verbrecherischer Krieg, werden kann, wird im fünften Kapitel erörtert («Gewinnen um jeden Preis: Kriege in der Dritten Welt»).
«America First» kann als Übersetzung dieser Dogmen in eine parteiübergreifende und wahlkampftaugliche Parole gelesen werden. Sie bekräftigt den Anspruch, Frieden mit einer Anhäufung von Kriegsgerät zu schaffen. Sie treibt die monströsen, das Budget aller anderen Nationen weit in den Schatten stellenden Rüstungsausgaben der USA stetig nach oben und befeuert die Gier nach neuen, qualitativ überlegenen Waffen. Und sie beutet die Ressource Nationalismus wie eine beliebig erneuerbare politische Energie aus. Nationale Alleingänge so weit wie möglich, Kooperation und Multilateralismus nur so weit wie unbedingt nötig, damit unterstreichen die Vereinigten Staaten ihre Sonderstellung als angeblich «größte Nation» auf Erden, aller Zeiten und von Gottes Gnaden. Die Girlanden sind austauschbar, der Markenkern aber bleibt. «America First» ist keine Marotte eines Einzelnen, sondern die außenpolitische Partitur aller Präsidenten bis zum heutigen Tag. Unterschiede in Stil und Rhetorik sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Zweifel ein atavistischer Grundsatz gilt: Der Starke herrscht, der Schwächere folgt, der Schwächste duldet.
Auf eine Selbstkorrektur der USA zu hoffen, scheint nach Lage der Dinge illusorisch. Dass Präsident Clinton den Putsch in Guatemala als Fehler bezeichnete, dass Barack Obama um eine Normalisierung der Beziehungen zu Kuba bemüht war und sich sogar die Vision einer atomwaffenfreien Welt zu eigen machte, waren bemerkenswerte Gesten. Aber am Ende immer nur das – Gesten. Sie blieben ebenso folgenlos wie die vom Kongress Mitte der 1970er Jahre angestoßenen Bemühungen zur Zähmung der Geheimdienste im Besonderen und des «nationalen Sicherheitsstaates» im Allgemeinen. Die Gründe des Scheiterns sind vielfältig. Zu den wichtigsten zählt das Beharrungsvermögen jener Institutionen, die zur Verwaltung der Ordnungspolitik geschaffen worden waren und im Laufe der Jahre wie deren Gralshüter auftraten. Sie konnten obendrein auch noch auf die Unterstützung freiwilliger Wächter des Imperiums setzen – von Mandatsträgern im Kongress, Intellektuellen oder medialen Meinungsmachern. Das ist der Schwerpunkt des sechsten Kapitels: «Selbstblockade: Reformen im Leerlauf».
Als der Kalte Krieg mit der Implosion der Sowjetunion zu Ende ging, öffnete sich für die Dauer eines Jahrzehnts ein Fenster der Gelegenheit. Bekanntlich wurde auch diese Chance verspielt. Obwohl die Sicherheit des Westens weniger denn je bedroht war, legten die USA ihre Instrumente zur Abwehr realer oder imaginierter Bedrohungen nicht aus der Hand. Im Gegenteil: Man holte sich wieder einmal die fortgeschrittenste Waffentechnik ins Haus und forcierte sogar die Ausweitung der NATO. Misstrauen blieb die Hauptwährung in den Ost-West-Beziehungen, wie gehabt mit eingepreistem Inflationsrisiko. Wobei strittig ist, was den Ausschlag gab: Die vom Triumph über den Erzrivalen aufgeblasene Selbstüberschätzung oder die traditionellen Reflexe zur Demonstration von Macht, Durchsetzungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit. Das siebte Kapitel («Alleinige Supermacht: Baupläne für eine ‹Neue Weltordnung›») beleuchtet diese Zusammenhänge.
In jüngster Zeit zeichnet sich ein weiterer und vermutlich der gewichtigste Grund für das verkrampfte Festhalten am globalen Ordnungsanspruch ab. Die Angst vor Gesichtsverlust und Niedergang, forciert durch eine neue Welle des internationalen Terrorismus. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Imperium seinen Abstieg mit Zähnen und Klauen zu bremsen versucht, egal, ob Freunde oder Verbündete darunter leiden oder ob Gegner dadurch erst recht provoziert werden. Darum geht es im achten Kapitel «Verbrannte Erde: Zwei Jahrzehnte ‹Krieg gegen den Terror›». Spätestens an dieser Stelle wird man an die Vitalität des amerikanischen Nationalismus erinnert. Er ist und bleibt das Grundmotiv, Kooperation und Gegenseitigkeit sind nur so lange von Interesse, wie sie zur besseren Durchsetzung amerikanischer Anliegen taugen. Die vielzitierten Koalitionen der Willigen passen ins Bild. Sie sind phasenweise nützlich, aber entbehrlich, sobald keine Machtdividende abfällt. Unberechenbar ist diese Spielart imperialer Selbstbehauptung, weil Washington wie eh und je an seinem auf das Militärische fixierten Verständnis von Sicherheit festhält – welche Hypotheken für die Zukunft daraus erwachsen, wird im neunten Kapitel erörtert: «Fortsetzung folgt: Die Macht der Angst».
Trotz alledem geht noch immer ein politisches Glaubensbekenntnis um: Sobald die USA als Ordnungsmacht ausfallen, droht Chaos, die Vereinigten Staaten sind und bleiben als politischer Fixstern unverzichtbar. In weiten Teilen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens verfängt dieses Mantra nicht, ausweislich der dortigen Erfahrungen kann es auch nicht anders sein. Aber in Europa, vorweg im Osten des Kontinents und in Deutschland, finden sich noch immer zahlreiche Anhänger. Leitartikel, Parteiprogramme und Parlamentsdebatten quellen mit den einschlägigen Argumenten über: Wir brauchen die Vereinigten Staaten, weil nur dort in konsequenter Weise geopolitisch und strategisch gedacht wird. Mit ihrem nuklearen Schutzschirm sorgen die USA für die Sicherheit ihrer Verbündeten, weil sie sich selbst verwundbar machen und dem gemeinsamen Gegner die Vergeblichkeit militärischer Aggression vor Augen halten. Sollte Washington hier und da über die Stränge schlagen, wird das Pendel wieder zurückschwingen, weil eine über Jahrzehnte wohl dosierte Mischung aus Entschlossenheit und Entspannung, Härte und Dialog, Führung und Dominanz zum Basisinventar seiner Außenpolitik gehört. Amerika darf Sonder- und Eigeninteressen verfolgen, weil am Ende jeder Verbündete davon profitiert. Wir können uns einen Dissens in Grundsatzfragen nicht leisten, weil die Feinde der Demokratie nur auf einen Schwächeanfall der USA warten. Eine gemeinsame Kultur, geteilte Werte und der unverwüstliche Geist der Aufklärung fallen stärker ins Gewicht als politische Kontroversen, daran ändern auch amerikanische Alleingänge nichts. Und so weiter und so fort in ständiger Variation eines von Winston Churchill auf die Demokratie gemünzten Spruchs. Demnach mögen die USA als Ordnungsmacht noch so miserabel sein, man sollte es aber hinnehmen, weil alle anderen noch miserabler sind.
Darüber ist zu streiten. Wie und mit welchem Ziel ist Gegenstand der «Gedanken zu einer Unabhängigkeitserklärung» im Nachwort. Sie gehen von der Antiquiertheit des amerikanischen Verständnisses von Sicherheit aus. Stur auf das Militärische fixiert, hält es Misstrauen am Leben und bewirkt dadurch das Gegenteil des Gewünschten, nämlich zusätzliche Unsicherheit. Wer Europa außenpolitisch verstärkt in die Pflicht nehmen will und mehr Verantwortung anmahnt, sollte sich von der Idee verabschieden, dass Rüstung ein Gradmesser von Glaubwürdigkeit oder ein geeignetes Mittel im Umgang mit globalen Umbrüchen ist. Ein Denken, das auf die Macht des Stärkeren und auf die Effizienz von Drohgebärden setzt, durch ein Nachdenken über die Zivilisierung von Konflikten zu ersetzen – darin liegt die Herausforderung. Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky haben vor gut 50 Jahren eine Antwort von zeitloser Attraktivität vorgeschlagen: Sicherheit ist angesichts aktueller und künftiger Herausforderungen nicht länger gegeneinander, sondern nur noch miteinander zu erreichen, es werden alle zusammen verlieren, wenn sie nicht gemeinsam gewinnen wollen. Dass Russland in den letzten Jahren seine finsteren Seiten hervorkehrt und China wie ein Raufbold auftritt, ist zweifellos richtig. Aber kein Einwand. Es unterstreicht vielmehr die Notwendigkeit einer Politik der gemeinsamen Sicherheit.
Zuschnitt und Umsetzung dieser Politik liegen noch im Ungefähren, ihre Prämisse indes ist klar umrissen: Nicht auf das Durchsetzen, sondern auf den Ausgleich von Interessen, nicht auf die Sprache der Macht, sondern auf eine Grammatik des Vertrauens kommt es an. Anders gesagt: Internationale Kooperation ist erst dann mehr als eine Phrase, wenn sie mit der Bereitschaft zum Teilen einhergeht, mithin realisiert, was mit dem fast in Vergessenheit geratenen Begriff der Solidarität gemeint ist. Unter diesen Vorzeichen und gestützt auf einen politischen Paradigmenwechsel kann Europa auf originelle Weise zu den weltweiten Renovierungsarbeiten beitragen. Ohne Dominanz zu beanspruchen und Gefolgschaft einzufordern, ohne Lagerdenken, Überlegenheitsdünkel und Nationalismus. Also jenseits amerikanischer Haltungen, Ansprüche und Praktiken.
Für Gott und das Gute
Auf dem Weg zur Führungsmacht
«‹Wenn Reverend Falck›, entgegnete Doremus Jessup, ‹mir die Antwort verzeihen will, zum Teufel mir eurem: nicht möglich! Nennt mir doch ein anderes Volk, das so viel Anlage zur Hysterie hätte wie unseres. […] Wisst ihr noch: die Zeit des roten Schreckens und der Katholikenfurcht? Als jeder wohlinformierte Mann im Lande wusste, dass […] der republikanische Wahlfeldzug gegen den Katholiken Al Smith bei der Bergbevölkerung von Carolina unter der Parole geführt wurde, wenn Al siegt, wird der Papst ihre Kinder für unehelich erklären! […] Gedenkt der Night-Riders aus Kentucky und der wilden Freude, die viele unter uns über einen Lynchmord empfinden! Bei uns nicht möglich? Hat man zur Prohibitionszeit etwa nicht Leute niedergeschossen, weil sie möglicherweise Schnaps schmuggelten? […] Wir sind in diesem Moment alle bereit, zu einem Kinderkreuzzug aufzubrechen – zu einem Kreuzzug von Erwachsenen›.»[1]
Starker Tobak. Als Sinclair Lewis, erster amerikanischer Nobelpreisträger für Literatur, diese Sätze im Jahr 1935 zu Papier brachte, errichtete die Regierung Franklin D. Roosevelt gerade Brandmauern gegen die Verheerungen der Weltwirtschaftskrise, während die Nazis in Deutschland und ihre Verbündeten in Italien die Krise nutzten, um die letzten Überbleibsel der Demokratie zu schleifen. Amerikas Präsident suchte umtriebig nach Mitteln gegen die Angst, während Europas Diktatoren und Autokraten auf die Maximierung von Ängsten setzten. Wie konnte man angesichts dessen auf die Idee verfallen, ausgerechnet der amerikanischen Gesellschaft eine besonders ausgeprägte Neigung zur Hysterie zu unterstellen?
In seinem Roman «It Can’t Happen Here» thematisiert Sinclair Lewis die Angst vor einer «roten Flut», also die Jahre emotionaler Überhitzung am Ende des Ersten Weltkrieges. Der Furor des «Red Scare» zielte auf «feindliche Ausländer» und streikende Arbeiter, auf Pazifisten, Sozialisten, Anarchisten oder alle, die im Verdacht standen, keine «100prozentigen Amerikaner» zu sein. Wie ein Lauffeuer ging die Legende um, eine verschworene Minderheit hätte es – vom Ausland unterstützt, wenn nicht gesteuert – darauf abgesehen, die «Festung Amerika» auszuhöhlen und letzten Endes zu Fall zu bringen. Verräter hatten sich angeblich allerorts eingenistet, eine große Koalition staatstreuer Bürger fühlte sich zum Abwehrkampf aufgerufen und benahm sich entsprechend. In der Provinz wie in Großstädten wurden Bürgerwehren mit zehntausenden von Mitgliedern gegründet. Mal zwangen sie streikende Arbeiter mit Waffengewalt zum Verlassen ihrer Städte, mal machten sie Jagd auf Kriegsdienstverweigerer, mal unterstützten sie die Staatsgewalt bei der Verhaftung und Deportation von «Roten». Dass die «Bolschewiken» entweder ihre Haltung ändern oder am Strick baumeln müssten, verkündeten Redakteure des «United Presbyterian»; ähnliches war aus den Reihen etablierter Parteien, einschließlich der «Progressive Party», zu hören, von der Presse ganz zu schweigen, die bis zur «New York Times» ihrer Gier nach aufwühlenden, die Auflage steigernden Nachrichten nachgab.[2]
Diesem Phänomen wollte Sinclair Lewis auf den Grund gehen. Was erklärt die politischen Ängste, Leidenschaften und Affekte? Woher rühren die Verwundbarkeitsphantasien? Warum folgte ein Gutteil der Gesellschaft den Aufrufen zu einem politischen Kreuzzug? Die Fragen stellten sich umso mehr, als die kollektive Erregung nicht nachließ. Sie verlagerte sich nur und bestimmte seit 1920 die Debatte über Amerikas außenpolitischen Kurs.
Eine Welt nach amerikanischer Fasson
«Wie Ordnung schaffen» war das Reizthema in der Zwischenkriegszeit schlechthin. Gut 20 Jahre lang lieferten sich zwei Lager im Parlament und in den Medien erbitterte Wortgefechte: «Isolationisten» auf der einen, «Internationalisten» auf der anderen Seite. Wobei diese Etiketten allenfalls zur Grobsortierung taugen. Denn die so genannten Lager waren weder personell noch programmatisch gefestigt. Eher sollte man von wetterwendischen Koalitionen sprechen, die untereinander viel Gemeinsames teilten und deshalb für Wendemanöver taugten. Das gilt nicht zuletzt mit Blick auf die wichtigste Kontroverse, nämlich den Streit darüber, welchen Umfang die Streitkräfte haben und welchen Gebrauch die USA davon machen sollten.
«Wir haben keinen göttlichen Auftrag, als Weltpolizist aufzutreten. Hoch gerüstete Nationen sind als Friedensstifter so wenig geeignet wie bis an die Zähne bewaffnete Individuen.»[3] Mit diesem Satz sprach Louis Ludlow, Abgeordneter des Staates Indiana im Repräsentantenhaus, einer buntscheckigen Schar von Unterstützern aus der Seele. Politiker beider großen Parteien, Gewerkschafter, Kirchenvertreter aller Denominationen, Frauenrechtler, Farmer, Industriearbeiter, Studenten, Professoren, Konservative, Liberale, Sozialisten und Kommunisten sowieso, sie alle konnten sich auf die Forderung nach außenpolitischer Zurückhaltung einigen – Seit’ an Seit’ mit Xenophoben und Rassisten, die sich zu ihnen gesellten, weil sie ihrem Land eine Kontaktsperre zu «minderwertigen Rassen» auferlegen wollten. Von einer Bewegung sollte man nicht sprechen, dafür war der Zusammenhalt zu fragil. Aber diese Schwäche wurde über Jahre wettgemacht durch das Auftreten wortgewaltiger Anführer. Senatoren vom Schlage eines William E. Borah, Robert M. LaFollette Jr., George Norris, Hiram Johnson, Gerald P. Nye, Burton K. Wheeler und Henry Cabot Lodge wussten, wie man im Parlament Mehrheiten zimmert oder die Gegenseite blockiert. Als «Anti-Imperialisten» oder «Isolationisten» hatten sich einige seit der Jahrhundertwende einen Namen gemacht und wurden dafür von Wählern im ländlichen Mittleren Westen, Süden, Nordosten und in Kalifornien ebenso honoriert wie in Großstädten von New York bis St. Louis.
Gegen eine Welt nach amerikanischer Fasson hatten die «Isolationisten» keine Einwände. Im Gegenteil. Fraglich war die Wahl der Mittel. Eine interventionistische Außenpolitik, so ihr Einwand, fördert einen starken Militärapparat, dieser aber vergiftet die Demokratie an der Wurzel. Was damit gemeint war, konnte man von September 1934 bis Februar 1936 in öffentlichen Kongressanhörungen über die «Händler des Todes» oder in sage und schreibe sieben Abschlussberichten, ein jeder hunderte von Seiten stark, erfahren. Senator Gerald P. Nye hatte einen nach ihm benannten Untersuchungsausschuss auf die Beine gestellt, der buchstäblich alle Ecken amerikanischer Militärpolitik seit dem Ersten Weltkrieg auskehrte. Es ging um Rüstungsprofite und Kriegstreiberei, um zweifelhafte Verbindungen zu ausländischen Konzernen und Regierungen, um Korruption und maßlos überhöhte Preise zu Lasten der Allgemeinheit, um die künftige Besteuerung von Waffenproduzenten, wenn nicht gar um die Verstaatlichung ihrer Betriebe. Über allem aber schwebte die Warnung vor einer schleichenden Entmachtung des Parlaments, also die Sorge, dass die Exekutive unter Berufung auf «nationale Sicherheit» ihre Kompetenzen überschreitet und am Ende die Gewaltenteilung aushebelt. Was Jahrzehnte später, während des Vietnamkrieges, anhand von Stichworten wie «militärisch-industrieller Komplex» oder «national security state» diskutiert wurde, fand hier ein inspirierendes Vorbild.[4]
Kaum hatten sie den Beitritt ihres Landes zum Völkerbund abgewendet, feierten die «Isolationisten» mit der Demontage der amerikanischen Kriegsmaschine einen noch größeren Erfolg. Wäre der «National Defense Act» aus dem Jahr 1920 umgesetzt worden, hätten 280.000 GIs und 500.000 Nationalgardisten unter Waffen gestanden. Stattdessen kamen die Streitkräfte des Bundes bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht über 55.000 einsatzfähige Soldaten hinaus, der Personalbestand der Nationalgarde blieb mit 180.000 Mann gleichermaßen weit unter dem anvisierten Niveau. Von der Marine abgesehen, war das Militär der Vereinigten Staaten ein Torso. Im Fall einer Mobilmachung hätte jedes vierte Infanterieregiment ohne Offiziere dagestanden, das routiniert vorgetragene Bekenntnis aller politischen Fraktionen zu einer starken Landesverteidigung klang hohl. Einer seit dem 18. Jahrhundert lebendigen Tradition verpflichtet, hätten viele Amerikaner, wie die Zeitschrift «Harper’s Magazine» bissig bemerkte, ihre Armee gerne an einem warmen, hellen Platz gesehen – ausgestopft im Museum.[5]
Auch in der Debatte über die «Neutralitätsgesetze» sahen die «Isolationisten» lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Auf Betreiben ihrer Abgeordneten und Senatoren stimmte der Kongress vom Sommer 1935 bis zum Frühjahr 1937 dreimal gegen eine Unterstützung kriegsführender Staaten mit Waffen, Krediten und Anleihen. Der Versuch, die Regierung in außen- und sicherheitspolitischen Belangen zu zügeln, gipfelte Anfang 1938 im «War Referendum»-Antrag des Abgeordneten Louis Ludlow. Demnach hätten die Wähler in einer Volksabstimmung über jeden Kriegseintritt der USA entscheiden müssen. Und ein Zusatzartikel zur Verfassung sollte gewährleisten, dass sich daran auch in ferner Zukunft nichts änderte. In Meinungsumfragen sprachen sich um die 70 Prozent für Ludlows Vorschlag aus, das Repräsentantenhaus wies ihn dagegen mit 209 gegen 188 Stimmen zurück, ehe der Senat die Initiative endgültig zu Fall brachte. Wie immer derlei Voten einzuschätzen sind, eines war schwerlich zu bestreiten: dass es quer durch alle sozialen Schichten und politischen Gruppierungen massive Einwände gegen Amerika in der Rolle einer globalen Ordnungsmacht gab.[6]
Dennoch gerieten die «Isolationisten» zusehends in die Defensive. Sie hatten es mit Kontrahenten zu tun, die nicht minder vehement auftrumpften. Die Kraftquelle für Amerikas innere Stärke, so das Schlüsselargument der «Internationalisten», liege in der Expansion nach außen. Will heißen: Die USA müssen in der Welt regulierend eingreifen, um Wohlstand und Stabilität zu Hause dauerhaft zu sichern – idealerweise durch den Austausch von Waren und Kapital, nötigenfalls auch mit militärischen Mitteln. Dergleichen hatte man mit viel Fanfare bereits um die Jahrhundertwende aus dem Mund führender Politiker, allen voran die Präsidenten Theodore Roosevelt und William McKinley, sowie von Intellektuellen, Journalisten und Kirchenoberen gehört. Die Kontrolle über die Philippinen zu gewinnen oder die Inselgruppe gleich ganz zu annektieren, gehörte wie selbstverständlich zu ihren Reden während des Krieges gegen Spanien im Jahr 1898. Wobei eine Art religiöse Selbstverpflichtung mitschwang, bei allen, die von einem Erziehungsauftrag gegenüber unterentwickelten Kulturen sprachen, aber auch bei jenen, die das amerikanische Gesellschaftsmodell weltweit multiplizieren wollten, weil mit ihm die historische Evolution vorgeblich ihren Höhepunkt erreicht hatte.[7]
Davon abgesehen präsentierten die Wortführer der «Internationalisten» während und nach dem Ersten Weltkrieg ein wuchtiges Programm. Mit dem Schlagwort «permanent preparedness» verbanden sie die Forderung nach einem Militärapparat, der jederzeit einsatzbereit war und faktisch Kriege aus dem Stand führen konnte – auf dem amerikanischen Kontinent sowieso, aber auch andernorts. Davon wollte, wie gesagt, lange Jahre nur eine Minderheit etwas wissen. Aber die «Interventionisten» hatten einen gewichtigen Vorteil auf ihrer Seite. Sie waren mit den Schaltzentralen der Macht besser vernetzt als die Konkurrenz. Ehemalige Minister und hohe Militärs trommelten für ihre Sache, Standesvertretungen freier Berufe und sämtliche Niederlassungen der Handelskammer ebenfalls, von der Unterstützung durch große Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen gar nicht zu reden. Auf lange Sicht sollte sich ihre Lobbyarbeit am meisten bezahlt machen. Organisationen wie die «Army League», die «Navy League», die «American Defense Society» und die «National Security League», das Flaggschiff der «Preparedness»-Advokaten, hielten das Thema nicht nur hintergründig bei Parteien und Parlamentariern im Gespräch. Sie konnten sich auch auf die journalistischen Meinungsführer bei der «New York Herald Tribune», der «New York Times» und im Imperium des Henry-Luce-Konzerns verlassen.
Der größte Glücksfall für die «Internationalisten» war die Wahl von Franklin Delano Roosevelt zum Präsidenten. Wie er sich Amerikas globale Rolle vorstellte, wusste er bei seinem Amtsantritt im März 1933 selbst noch nicht genau. Oder er ließ die Öffentlichkeit mit Bedacht im Unklaren. «Es ist einfach schrecklich, die Führung übernehmen zu wollen und dann bei einem Blick über die Schulter zu bemerken, dass keiner hinter einem ist.»[8] Dass die USA künftig als Ordnungsmacht auftreten müssten, stand für ihn dennoch außer Frage – spätestens als die Machthaber in Deutschland und Japan darangingen, ihre Ambitionen mit Blut und Eisen durchzusetzen. Im Herbst 1937 machte sich Roosevelt an sein politisches Meisterstück – die Isolation der «Isolationisten». Vier Jahre sollte die Kontroverse über ein neues Einberufungsgesetz, über die Bevorratung strategischer Rohstoffe, über den Ausbau der Marine, über die Bewaffnung amerikanischer Handelsschiffe und insbesondere über Rüstungsexporte an befreundete Staaten dauern. Mit welchen Finessen der große Jongleur im Weißen Haus den Kongress allmählich auf seine Seite zog und einen Meinungsumschwung in der Öffentlichkeit auf den Weg brachte, sucht seinesgleichen. Mitte November 1941, wenige Tage vor dem japanischen Angriff auf den US-Militärstützpunkt in Pearl Harbor, hatte er sein Ziel erreicht. Die «Neutralitätsgesetze» waren ausgehöhlt, die Opposition, von Kompetenz und Charisma des Präsidenten überfordert, trat polternd den Rückzug an.
«America First», Verlustängste und Sicherheitsphantasien
Der Clou der Geschichte ist indes anderswo zu suchen – nicht im tagespolitischen Getöse und im Gerangel um öffentliche Aufmerksamkeit, vielmehr in der ideellen Verwandtschaft von «Isolationisten» und «Internationalisten». Beide teilten weltanschauliche Prämissen von hoher Verbindlichkeit, Hintergrundannahmen, die Amerikas künftige Globalpolitik prägten. Gemeint sind ein überzüchteter Nationalismus, ausufernde Verlustängste und das Phantasma totaler Sicherheit. Darauf fußen die Vorstellungen von Stabilität und Ordnung noch heute.
An erster Stelle ist der missionarische Nationalismus zu nennen. Er handelt im Kern von Amerika als einer «Erlösernation», die im göttlichen Auftrag für die Verteidigung der Freiheit auf Erden sorgt. Gewiss huldigt man auch andernorts der Vorstellung, auserwählt oder gesegnet zu sein. Aber in den USA wird dieser Glaube auf die Spitze getrieben: Gott hat einen Plan für die Welt und die USA setzen ihn unter seiner Aufsicht um. Deshalb klingen Präsidenten von Abraham Lincoln bis Joe Biden, Schriftsteller wie Herman Melville und puritanische Prediger wie Jonathan Winthrop zum Verwechseln ähnlich, wenn sie davon reden, dass die Augen der Welt auf die «maßgebliche Nation» Amerika gerichtet sind, dass Amerika als «führende Kraft des Guten» die «Arche der Freiheiten dieser Welt» über Wasser hält oder dass Amerika «die beste und letzte Hoffnung» der Menschheit verkörpert.[9] Die Nummer Eins zu sein, so der gemeinsame Nenner, ist Amerikas Geburtsrecht. Alteingesessene lernen diesen Katechismus von Kindesbeinen auf, für Einwanderer ist er die Eintrittskarte in die neue Welt: Amerika gibt den Takt vor, weil es dazu berufen ist; solange die Vereinigten Staaten reüssieren, gewinnt die gesamte Welt; wenn die Nation mit der größten Nähe zu Gott versagt, scheitert der Schöpfungsplan. «America First» verdichtet das Selbstbild seit den 1930er Jahren zu einer griffigen, parteiübergreifenden Parole: Unilateralismus so weit wie möglich, Multilateralismus nur so weit wie unbedingt nötig, je größer die Handlungsfreiheit der USA, desto besser gedeiht die globale Ordnung. Ob man diese Variante des Nationalismus – die Behauptung, allen anderen Nationen fundamental überlegen zu sein – als amerikanischen «Exzeptionalismus» oder als «Zivilreligion» bezeichnet, ist zweitrangig. Am Ende geht es um Dogma, Unveräußerlichkeit und Unantastbarkeit.
Politisch relevant wird dieses Selbstbild wegen seiner angstbesetzten Kehrseite. Die Panik vor einem teils hausgemachten, teils von Fremden gesteuerten Niedergang durchzieht die Geschichte des Landes derart, dass ein bekannter Historiker das mittlerweile geflügelte Wort vom «paranoiden Stil amerikanischer Politik» geprägt hat.[10] Es bezeichnet eine nicht enden wollende Litanei über Feinde allerorts und die maßlose Dramatisierung von Gefahren. In diesem Irrgarten kommen selbst harmlose Kritiker in Übergröße daher: Katholiken, die für Einflüsterungen des Vatikans empfänglich schienen; Gegner der Sklaverei, weil Großbritannien angeblich ein Interesse an ihrer Agitation hatte; streikende Arbeiter, denen das amerikanische Wirtschaftsmodell nicht wie des Weltgeistes letzter Schluss einleuchtete. Immer geht es ums Ganze, stets hat es den Anschein, als könnte sich die kleinste Abweichung zur tödlichen Gefahr auswachsen. Auch hier spielt Religiöses eine tragende Rolle, vorweg die Furcht, sich im Falle eines Scheiterns an Gott zu versündigen. Die inflationären Reden über «Entscheidungsschlachten» gegen namhafte wie namenslose, sichtbare wie unsichtbare Gegner als Ausdruck von Hysterie zu belächeln, ist ebenso naheliegend wie irreführend. Der «paranoide Stil» handelt vielmehr von niedrigen Toleranzschwellen und der Gewohnheit, minimale Möglichkeiten in maximale Wahrscheinlichkeiten umzudeuten. Oder von der Versuchung, im Namen der Ordnung alles und jedes zum Quellpunkt von Unordnung zu erklären. Dass die Maßstäbe, zwischen Risiko, Bedrohung und Gefahr zu unterscheiden, auf der Strecke bleiben, ist der Preis einer unablässigen Jagd nach Monstern, die es zu zerstören gilt.[11]
So erklärt sich das Verlangen nach «totaler Sicherheit» und der diesbezügliche Überbietungswettbewerb. Kein anderes Thema nahm in der Zwischenkriegszeit die politische Debatte in den USA derart in Beschlag. Republikaner und Demokraten, «Isolationisten» und «Internationalisten» setzten es auf die Tagesordnung, lärmend unterstützt von Veteranenorganisationen, Unternehmerverbänden und besorgten Erziehern, von Medien, Bürgerwehren und selbsternannten Vigilanten. Während des «Red Scare» zwischen 1919 und 1921 stand die Immunisierung gegenüber sozialistischem Gedankengut und die Verbannung seiner Repräsentanten auf der Tagesordnung, ehe eine von «Graswurzelaktivisten» und Eliten gleichermaßen angeheizte Kampagne für «100 Prozent Amerikanismus» das Land knapp 20 Jahre in Atem hielt. Ordnung durch Homogenität: So lässt sich der Feldzug gegen nicht assimilierte Einwanderer, Linke und sonstige Aktivisten – also gegen Irritierendes, Unangepasstes und Widerständiges jedweder Gestalt – charakterisieren. Dass Franklin D. Roosevelt, auf dem Höhepunkt einer noch nie dagewesenen Wirtschaftskrise gewählt, gegensteuern wollte, beruhigte die Lage nur vorübergehend. Auf lange Sicht schärfte sein Versprechen «uneingeschränkter Sicherheit» paradoxerweise die Sensibilität für reale und imaginierte Unsicherheiten. Es war die Geburtsstunde eines Verständnisses von Ordnung, das gegen alle Eventualitäten gewappnet sein will und deshalb einer vorbeugenden Risikobekämpfung das Wort redet – egal, wie plausibel ein Bedrohungsszenario ist.[12]
Das Plädoyer für «totale Sicherheit» verfing angesichts des heraufziehenden Weltkrieges erst recht. Am auffälligsten war die veränderte Tonlage in den Reihen der «Isolationisten». Von einem undurchdringlichen Schutzschild über der gesamten amerikanischen Hemisphäre war die Rede, von vorgeschobenen Basen in Mittel- und Lateinamerika und forcierten Investitionen in die wichtigste Waffengattung der Zukunft – die Luftwaffe. Einer ihrer Wortführer, General Robert E. Wood, untermauerte sogar das Recht Washingtons auf einen Regimewechsel außerhalb der Landesgrenzen: «Wir werden keine Regierung in Mexiko, der Karibik, Zentral- und Lateinamerika tolerieren, die den Vereinigten Staaten nicht freundlich gesonnen ist. Falls nötig, werden wir zur Durchsetzung unserer Interessen Gewalt einsetzen.»[13] Er hätte auch sagen können: Wir verurteilen Kriege nur, solange sie von anderen angezettelt werden. Am Ende rafften sich die Isolationisten noch einmal zu der spektakulären Forderung auf, bei der Entscheidung über Krieg und Frieden den Wählern in einem Referendum das letzte Wort zu geben. Je geschickter allerdings die politische Klasse um Franklin D. Roosevelt das Land durch die Turbulenzen der Zeit steuerte, desto weniger verfing das gegen Washington gerichtete Misstrauen. Somit waren die Differenzen zwischen «Isolationisten» und «Internationalisten» längst verwischt, als Japan und Deutschland gegen die USA in den Krieg zogen. Das beste Gespür für die Sprache der Mobilisierung zeigte der Verleger Henry Luce: «Amerikanische Erfahrung ist der Schlüssel für die Zukunft. Amerika wird der große Bruder in einer internationalen Staatsbruderschaft sein.»[14]
Was sich während des Zweiten Weltkrieges im Inneren der USA abspielte, stimmte das Land auf eine dauerhafte Akzeptanz seines hochgerüsteten Militärapparates ein. Unternehmer, die 25 Jahre früher aus Angst vor staatlichem Dirigismus noch zur Waffenproduktion hatten gezwungen werden müssen, boten ihre Dienste freiwillig an und investierten im Übermaß, Gewerkschaften und Bürgerrechtsorganisationen riefen zum sozialen Frieden, sprich zum Streikverzicht, auf, Bürgermeister rissen sich um Aufträge aus dem Etat des Pentagon. Ganz besonders machte eine große Koalition aus Kapital und Arbeit seit 1944 landesweit gegen einen Rückbau der Rüstungsindustrie Front, teils, weil man im Nachkrieg eine neuerliche Depression fürchtete, teils, weil man auf die Zusatzeinkommen aus der Staatskasse nicht verzichten wollte – allein an die Westküste waren 70 Milliarden Dollar geflossen. «San Diego steht vor der Alternative», so die dortige Industrie- und Handelskammer, «nach dem Krieg entweder zur Geisterstadt zu werden, oder ihre gegenwärtigen Industrien beizubehalten und zu einer großen Metropole aufzusteigen.» Ähnliches war aus Dutzenden anderer Städte zu hören. Der Traum eines immerwährenden Aufschwungs mit Hilfe von Panzern, Flugzeugen und Raketen hatte einige Regionen, wie das «Harper’s Magazine» meinte, besoffen gemacht.[15] So wurde eine Diskussion über den «militärisch-industriellen Komplex» abgewürgt, ehe sie richtig begonnen hatte. Darauf zielt der Begriff «unmilitaristic militarism» – auf die unverhohlene Komplizenschaft mit einer Politik, deren Folgen nicht interessierten, weil das Interesse an ihren profitablen Voraussetzungen allemal stärker war.
Aufs Ganze gesehen lässt sich feststellen, dass das Wechselspiel zwischen Allmachtsphantasien und Ohnmachtsphobie einen besonderen Typus des Staatsbürgers hervorgebracht hat: den amerikanischen Angstunternehmer. Gemeint sind zivilgesellschaftliche Aktivisten, die an der Seite staatlicher Eliten oder auf eigene Rechnung den Kampf für «Gott und das Gute» führen. Ihr Geschäftsmodell besteht darin, Loyalität zum abwehrbereiten Staat durch die Dramatisierung aller möglichen Gefahren und Ängste zu stiften. Sie engagieren sich in der Provinz ebenso wie in der Großstadt und treten in ungezählten Vereinigungen auf, mal kurzfristig in «Ein-Punkt-Bewegungen», mal in Organisationen mit längerem Atem. Einige sind leidlich bekannt, etwa die «American Protective League» aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, das «America First Committee» aus der Zwischenkriegszeit oder das «Committee on the Present Danger», erstmals aktiv in der Frühphase des Kalten Krieges und Vorbild für ähnliche Initiativen in den darauf folgenden Jahrzehnten. Die meisten Zusammenschlüsse jedoch, Anlaufstellen für Hunderttausende, finden in den Geschichtsbüchern keinen Platz – ausgerechnet sie, die mehr Freiwillige aufzubieten haben als die großen Parteien Mitglieder, ausgerechnet sie, die für ein Hintergrundrauschen mit beträchtlicher Wirkung sorgen. So sehr am Bild der Angstunternehmer noch gearbeitet werden muss, eines lässt sich schon jetzt sagen: Unablässig auf der Suche nach Monstern, die es zu zerstören gilt, machen sie nicht nur den Unterschied zwischen Risiko, Bedrohung und Gefahr unkenntlich. Sie zertifizieren zugleich alles, was dazu beiträgt, Amerika groß zu machen, indem man andere klein hält. «U.S.A.!», «U.S.A.!»: Ohne die vielfältige Mithilfe von «unten» sind die von «oben» zu verantwortenden Kosten amerikanischer Weltpolitik nicht zu verstehen. Von dieser Liaison zwischen Staat und Gesellschaft handelt Sinclair Lewis’ Roman «Das ist bei uns nicht möglich». Literarisch eher dürftig, ist das Werk politisch noch heute aufschlussreich. Es macht nämlich eine Signatur des amerikanischen Jahrhunderts kenntlich – die mehrheitsfähige Behauptung, als auserwählte Nation das Recht zu haben, sich über die Rechte anderer hinwegsetzen zu können.[16]
Casino Royale
Zocken mit Nuklearwaffen