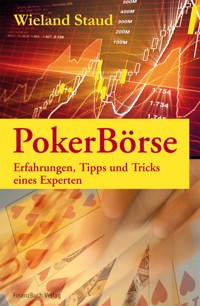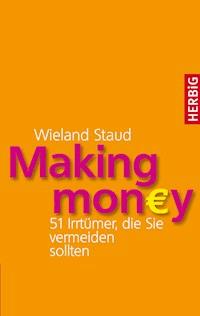
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch geht es ums Geld verdienen, Geld anlegen, Geld sparen und selbstverständlich auch darum, Geld richtig auszugeben. Es handelt von der Frage, wie man sich sinnvoll zwischen Aktien, Fonds, Zertifikaten, Bank-Sparplänen oder dem Kauf einer Immobilie entscheiden kann, und von Ratschlägen und Beratern, die nicht unbedingt nur die Bedürfnisse ihrer Kunden, sondern auch den Umsatz ihrer Arbeitgeber im Auge haben (müssen). Der Finanzexperte Wieland Staud warnt vor kleinen Stolpersteinen und fatalen Irrtümern in Geld- und Finanzfragen. Kurzweilig und garantiert verständlich erklärt er, inwieweit Timing, die Meinung der Mehrheit, Kursentwicklungen und Trends an den Finanzmärkten von Bedeutung sind, worauf man bei Krediten unbedingt achten sollte oder was sich hinter sogenannten "Steuergeschenken" verbergen kann. Zugleich zeigt er kluge alternative Anlagemöglichkeiten auf, gibt zielführende Strategien an die Hand und entwirft einen "Fahrplan zur finanziellen Unabhängigkeit", der sich auszahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Meinen Kindern Paula, Peter, Franz Meinen Eltern und Großeltern Meinen Eltern und Großeltern
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe: 2011 F.A. Herbig
Inhalt
VorwortWas eigentlich ist Geld?Die IrrtümerMacht Geld glücklich?Ein Fahrplan zur finanziellen UnabhängigkeitSchlussworteAnhangLesetippVorwort
Meister fallen nicht vom Himmel
50 Prozent aller Deutschen achten nach eigenen Angaben stark und 44 Prozent immerhin ein wenig auf eine gesundheitsbewusste Ernährung, aberwitzige 94 Prozent glauben, dass sie gute Autofahrer sind, und gefühlte 90 Prozent nehmen an, dass sie mit Geld gut umgehen können. Aber rund 55 Prozent der Deutschen sind entweder übergewichtig, fettleibig oder leiden unter Bulimie, Magersucht & Co., 2010 ereigneten sich in Deutschland mehr als 2,3 Millionen Unfälle mit fast 300 000 Verletzten und die Zahl der Privatinsolvenzen hat im vergangenen Jahr 2010 mit knapp 140 000 ein neues Rekordhoch erreicht. Zahlen, die nicht nur den Eindruck vermitteln, dass zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichen Fähigkeiten ein gewaltiges Loch klafft.
Unsere Gesellschaft legt Wert darauf, dass ihre Mitglieder ihr Können nicht nur behaupten, sondern darüber auch tatsächlich verfügen. Im Großen und Ganzen haben wir wohl auch alle den Eindruck, dass es nicht gar so falsch ist, dass ein Arzt ein 6-jähriges Studium erfolgreich absolvieren muss und ein Metzger erst nach 3 Jahren Ausbildung und einem Meisterlehrgang selbstständig ein Schwein von hier nach dort befördern, zerlegen und verkaufen darf. Selbst Banker müssen sich erst einmal ausbilden lassen, bevor sie loslegen dürfen – auch wenn deren Lehrzeit nach allen Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit möglicherweise etwas knapp bemessen sein könnte.
Essen aber darf ohne irgendeine Zulassungsbeschränkung jeder, was er will, und niemand wird von einem richtig Dicken oder einem Twiggy-Klon verlangen, vor dem nächsten Supermarkt- oder Restaurantbesuch einen Ernährungswissenstest abzulegen. Wahrscheinlich wären auch unsere Straßen sicherer, wenn jeder Führerscheinbesitzer jedes Jahr aufs Neue seine Fahrtauglichkeit durch ein erfolgreich bestandenes Fahrsicherheitstraining nachweisen müsste. Abenteuerliche Gedanken, zweifellos, die aber wohl noch von der Idee übertroffen werden, nur Menschen für den Umgang mit Geld zuzulassen, die nachgewiesen haben, dass sie dazu auch in der Lage sind. Wenn dem so wäre, dann gäbe es wohl weniger Probleme mit dem schnöden Mammon, weniger Essgestörte und weniger Unfälle. Dann befänden wir uns allerdings auch in einer sehr weit in die Freiheit des Einzelnen eingreifenden Diktatur und das kann nicht ernsthaft das Ziel sein. Um mich auf das hier Relevante zu beschränken: Solange jemand Geld hat, kann er damit im rechtsstaatlichen Rahmen tun und lassen, was er will. Das ist gut so – aber gleichzeitig ist genau das auch das Problem.
Wer jemals im deutschen Privatfernsehen Peter Zwegats Doku-Dramen gesehen hat, der wird wohl gern zustimmen. Wer das Leben so mancher Prominenter verfolgt hat, auch. Da gibt es Schauspieler, Fußballtrainer und – spieler, die ihr bestimmt nicht kleines Vermögen mit Wetten, Börsengeschäften, Bauherrenmodellen, Discos, (Ehe-)Frauen und in besonders denkwürdigen Fällen mit Pferden durchgebracht haben. Über die wird nur selten gesprochen. Aber da gibt es auch die ewigen Schönschwätzer und Dampfplauderer, die angeblich immer alles richtig machen und deshalb immer eine ganz nette Zuhörerschaft und Öffentlichkeit auf ihrer Seite wissen. Bislang konnte oder wollte jedoch kaum einer von denen wirklich zeigen, dass es ihm erstens finanziell wirklich gut geht und, wenn dem so war, dass er sich zweitens durch die Umsetzung seiner eigenen Ratschläge und nicht etwa durch deren publikumswirksamen Verkauf in diesen Zustand versetzt hat.
Eine ziemlich bemerkenswerte Zahl ist auch die folgende: Im Großen und Ganzen sind 3 von 5 Profis der NBA, der National Basketball League der USA, 5 Jahre nach ihrem Karriereende pleite.1› Hinweis Bei einem Durchschnittsverdienst der Spieler von knapp 5 Millionen Dollar jährlich ist das eine Leistung, die man gar nicht genug würdigen kann oder die, ich will auch das lieber vorsichtig ausdrücken, für die eine oder andere Problemzone zwischen dem linken und rechten Ohr spricht.
Da gibt es aber auch die Geschichte einer damals 73-jährigen Frau, die erleben musste, wie sich dank der Beratungsleistung zweier hierzulande hoch eingeschätzter Privatbanken ihr im Laufe eines Lebens durch eine genügsame Lebensweise zusammengespartes, nicht besonders üppiges Vermögen binnen 5 Jahren sage und schreibe gedrittelt hat.
Man mag es beklagen oder begrüßen: Geld ist wahrscheinlich der Stoff, der unsere Welt wohl mehr und mehr im Innersten zusammenhält – und dennoch kann das Wissen über den richtigen Umgang mit Geld nicht besonders weit verbreitet sein. Anders lässt sich das, was wahrscheinlich auch Sie in Ihrem Umfeld in Geldangelegenheiten oft genug erleben und erfahren, wohl kaum erklären.
Es ist erschreckend, welch gigantischen Stellenwert für die meisten von uns Geld frei- oder unfreiwillig einnimmt und wie wenig wir uns darum wirklich fundiert kümmern. Zu keiner Zeit hatten Menschen mehr Optionen, sich zum Beispiel im Internet schneller und bequemer über die ziemlich transparent gewordene Welt der Finanzen und ihre entscheidenden Parameter zu informieren, und dennoch scheinen das immer weniger wirklich zu tun. Beim lieben Geld erleiden so viele Menschen heute auch und gerade deshalb Schiffbruch, weil sie nicht in der Lage, nicht willens oder einfach nur zu feige sind, Erkenntnisse, die ihnen präsentiert und von ihnen als richtig erkannt wurden, im Zweifel stoisch, diszipliniert und leidenschaftslos in die Tat umzusetzen. Nicht, weil sie das toll finden. Sondern, weil es schlicht eine Notwendigkeit, ein Gebot der Vernunft ist.
»Making money« hat keinen missionarischen und auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber dieses Buch will unbedingt die wirklich wichtigen Irrtümer aufzeigen, die die meisten unter uns wenigstens anfänglich nur gar zu gerne begehen. Ich würde mich dabei ganz sicher für die nachfolgenden rund 200 Seiten schämen, wenn auch nur einmal oberlehrerhaft der Zeigefinger gehoben werden würde. Dafür habe auch ich im Laufe meines Lebens schon viel zu viele Fehler gemacht. Selbst mein(e) Beruf(ung) als Chef eines kleinen Dienstleistungsunternehmens im Investmentbanking2› Hinweis hat mich davor nicht bewahren können. Aber ich war immer bereit, aus meinen Fehlern zu lernen, gerade und vor allem dann, wenn es wirklich schmerzhaft war. Die allermeisten passieren mir heute garantiert nicht mehr. Für mich ist das die entscheidende Legitimation, dieses Buch zu schreiben. Und sollte ich mich doch einmal wider den hier vorgeschlagenen Regeln und Grundsätzen verhalten, dann möchte ich die Worte des – beinahe vergessenen – deutschen Philosophen Max Scheler für mich in Anspruch nehmen. Angesprochen auf seinen von großer Lust und Leidenschaft geprägten Lebenswandel und seine dazu schon ein wenig in Widerspruch stehende Ethik, seine Ideen von einem richtigen Leben, soll er einst geantwortet haben: »Haben Sie schon einmal einen Wegweiser gesehen, der in die Richtung geht, in die er zeigt?«
In diesem Buch geht es also ums Geld verdienen, Geld anlegen, Geld sparen und selbstverständlich auch darum, wie man Geld ausgibt. Wer Geld anlegen will, muss es zuvor verdient haben und nur sparen allein wird auch auf keinen allzu grünen Zweig führen, wenn man nicht weiß, warum und wofür man das tut.
Die 51 (Geld-)Irrtümer, die Sie vermeiden sollten, haben den Anspruch, sich einer ganzheitlichen und nicht nur einer eindimensionalen Schmalspurbetrachtung zu widmen. Mein Ziel ist es, in diesem Buch in alltagstauglicher, verständlicher Sprache Stolpersteine und Fallstricke in Geld- und Finanzfragen aufzuzeigen. Nicht mehr, aber eben auch ganz gewiss nicht weniger. Und weil der richtige Umgang mit Geld, wie die Suche nach dem richtigen Partner, eine alles andere als leichte und nahezu ausschließlich eigenverantwortliche Mission ist, kann sie nicht von heute auf morgen gelernt werden. Meister fallen auch in allen Geldangelegenheiten nicht vom Himmel. Jede Mission muss – meistens – mit Ausdauer, Nachhaltigkeit, großer Leidenschaft und hoher Frusttoleranz verfolgt werden. Sonst wird das nichts werden – können.
Einige Hinweise
Der Buchtitel: Was genau meint »Making money«?
Zugegebenermaßen hört sich der Buchtitel wohl ein wenig nach dem an, was in den Augen vieler so mancher Investmentbanker tut: ziemlich viel Geld auf ziemlich wilden und nicht immer lauteren Wegen verdienen, wenn’s schiefgeht, die Verantwortung delegieren, die Verluste sozialisieren und anschließend den Bonus – rechtens, aber in meinen Augen nicht richtig – auf dem Rechtsweg organisieren. Genau das aber soll der Buchtitel nicht assoziieren. Für mich geht es vielmehr darum, sich durch »Making money« auf ehrliche und anständige Weise so viele finanzielle Freiräume zu schaffen, dass man seinem Chef jederzeit die Meinung geigen, unvermittelt kündigen und dank der Reserven dennoch wenigstens weitere 1 bis 2 Jahre ohne Einschränkungen leben kann. Ein wenig, oder am besten ein wenig mehr Geld auf der richtigen Seite wird immer einhergehen mit zunehmender Freiheit und Unabhängigkeit. Darum geht es. Nicht mehr – aber nicht weniger.
Wer will, der kann die in diesem Buch aufgelisteten 51 Irrtümer zwei Gruppen zuordnen: den »Handlungsirrtümern« und den »Denkirrtümern« – auch wenn es akademisch sein mag, zwischen falschem Handeln und falschem Denken zu unterscheiden. Letztlich geht es immer darum, was ein Irrtum und was deshalb wahrscheinlich richtig ist. Auch da gilt: Nicht mehr – aber auch nicht weniger.
»Das ist richtig wichtig«
Sie finden diese Überschrift am Ende vieler Kapitel und darunter genau das kurz zusammengefasst, was auf den vorangegangenen Seiten wirklich wichtig war. Es soll auch die Möglichkeit bieten, das eine oder andere gerafft nachzuschlagen.
»Das kann richtig teuer werden«
Nicht immer wird es gelingen, das Richtige zu tun. Ganz im Gegenteil. Immer das Richtige zu tun, ist so gut wie unmöglich. Dafür sind unsere persönlichen Finanzen oftmals einfach zu komplex, die Zahl der Entscheidungsparameter nicht selten viel zu groß und die Zukunft, um die es nicht selten geht, viel zu unsicher. Da unterscheiden sich all die Dinge, die unsere Finanzen betreffen, nur wenig oder gar nicht vom ganz normalen, vom »richtigen« Leben. Aber das braucht es auch nicht. Wenigstens die halbe Miete holt man oft genug schon mit der Vermeidung des jeweils größten Fehlers ein. Genau den finden Sie unter der oben stehenden Überschrift.
Vielleicht ist das der beste Grund überhaupt, dieses Buch zu lesen: die dicksten Fallstricke zu umgehen, die schlimmsten Klippen zu umschiffen und die größten Irrtümer nach Kräften zu meiden. Wenn nur das halbwegs klappt, dann amortisiert sich der Kaufpreis für dieses Buch locker in wenigen Tagen und/oder mit nur einer einzigen richtig getroffenen Entscheidung.
Alltagstauglichkeit und Verständlichkeit
Alles in diesem Buch, jede kleine Geschichte, jeder Tipp, jeder Hinweis und Ratschlag hat den Anspruch, für absolut jedermann verständlich und lesbar zu sein. Sollte die eine oder andere Zeile den Eindruck vermitteln, dass sie nicht ganz bierernst gemeint ist, dann ist das gewollt. Der Tribut, der diesem Vorgehen zu zollen war, besteht darin, dass das eine oder andere in diesem Buch nicht immer voll und ganz dem Anspruch gerecht wird, der an ein akademisches Lehrbuch gestellt werden würde. Manchmal fehlen Hinweise auf die eine oder andere Ausnahme, manchmal die letzte Begründung und manchmal auch Statistiken und Formeln. Aber eines ist sicher: Das, was da steht, das stimmt und/oder ist meine wohlbegründete Meinung.
Steuern, Inflation & Co.
Fast alle Betrachtungen in diesem Buch klammern die Themen »Inflation« und »Steuern« aus. Jede Form von Preissteigerung trifft im Großen und Ganzen alle in genau demselben Maße.3› Hinweis Das Thema kann also »herausgekürzt« werden. Die Steuern wiederum treffen jeden in höchst unterschiedlichem Maße. Deshalb würde es weit über die Möglichkeiten dieses Buches hinausgehen, alle entsprechenden Überlegungen mit einzubeziehen. Das mag ein gewisses Manko sein, aber beispielsweise hat die Einführung der Abgeltungssteuer von pauschal 25 Prozent im Wertpapierbereich alle vor dem Finanzamt wieder gleichgestellt.4› Hinweis
Anmerkungen
Die Anmerkungsnoten verleihen dem Buch beim ersten Durchblättern vielleicht einen akademischen, schwer verdaulichen Anstrich. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Anmerkungen sind, seit ich sie damals in meiner ersten Seminararbeit kennen- und schätzen lernte, eine Marotte von mir und immer so etwas wie ein kurzer zusätzlicher Kommentar, ein launiger Nebensatz, eine kleine Ergänzung oder hin und wieder auch eine Quellenangabe.
Was eigentlich ist Geld?
Vertrauenssache
Ein Buch, bei dem es ausschließlich ums liebe Geld bzw. den schnöden Mammon geht, wird wohl gut daran tun, ganz am Anfang erst einmal Überlegungen darüber anzustellen, was Geld wirklich ist. Denn das fördert vielleicht schon die eine oder andere Überraschung zutage. Fragt man Passanten auf der Straße: »Was ist Geld?«, dann wird man nicht selten Antworten wie die folgenden bekommen: »Das, was ich in meinem Geldbeutel habe!«, »Das, was auf meinem Konto ist!«, »Das, womit ich bezahle!«, »Das, was ich nicht habe!« oder auch nur »Das!«, und dabei wird ein Geldschein oder eine Münze gezeigt.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die meisten wirklich wissen, was Geld wirklich ist. Eine erstaunliche Feststellung, denn fast alles in unserem Leben dreht sich doch ums liebe Geld. Seine Verfügbarkeit bestimmt nahezu unser ganzes Leben: wo und wie wir essen, schlafen, wohnen, lieben, Urlaub machen, arbeiten, wo unsere Kinder zur Schule gehen, welche Ausbildung sie erhalten, wie gesund und wie lange wir leben und wie uns geholfen wird, wenn wir ernsthaft erkrankt sind. Wer ein geringes Einkommen hat und auch sonst nur über bescheidende Mittel verfügt, der wohnt in Frankfurt an der Eschersheimer Landstraße und es ist keine Frage, wie gut man schläft, wenn man vor der Haustür eine vierspurige, hochfrequentierte Straße samt Straßenbahn hat. Wer über viel Geld verfügt, der wohnt in Hamburg-Blankenese – und lässt sich morgens vom Vogelgezwitscher wecken. Es ist reine Illusion zu glauben, dass Geld unser Leben von der Wiege bis zur Bahre nicht entscheidend beeinflusst. Dennoch fällt die Antwort schwer.
Was würden Sie sagen, wenn Ihnen die Frage »Was ist Geld« gestellt werden würde? Meine Erfahrung ist wirklich, dass die allermeisten Menschen, so sie nicht gerade Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre studiert und deshalb eine akademisch korrekte Definition zur Hand haben, sich mit einer Antwort auf diese Frage sehr schwertun. Eine etwas akademische, auf jeden Fall aber korrekte, in meinen Augen aber auch ein wenig oberflächliche Antwort: Geld ist erstens ein Zahlungs- und zweitens ein Wertaufbewahrungsmittel. Beides ist klar.
Mit Geld kann man in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen als Geldschein, Münze, Kredit- oder EC-Karte, als »Geld auf dem Konto«, als Scheck oder Wechsel aller Arten den Kauf von Was-auch-immer bezahlen.
Im Geld steckt also ein Wert drin. Statt zum Beispiel eine Tonne Kupfer im Garten zu lagern, kann man sich auch dessen Gegenwert von zurzeit in etwa 5000 Euro unters Kopfkissen legen, im Portemonnaie aufbewahren oder auf einem Konto vorhalten. Gold zum Beispiel ist ein weiteres der klassischen Wertaufbewahrungsmittel. Es ist offensichtlich: Geld und Gold lassen sich deutlich flexibler einsetzen als etwa eine Tonne Kupfer.
Das Entscheidende beim Geld aber ist, dass wir alle ihm die Funktion als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel zuschreiben. Praktisch alle Menschen auf der Welt glauben daran, dass Geld an sich einen Wert hat. Wer arbeitet und als Lohn für seine Arbeit einmal im Monat Geld auf sein Konto überwiesen bekommt, der vertraut darauf, dass er mit »seinem« Geld zum Bäcker gehen und die Sonntagsbrötchen kaufen kann, und der Bäcker vertraut darauf, dass er damit auch am nächsten Tag noch zum Metzger gehen und 250 Gramm Salami erstehen kann. Wir alle bauen darauf, dass wir, wenn wir Geld zur Bank bringen und dort sammeln, damit auch noch in einer weit entfernten Zukunft beispielsweise etwas Großes, ein Auto oder ein Haus, kaufen können. Wir vertrauen darauf, dass dem Geld in der Zwischenzeit nichts »passiert« und dass es wenigstens im Grundsatz seinen Wert behält.5› Hinweis
Ganz am Anfang ist Geld also vor allem eines: Vertrauen! Vertrauen darin, dass Geld einen Wert an sich hat, dass es seinen Wert behält und dass genau dieser Wert auch von allen und vor allem immer (!) akzeptiert wird. Seit Münzen nur noch in Ausnahmefällen aus beispielsweise Gold und Silber bestehen, ihr Materialwert also im Regelfall weit unter ihrem Nominalwert notiert, und erst recht seit es Papiergeld gibt, hat Geld nur deshalb einen Wert, weil wir alle daran glauben und wenig bewusst, aber de facto unser ganzes Vertrauen darin setzen, dass sich daran auch so schnell nichts Grundsätzliches ändern wird. Ist das nicht eine wilde Welt?
Stellen wir uns doch nur mal für einen Moment vor, was geschehen würde, wenn irgendwo auf dieser Welt plötzlich Zweifel daran aufkämen, dass Geld wirklich einen Wert hat, und der eine oder andere es nicht mehr als Gegenleistung für eine Warenlieferung akzeptieren würde. An dem Tag, an dem das passiert und sich diese Vorstellung zu einem Flächenbrand ausbreitet, an dem Tag bricht die uns bekannte Weltordnung zusammen und die, die dann Einzug halten würde, wäre für jeden von uns eine Katastrophe: Wer nur Geld zum Tausch gegen ein Brötchen anbieten kann, Geld aber vom Bäcker nicht mehr akzeptiert wird, weil der nicht sicher sein kann, ob er dafür am Abend vom Metzger auch nur eine Scheibe Lyoner bekommt, der wird entweder hoffentlich im eigenen Garten ein paar Reserven haben oder aber hungern müssen. Und wenn es den meisten so geht, dann war das, was im Herbst 2008 auf dem bisherigen Höhepunkt der Finanzkrise so alles gedacht und gesagt wurde, bestenfalls ein laues Lüftchen, eine kleine Vorahnung im Vergleich zu dem dann aufziehenden Sturm.
Gerade vor diesem Hintergrund ist es spannend, einen kurzen Blick zurück in die jüngere Geschichte des Geldes werfen: Im Juli 1944 trafen sich im US-Bundesstaat New Hampshire die Finanzminister und die Chefs der jeweiligen nationalen Zentralbanken, die sogenannten »Notenbankchefs«6› Hinweis der späteren Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Sie verabschiedeten am 22. Juli den Vertrag von Bretton Woods, in dem feste Wechselkurse und der sogenannte Goldstandard festgelegt wurden. Die amerikanische Notenbank, die FED7› Hinweis, verpflichtete sich darin, zu einem fest vorgegebenen Wechselkurs allen Mitgliedsländern US-Dollars abzukaufen oder anzubieten. Dabei galt, dass 35 Dollar immer eine Unze, also 31,1 Gramm Gold wert sein würden – und umgekehrt. Die Idee herrschte vor, dass jeder Dollar zu jeder Zeit von der entsprechenden Menge Gold gedeckt sein müsse.8› Hinweis Ein wenig überspitzt formuliert hätte jeder, der dem Wert seiner Dollars und mittelbar über das System fester Wechselkurse auch seiner eigenen Währung nicht mehr vertraute, nach Fort Knox pilgern und sich dort sein Geld in Gold umtauschen können. Diese Aussicht ließ den einen oder anderen ein wenig schneller ein- und besser durchschlafen und das war ja auch ein Sinn des Ganzen. Allerdings – und ohne ausführlicher darauf eingehen zu wollen, nähere Erläuterungen dazu stehen unter »Bretton Woods« überall im Netz und in aller volkswirtschaftlichen Literatur – hatte dieser Goldstandard mit seinem System fester Wechselkurse in einer schon damals mehr und mehr zusammenrückenden Welt auch nach heutiger Interpretation mehr Nach-9› Hinweis als Vorteile und deshalb wurde »Bretton Woods« Anfang der 1970er-Jahre aufgegeben. Zwar verfügt auch die Deutsche Bundesbank heute noch über erhebliche Goldreserven, die sinnigerweise teilweise in den USA lagern, Mitte 2010 waren es rund 3400 Tonnen – nur die Vereinigten Staaten hatten damals mit rund 8100 Tonnen mehr – aber das reicht nicht annähernd für eine komplette Deckung der »deutschen« Euro aus.10› Hinweis
Geld ist seit dem Ende von »Bretton Woods« mehr denn je reine Vertrauenssache. Sonst nichts. Ohne Vertrauen ist Geld die größte Luftnummer, die jemals auf diesem Planeten flächendeckend Platz ergriffen hat. Wer will: Das gemeinsame Vertrauen nahezu aller Konfessionen, Regionen, Staatssysteme in Geld, das eint die Völker der Welt. Geld ist Völkerverständigung vom Allerfeinsten. Da, wo sich Muslime, Juden, Christen, Hindus, Menschen aller Hautfarben, Nationen und Herkunft bei jeder Gelegenheit die Köpfe aus den aberwitzigsten Gründen einschlagen können – da eint sie doch das gemeinsame Vertrauen in Geld, sogar in das Geld des anderen.
So gesehen kann man schnell verstehen, warum sich die Welt im Herbst und Winter 2008/2009 entgegen den sonst üblichen Gepflogenheiten sehr schnell über alle Grenzen hinweg auf Maßnahmen gegen die Finanzkrise verständigen konnte. Das, was gekommen wäre, wenn sie das nicht getan hätte, hätte das Antlitz der Welt irreversibel verändert. Diesem Sturm konnte man sich nur entgegenstellen, solange er noch nicht wirklich losgebrochen war.
Es mag eine sehr ernüchternde Feststellung sein, aber eben auch eine, die richtig Mut macht: Wenn es ums Geld geht, dann werden sich mit einiger Sicherheit auch in Zukunft alle, die Verantwortung tragen, sehr schnell einig werden. Eine erleichternde, beruhigende Erkenntnis, wie ich meine.
Das ist richtig wichtig
Auf die Gefahr hin, ausgelacht zu werden: Geld ist richtig wichtig und deshalb ist es von herausragender Bedeutung, sich sehr frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie frau/mann im Leben mit Geld umgehen und welche Ziele frau/mann erreichen will.Nur Heuchler, Eremiten, fundamentalistische Ökos, richtig Reiche und die, denen sowieso alles egal ist, werden Punkt 1 begründet widersprechen wollen und können.Geld ist reine Vertrauenssache und vieles spricht dafür, dass es genau das auch bleiben wird.Das Vertrauen in eine Währung, also in das Geld eines Wirtschaftsraumes wie der Europäischen Währungsunion oder einer Nation wie der Schweiz ist c. p.11› Hinweis umso größer, je geringer zum Beispiel der von diesem Land für seine Anleihen gezahlte Zins ist.Das Vertrauen in eine Währung ist auch umso größer, je stärker diese Währung im Vergleich zu anderen Währungen ist. Anders herum: Je billiger ein USA-Urlaub für uns ist, desto größer ist das Vertrauen in unseren Euro.(K)eine Welt für sich
Spätestens als wir uns mit unserer selbst für die damalige Zeit erbärmlichen Ausrüstung bei sengender Hitze schwitzend und keuchend erst das Kühtai und dann das Timmelsjoch hochquälten, wurde uns beiden endgültig klar, worauf wir uns da wirklich eingelassen hatten: Eine Fahrradtour von unseren oberfränkischen Studiengefilden nach Athen ist selbst dann nicht wirklich von Pappe, wenn man wie wir den Weg durch Italien wählt und deshalb zumindest einen größeren Teil der Strecke auf einer Fähre zubringen darf. Was einst in Partystimmung mit einer Wette und stichelnden Äußerungen wie »Das schafft ihr nie im Leben!« begonnen hatte, endete damals irgendwo an der Waldgrenze zwischen Sölden und Obergurgel beinahe in einem Kreislaufkollaps und später oben auf der Passhöhe um ein Haar im totalen Desaster.
Wir schrieben das Jahr 1987. In Deutschland wurde noch mit D-Mark, in Österreich mit Schilling und in Italien mit Lire bezahlt. Plastikgeld aller Art wurde noch nicht flächendeckend zum Zahlungsverkehr angenommen. Wer etwas anderes als Bargeld mitnehmen wollte, der tat das in Form von Reiseschecks. Ihr Vorteil lag darin, dass der Betrag, auf den sie lauteten, versichert war. Ein Verlust also leichter zu verschmerzen war als der Verlust von Bargeld. Ihr Nachteil war, dass sie bei Weitem nicht allerorts eingelöst wurden. Auf jeden Fall nicht auf dem Timmelsjoch. Als wir in den späteren Nachmittagsstunden endlich oben ankamen, waren wir komplett dehydriert und so leer und schwach wie wohl niemals mehr zuvor oder danach. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir mehr durch die Gegend stolperten als gingen und uns selbst das Sitzen schwerfiel. Wir sprachen etwa 20 Minuten nicht ein Wort und unser Erschöpfungszustand muss wohl die eine oder andere Nachfrage ausgelöst haben, die wir aber nicht beantworten konnten. Wir brauchten dringend etwas Ordentliches zu essen und zu trinken.
Als wir nach etwa einer halben Stunde in der Hütte wieder in der Lage waren, klare Gedanken zu fassen, und mit einem Kassensturz begannen, stellte sich ein weiteres Mal heraus, dass wir uns einfach kläglich vorbereitet hatten. Wir überquerten nicht nur die Alpen mit Caravan-Karten des ADAC, wir besaßen dort oben gerade eben noch etwa 15 D-Mark und auch die standen uns nicht als homogene Einheit, sondern in Form von Lire, Schillingen und D-Mark zur Verfügung. Damit war klar, dass wir erstens nur Wasser vom Waschbecken in der Toilette trinken und zweitens nicht unbedingt schlemmen würden. Mit den angegebenen Umtauschkursen für die drei Währungen und der Speisekarte begannen wir nun damit, Kalorien zu optimieren. Vermutlich zum letzten Mal in meinem Leben lautete die Frage, was wir gemeinsam bestellen müssten, um möglichst viele Kalorien auf den Tisch zu bekommen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir von dem, was da in der Hütte um uns herum geschah, nicht allzu viel mitbekommen. Das uns gegenübersitzende Ehepaar bemerkten wir erst, als sie zahlten, aufstanden und uns mit wenigen Worten 10 000 Lire auf den Tisch legten. Wir wussten nicht, wie uns geschah, und vermutlich bestand unsere Reaktion nur in gestammelten Halbsätzen. Woran ich mich aber heute noch ganz sicher erinnern kann, sind diese Worte: »Bitte nehmen Sie das Geld und kaufen Sie sich damit etwas zu essen. Wir wären sehr froh, wenn unsere Söhne einmal eine Radtour wie Sie machen würden, und wir wären sehr dankbar, wenn dann auch ihnen geholfen werden würde!« Dabei strahlten sie und ihre Augen funkelten vor Stolz und Freude. Stolz darüber, dass sie uns hatten helfen können, und Freude über unsere leuchtenden Augen. Diese 10 000 Lire waren so viel mehr wert als 20 D-Mark oder zwei Kaiserschmarrn. Sie waren das Leuchten in 4 Augenpaaren. Sie machten 4 Menschen überglücklich. Nur Geld konnte das in diesen Augenblicken leisten. In diesen Momenten war Geld eine Welt für sich.
Meistens ist es das nicht, sondern ein integraler Bestandteil unserer Welt. Wer auch nur versucht, Geld aus unserem Alltag wegzudenken, der kann auch gleich damit anfangen, sich wieder in Wälder und Höhlen zurückzuziehen. Ohne Geld beginnt sofort die Steinzeit. Das mag für den einen oder anderen und für ein paar 100 000 bis ein paar Millionen Menschen auf dem gesamten Planeten eine vergleichsweise kuschelige und vielleicht irgendwie doch noch erstrebenswerte Angelegenheit sein. Für eine Welt mit bald 7 Milliarden Menschen wäre es das Ende.
In den wenigen Wochen im Herbst 2008, als die Finanzkrise die Welt aus den Angeln zu heben drohte, geisterte durch viele Diskussions- und Stammtischrunden die Vorstellung, dass man die Realwirtschaft völlig von den Geldkreisläufen lösen könne. Als Begründung wurde oft genannt, dass das eine mit dem anderen ohnehin schon lange nichts mehr tun hätte und dieser Schritt der Lossagung von der Welt des Geldes nur noch der letzte formale Schritt wäre. Erstaunlicherweise schlossen sich nicht selten auch gut ausgebildete und reichlich konservative Zeitgenossen dem Gedanken an, die ganze Geldwirtschaft am besten einfach komplett abzuschaffen und die ohnehin nur im virtuellen Raum auf irgendwelchen Festplatten und RAM-Speichern existierenden Nullen dieser Welt einfach zu streichen, um unbehelligt von Investmentbankern und ihren Missetaten einfach und vor allem besser weiterzumachen.
Zweifellos war das zumindest damals ein verführerischer, ja ein verlockender Gedanke. Allerdings sind solche Vorstellungen so weit entfernt von jeder denkbaren Realität wie der Mars von unserem Mond. Jede noch so virtuelle »1« oder »0« repräsentiert, an welcher Stelle sie auch immer auftaucht, das Eigentum, das Vermögen, das Geld, wie auch immer wir das nennen wollen, eines Menschen oder einer juristischen Person wie dem Rentner um die Ecke, der Krankenpflegerin im ambulanten Dienst, einer Stadt oder eines Unternehmens. Die Nullen zu streichen, hieße, die Betroffen zu enteignen, ihnen Geld wegzunehmen, das sie wie auch immer verdient, zurückgelegt und gespart haben. Die wichtigste Erkenntnis ist deshalb, dass diese Virtualität keine Virtualität ist. Sie ist unser aller individuelle Realität. Auch wenn Geld manchmal in atemberaubendem Tempo und in unglaublichen Summen von einem elektronischen Speichermedium zu einem anderen geschoben wird, so ist es dennoch Realität: für die Menschen, die das in der Hoffnung tun, sich dadurch einen Vorteil zu erwirtschaften. Oder für die, die damit »nur« wirtschaftlichen Notwendigkeiten wie dem Bezahlen einer Rechnung oder der Absicherung eines Exportgeschäfts gegen Währungsschwankungen nachkommen. Für Kreditnehmer und Kreditgeber. Für Spekulanten12› Hinweis, Sparer und Anleger. Für uns alle. Ob man das gut oder schlecht findet, ist irrelevant – es ist so!
Übrigens: Es gibt dann doch noch eine Situation, in der Geld eine Welt für sich ist. Nämlich genau dann, wenn mit Geld unmittelbar mehr Geld verdient werden soll. Also dann, wenn Geld an den Finanzmärkten dieser Welt angelegt wird. Dann gelten zwar noch immer viele Alltagsregeln. Aber einen gewaltigen Unterschied gibt es auf jeden Fall garantiert immer. Das ist der Skaleneffekt. Wer auch immer 100, 10 000 oder gar 1 000 000 Euro anlegt: Die Arbeit, die für eine gute Anlageentscheidung geleistet werden muss, die bleibt in jedem Fall nahezu die gleiche. Die absolute Rendite dagegen ist jeweils eine völlig andere. 10 Prozent von 10 000 sind 1000 Euro. 10 Prozent von einer Million sind 100 000 Euro. Das 100-fache Ergebnis bei gleicher Arbeit! Das gibt es zumindest dort, wo Geld redlich, ehrlich und konform mit unseren Gesetzen13› Hinweis