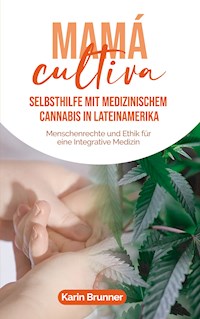
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die lateinamerikanische Mamá Cultiva Bewegung setzt sich für den Selbstanbau von medizinischem Cannabis ein. Die Geschichte der seit tausenden Jahren dienenden Kulturpflanze Cannabis liefert ein Beispiel, wie sehr Machtstrukturen und ökonomische Interessen in den letzten Jahrhunderten die Entwicklung der Medizin und deren Forschung beeinflussten und dabei abweichendes Wissen um Gesundheit, Heilung und das Sterben unterdrückten. Menschenrechtliche und ethische Normen weisen in diesem Buch den Weg zu einer Integrativen Medizin und Forschung, in der die Fülle der medizinischen Disziplinen zum Wohle der Menschen zusammenarbeiten. Ein wissenschaftlich fundiertes, holistisches Menschenbild liefert die Grundlage für eine Neuorientierung, wenn nicht weiterhin Gewaltstrukturen im Gesundheitswesen genährt werden sollen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kraft des Herzensweges ist das Elixier für dein Wirken.
Die Autorin arbeitete viele Jahre als Juristin in einem Gewaltschutzzentrum und in Anwaltskanzleien in Österreich, bevor sie im Jahr 2007 ihrem Herzenswunsch nach Südamerika folgte, wo sie verschiedene Länder bereiste, dort Projekte umsetzte und lebte. Mehrere Jahre verbrachte sie in Uruguay mit der Leitung eines ganzheitlich orientierten Gästehauses. Seit 2021 lebt sie mit ihrer Tochter Diana in Ecuador, wo sie als Ganzheitstherapeutin und Beraterin nachhaltiger Entwicklungsprojekte tätig ist. Diese Erfahrungen fließen in die Forschungsarbeit an der Uni Graz ein, in denen sie sich unter anderem care-ethischen und organisatorischen Herausforderungen in der Entwicklung integrativmedizinischer Projekte widmet.
INHALTSVERZEICHNIS
1 Im Labyrinth der Interessensgegensätze
1.1 Wendepunkte im Leben: Medizinisches Cannabis verbindet die Akteurinnen.
1.1.1 Chile: Aus einem zu Ende gedachten Leben erwächst eine neue Lebensqualität und eine soziale Bewegung: Mamá Cultiva wird geboren.
1.1.2 „Fundación Daya”: Mitfühlende Liebe als Motiv für eine Neuorientierung im Leben einer chilenischen Schauspielerin
1.1.3 Ecuador - König David: Der Kampf des David gegen einen seltenen Goliath
1.2 Akute Konfliktzonen in der Medizin
1.3 Anschlussbedarf in der Medizinethik
1.4 Cannabis: eine Kulturpflanze der Menschheit im Spannungsfeld von Gesundheitssorge und Machtinteressen
1.5 Die Fundación Daya ermächtigt PatientInnen
1.6 Eine Odysee zur Überwindung des täglichen Leidensweges hin zu neuer Lebensqualität
1.7 „Die Ärzte nehmen keinen Anteil am Schmerz. Die Mehrheit will klinische Studien.“
1.8 „Wir brauchen eine humanisierte Medizin!“
1.9 ¡Somos mujeres empoderadas! - Wir sind ermächtigte Frauen!
1.9.1 Die Ermächtigungs-Strategien der Organisation Mamá Cultiva und der Fundación Daya
1.9.2 Ermächtigung durch Bildung und Information
1.9.3 Ermächtigung durch Beziehungsstärkung
1.9.4 Ermächtigung durch Gemeinschaft
1.9.5 Ermächtigung durch den Selbstanabau von Cannabis
1.9.6 Ermächtigung durch politische Beteiligung und Systemkritik
1.9.7 Ermächtigung / Empowerment in der Theorie
1.9.8 Empowerment und Gesundheit: Internationale Perspektiven, Alma Ata und Ottawa Charta der WHO
1.10 Mamá Cultiva als kritische Empowerment-Bewegung im Machtgefüge des herrschenden Gesundheitssystems
1.11 Stigmatisierung, Kriminalisierung und der Kampf gegen Riesen
1.12 Gewaltstrukturen und -erfahrungen
1.13 Menschenrechte und eine holistische Definition von Gesundheit, Krankheit und Medizin
1.13.1 Das Menschenrecht auf Gesundheit
1.13.2 Kritik und Gefahren eines Missbrauches des Menschenrechtes auf Gesundheit
1.13.3 Weitere gefährdete Menschenrechte der Mamá Cultiva und Fundación Daya PatientInnen sowie der VerwenderInnen von medizinischem Cannabis
1.14 Ergänzende internationale Dokumente für eine ganzheitlich orientierte Medizin und die Miteinbeziehung komplementärer und traditioneller Wissensformen
1.15 Verletzung von Menschenrechten durch Machtstrukturen im Gesundheitswesen
1.16 Wissenschaftlichkeit in der Medizin und epistemische Gewalt
1.16.1 Das Gewaltpotenzial des biomedizinischen Paradigmas der Trennung von Körper, Geist und Seele und der monokulturellen Medizin
1.16.2 Epistemische Gewalt in der Medizin und Epistemizide
2 AUSWEGE UND NEUE PERSPEKTIVEN
2.1 Care Revolution als Transformationsstrategie im Medizinsystem
2.1.1 Care Ethik, Sorgebeziehungen und Politik
2.1.2 Mamá Cultiva Care Revolution
2.1.3 Care Revolution und die Beziehung zur Cannabispflanze als Teil der Heilung
2.2 Ärztlicher Humanismus
2.3 Erfordernis einer Integrativen Medizin
3 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Vorwort
Cannabispflanzen im Garten, auf dem Balkon und im Wohnzimmer, weil ich daraus die Medizin für mein Kind herstelle. Wie bitte?
Richtig verstanden. Genau das machen – wohl nicht nur am lateinamerikanischen Kontinent – zigtausende Menschen, um ihre Lebensqualität oder die eines kranken Familienangehörigen zu verbessern. Die Probleme, Zweifel und Ängste sind oft riesengroß ob vieler Unsicherheiten und gesetzlicher Verbote. Trotzdem schwören diese Menschen darauf, weil sie dadurch ihren Gesundheitszustand verbessern können.
Die lateinamerikanische Mamá Cultiva Bewegung und die Fundación Daya in Chile betreuen PatientInnen und Eltern schwer kranker Kinder, indem sie ihnen Unterstützung zur Selbstherstellung und Anwendung der Cannabismedizin bieten. In dieser Arbeit werden das Wirken und die Herausforderungen der Organisationen und der betroffenen Menschen zu menschenrechtlichen und care-ethischen Themen in Bezug gesetzt. Feldforschungen, Interviews mit Betroffenen, ÄrztInnen und TherapeutInnen sowie Literaturrecherchen in globalen Datenbanken und vor Ort in Uruguay, Chile und Ecuador bilden die Grundlage für dieses Buch.
Mit der Veröffentlichung dieses Buches blicke ich auf die Motivation für das Studium der Angewandten Ethik in Graz mit dem Schwerpunkt Medizin- und Pflegeethik zurück. Bedingt durch die eigene familiäre Situation war ich mehrere Jahre auf beiden Kontinenten von Kindern mit onkologischen Erkrankungen und deren pflegenden Angehörigen umgeben. Das miterlebte Leid hinterließ in mir Spuren, die durch mittlerweile verstummte Stimmen verstorbener Kinder nicht so einfach zu verwischen waren. Die mechanischen Behandlungsabläufe und die Verabreichung von Chemotherapien an mit einer Nummer versehene junge PatientInnen zeigten mir in kalten Krankenhausinstitutionen ein Bild, das mit den Bedürfnissen der PatientInnen nach Genesung und dem Menschsein im Allgemeinen nicht übereinstimmte. Die Organisationsstrukturen und die Rollen- und Machtverteilungen im Gesundheitswesen sind aber so gewachsen und in uns als selbstverständlich eingeprägt. Gefühle der Ohnmacht ob vieler wahrgenommener Widersprüche und Intuitionen über Fehlentwicklungen befahlen mir, mich dieser Themen auf wissenschaftlicher Ebene anzunehmen.
Als mir ein Psychologe erzählte, dass Anfang der 1970-er Jahre der US-amerikanische Präsident Richard Nixon den „Krieg gegen den Krebs“ ausgerufen hat, um die Forschung zu intensivieren, bemerkte ich, dass diese Rhetorik mit dem Erlebten wieder übereinstimmte. Denn genau von dieser Wahrnehmung waren ich und viele andere Betroffene erschüttert: Vom Moment der Diagnose an begann eine Maschinerie im Sinne einer Kriegsführung zu laufen. Doch: wie kann ein Krieg zur Heilung führen und den kranken Menschen in seiner Gesamtheit wahrnehmen oder gar die Ursachen einer Erkrankung, die sozialen, emotionalen und spirituellen Krankheitsparameter erforschen oder heilen? Wie wird eine Forschung organisiert, die zur „Kriegsführung“ eingesetzt wird? Und wie viele Todesopfer hat dieser Krieg gefordert und wieviel Leid verursacht, weil ganzheitliche Sichtweisen des Menschen von Krankheit, Heilung und dem Tod, leidmindernde Therapien und medizinisches Wissen, das nicht in diese Kriegsführungsstrategie passt, einfach ausgeblendet und ignoriert wurden?
Es ist höchst an der Zeit, dieses veraltete Bewusstsein über Bord zu werfen und sich einzugestehen, dass die Medizin neue Wege einschlagen muss, wenn sie wirklich den Menschen und nicht ökonomischen und politischen Interessen oder ihrer eigenen Eitelkeit dienen will. Zu sehr ist unsere Gesellschaft von Egoismus, Gewinnstreben und Konkurrenzdenken geprägt, was tiefe Auswirkungen auf Gesundheit, unser Zusammenleben und auch auf die Ausrichtung des Gesundheitswesens hat. Mögen mit dieser Arbeit Perspektiven in das Licht gerückt werden, die in all den Diskussionen um Professionalität und um PatientInnenwohl verloren gehen.
Gewidmet ist diese Arbeit in erster Linie meiner Tochter Diana, ohne die es mir niemals möglich gewesen wäre, derart viel über und für das Leben zu lernen. Sie hat mir immer gezeigt, wieviel Kraft in einem Menschen stecken kann. Mit ihr habe ich Tag für Tag erlebt, wie vielschichtig eine Erkrankung und ein Gesundungsprozess sind. Weiters ist die Arbeit allen Kindern mit schweren Erkrankungen gewidmet, denen es nicht möglich ist und war, ihren ganzheitlichen, individuellen Weg der Heilung zu gehen, ganz besonders aber Manuel, in dessen Augen ich blickte, als der komplementärmedizinisch begleitende Onkologe über den Abschluss der schulmedizinischen Behandlungen meinte: „Manuel, es war gar nicht so schlimm, oder?“ Die zweite Kriegserklärung - nach dem Ausbruch einer weiteren Krebsart - konnte Manuel nicht mehr annehmen.
Wolfsberg, Juli 2022
Mag.a Dr.in Karin Brunner MA
Im Labyrinth der Interessensgegensätze
1 Im Labyrinth der Interessensgegensätze
1.1 Wendepunkte im Leben: Medizinisches Cannabis verbindet die Akteurinnen.
1.1.1 Chile: Aus einem zu Ende gedachten Leben erwächst eine neue Lebensqualität und eine soziale Bewegung: Mamá Cultiva wird geboren.
„Cannabis hat uns unser Leben, das unserer Kinder und unserer Familien zurückgegeben. Das müssen wir laut in die Welt hinausrufen, es gibt eine andere Möglichkeit!“ Paulina Bobadilla befindet sich mitten im Wahlkampf um das Bürgermeisterinnenamt ihrer Gemeinde Quilicura im Mai 2021 voller Tatendrang. Sie hat meine Zoom Einladung gleich an mehrere Mütter der Mamá Cultiva Gruppe Chile weitergeleitet, was mich in ein ungeplantes Gruppeninterview wirft.
Jahre zuvor klang ihre Stimme noch gebrochener und vom Leid gezeichnet. Vielfach hatte sie das Schicksal ihrer Tochter Javiera in den Medien und auf internationalen Konferenzen schon erzählt. „Javiera hat unter anderem eine Tuberöse Sklerose, diese ist mit einer refraktären Epilepsie verbunden. Sie hat viele Tumore im Kopf1. Bei dieser Epilepsie helfen schon keine Medikamente mehr. Sie nahm Medikamente in höchster Dosis, mit schrecklichen Nebenwirkungen. Sie riss sich ihre Nägel aus, ihre blutenden Händchen spürte sie gar nicht. Jeden Tag ging es ihr schlechter, sie schlug um sich, sie schlug uns, sie schlug jeden, den sie vor sich hatte, sich selbst. Sie lebte in einer fremden Welt, vollkommen abgeschnitten. Wir lebten in einer schrecklichen Welt voller Schmerz und Verzweiflung. Meine Tochter war eine Drogenabhängige.2 Wenn du ihr ein Medikament in dieser Höchstdosis nicht gabst, wurde sie verrückt, eine Paranoia…. Sie nahm bis zu sechs verschiedene krampflösende Medikamente, die ihre epileptischen Krisen nicht verringerten. Leider war das für unsere Ärzte sehr normal, weil es Nebenwirkungen der Medikamente waren, sie gingen sehr lapidar damit um, oft war es nur ein Schulterklopfen und ein ich bedauere. Sie erhöhten und erhöhten die Dosis, sie geben dir keine Alternative, die Krisen nahmen aber nicht ab, sie verschlechterten nur unsere Lebensqualität. Hier könnte ich eine lange Liste von Ärzten aufzählen, es waren die besten Chiles.“3
Javiera wurde viermal an ihren Beinen operiert und war unzählige Male im Krankenhaus wegen ihrer epileptischen Anfälle. „Wir Eltern hatten eine scheußliche Depression, ich nahm viele Medikamente, um das alles auszuhalten. Eines Tages konnte ich nicht mehr, ich wollte nicht mehr Leben. Ich sagte, ich kann nicht mehr mit meiner Tochter und dieser Erkrankung. Ich liebe dich, aber ich mache das nicht mehr mit. Sie wollten sie am Kopf operieren, um einen Tumor herauszuholen, einen von zwanzig, wofür? Ich sagte: ich kann nicht mehr, bis hierher sind wir gelangt. Nach sehr langer Zeit war Javiera plötzlich präsent – an dem Tag wollte ich unserem Leben ein Ende bereiten. Sie sagte zu mir: Mamá. Das war es, was mir die Kraft gab, weiterzumachen, weiterzumachen, um eine Alternative zu suchen. Wir hatten schon alles versucht, was die traditionelle Medizin4 anbot. Das war unser Wendepunkt, wie wir zum Cannabis gekommen sind. Wir sahen Ana María in einer Fernsehsendung.“
1.1.2 „Fundación Daya”: Mitfühlende Liebe als Motiv für eine Neuorientierung im Leben einer chilenischen Schauspielerin
Ana María Gazmuri befand sich an einem Wendepunkt ihres Lebens, nachdem sie eine geliebte Freundin verloren hatte. Ihre Schauspielerkarriere wollte sie beenden. „Es waren sehr persönliche Momente, nachdem ich mich in einigen Disziplinen wie buddhistischer Psychologie, Meditation, Kalifornischen Blüten und anderen Themen weitergebildet hatte. Es war mir klar, dass ich den Menschen dienen wollte. Der Verlust dieser Freundin, mit der ich diesen ganzen Weg des Lernens hinter mir hatte, war ein wichtiger Wendepunkt.“ Inspiriert von Elisabeth Kübler-Ross, eine der bekanntesten Sterbeforscherinnen, und berührt von der Einsamkeit des Sterbens vieler Menschen dachte sie an eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. „Das gute Sterben begleiten, das wäre meine Rolle, dachte ich, dieser schlecht begleitete Prozess, in dem viele Menschen in Einsamkeit und Schmerz ihren physischen Körper verlassen und in die spirituelle Welt zurückkehren.“5
Mit ihrer offenen Haltung in dieser Lebensphase und ihrem unermüdlichen Forschergeist fand sie jedoch durch äußere Umstände zu einer neuen Beziehung zur Cannabispflanze, insbesondere zu deren medizinischem und therapeutischem Potenzial. Sie begegnete diesem Potenzial aus einer Perspektive der Freiheit und der kollektiven Rechte. Die Verletzungen des Gesetzes 20.000, welches die Verwendung von Cannabis für medizinische und andere private Zwecke von einer Bestrafung in Chile ausnimmt, erschienen ihr sehr drastisch.
„Eines ist, was man sich selbst vornimmt, etwas anders ist es, wohin das Leben einen trägt. Ich erfuhr von dieser ganzen Problematik des medizinischen Cannabis. Wir erfuhren vom Mädchen Charlotte Figi6 aus den Vereinigten Staaten und wir begannen hier das erste Mädchen mit Epilepsie mit Cannabis zu behandeln. Es funktionierte innerhalb einer Woche. Ich studierte und studierte und erkannte, dass wir hier ein immenses Potenzial haben.“
Ana María wollte eine Organisation für Komplementärtherapien gründen, eine Therapie davon sollte das medizinische Cannabis sein. „Dieses war aufsehenerregend und die größte Neuigkeit, es wurden immer mehr Leute, die in meinem Haus aus und ein gingen.“ So kam es zur Gründung der Fundación Daya.7
Die Organisation ist eine gemeinnützige Einrichtung zum Bekanntmachen, der Verbreitung und der Erforschung von Komplementärmedizin und natürlichen Medizinen. Ihr Ziel ist es, menschliches Leid zu verringern. „Wir träumen von einer freundlicheren, empathischeren und liebevolleren Gesellschaft, dass das Leid, das neben uns ist, uns berühren und bewegen möge. Wir träumen davon, vom Individualismus und dem Egoismus auszusteigen, den Wert des Gemeinschaftlichen und des Miteinanders über den Wettbewerb zu stellen. Daraus entstand die Fundación Daya. Daya ist ein Sanskrit Wort, welches ´mitfühlende Liebe´ bedeutet. Ein Teil unserer Mission ist auch politischer Aktionismus und Öffentlichkeitsarbeit. Wir arbeiten mit unseren Patienten in einer verzweifelten Realität, in einer Realität, in der die Patienten keine Zeit haben, in der Menschen sterben, in der Kinder mit Epilepsie keine Erleichterung mit der konventionellen Medizin für ihre Leiden erfahren. Es ist ein Gefühl der Dringlichkeit, das die Tätigkeiten der Fundacion Daya und der Organisation Mamá Cultiva, die unter dem Schutz der Fundación Daya heraus entstanden ist, antreibt. Es ist eine Aktionsplattform der organisierten Zivilgesellschaft, um reale und dringende Bedürfnisse der Bevölkerung zu stillen.“8 Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die Fundación Daya 45.500 PatientInnen betreut.
1.1.3 Ecuador - König David: Der Kampf des David gegen einen seltenen Goliath9
Alles begann mit einer Bewusstlosigkeit, als David ein Jahr und zehn Monate alt war. „Ich musste ihn Mund zu Mund beatmen“, erinnert sich Mutter Karina, die nach und nach einige Besonderheiten an ihrem Kind wahrnahm. Die Neurologen beschwichtigen jedoch immer, dass alles in Ordnung wäre. „Ich war die verrückte Mutter, die eine Krankheit in ihrem Kind suchte. Wir hatten 18 Kinderärzte, niemandem fiel auf, dass David ohne das Gaumenzäpfen zur Welt kam. Die Anfälle nahmen zu, bis man mir schließlich sagte, dass David aufgrund einer refraktären Epilepsie niemals sprechen oder gehen werde können. David war schon so medikalisiert, trotzdem hatte er ständig Krampfanfälle, Bronchospasmen, Bronchopneumonie. Ich konnte ihm nicht einmal die Medikamente geben, weil er ständig Krampfanfälle hatte. Auf der Intensivstation dauerte es einmal eine Stunde, bis sie ihn beruhigen konnten. Es war wie im Horrorfilm. Ich lebte eine Woche zu Hause, 15 Tage im Krankenhaus.“ Karina Jouve studierte und studierte, zuerst Ernährung, dann begann sie mit dem Medizinstudium. Eines Tages sagte ihr Instinkt, dass es da noch etwas gäbe. Sie forderte eine Radiografie. Dabei stellte sich heraus, dass David nur eine Niere hatte. Das war der Wendepunkt, an dem sie beschloss, nach einer natürlichen Alternative zu suchen. Sie entdeckte den Fall Charlotte Figi und freundete sich mit deren Mutter an. Sie kontaktierte Paulina Bobadilla in Chile und bat sie um Hilfe. Nach mehreren Versuchen mit Cannabis entdeckte sie die Sorte Lemon Hize, eine Sorte mit einem hohen psychoaktiven THC Gehalt. „Ich probierte sie und sie tat ihm so gut. Wie eigenartig, er begann nicht zu lachen, nicht zu weinen, die Krisen dauerten noch an, aber sie wurden weniger. Dann dachte ich mir, warum gebe ich ihm Cannabis nicht zu essen?“ Sie veranlasste eine vollkommene Ernährungsumstellung, ohne Zucker und strich viele weitere Nahrungsmittel. „Rohes Cannabis, gemischt mit Säften, Salaten, aufgeschnitten wie Petersilie. Wir essen auch die Cannabissamen. Und ich entdeckte einen Wunder-Samen, in Indien nennt man ihn den gesegneten Samen, besser bekannt als Schwarzkümmel. Es verbesserte sich komplett die Verdauung. Viele der Autoimmunerkrankungen sind durch eine Stoffwechselstörung begründet“, erklärt Karina, die mittlerweile als Ärztin viele PatientInnen betreut. Sie hält international Vorträge über das Wolf-Hirschhorn-Syndrom, welches bei ihrem Sohn nach langem Suchen in Spanien diagnostiziert wurde. Sie will die Erkrankung bekannter machen und Vorurteile abbauen. „Wir feiern bald fünf Jahre ohne epileptische Anfälle, fünf Jahre ohne Medikamente. Wir haben eine zweite Chance zu leben bekommen“. David genießt seine große Leidenschaft - das Reiten - ohne Angst vor einem Krampfanfall. „Die Gesetzeslage in Ecuador ist unsicher, es ist nur CBD erlaubt“, führt Karina weiter aus. Trotzdem hatte sie persönlich nie Probleme mit der Polizei, auch nicht mit Stigmatisierung wegen der Verwendung. Der Selbstanbau für David war politisch autorisiert10. „Es ist nicht wie in Argentinien und in Chile. Es ist doch eine Medizin, eine Pflanze. Cannabis ist aber nach wie vor“ – sie sucht lange nach dem passenden Wort – „satanisiert“.
1.2 Akute Konfliktzonen in der Medizin
Nach jahrelangem Lernen über komplementäre und alternative Heilmethoden, Kennenlernen verschiedenster kultureller Perspektiven von Gesundheit, Krankheit, Heilung und dem Tod stieß ich auf die lateinamerikanische Mamá Cultiva Bewegung. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Müttern schwerkranker Kinder, die sich für die Anwendung und die Selbstherstellung von medizinischem Cannabis stark macht. Lateinamerika und der spanischsprachige Raum waren deshalb interessant, weil ich mich jahrelang in verschiedenen südamerikanischen Ländern aufhielt. Zum Thema Cannabis hatte ich einen besonderen Bezug, weil ich viele Jahre in Uruguay lebte, welches das erste Land weltweit war, das den Cannabisanbau und -konsum im Jahr 2013 – regulierend für Freizeitzwecke – legalisierte.
Sehr rasch entstand eine emotionale Nähe zur Mamá Cultiva Bewegung. Diese ist sicherlich durch eigene Erfahrungen im Gesundheitswesen auf beiden Kontinenten - bedingt durch die onkologische Erkrankung meiner Tochter - geprägt. Das Miterleben des Leides vieler Kinder und das sprachlose Ausgeliefertsein in einem Behandlungsmarathon mit aggressivsten Therapien und die in unzähligen Gesprächen mit PatientInnen und Angehörigen erfahrenen Perspektiven der Suche nach einem würdevollen Leben oder Sterben ließen ein stummes Bild entstehen, das in öffentlichen Gesundheitsdiskussionen kaum wahrgenommen wird. Viele der Themen sind in eine unsichtbare Parallelwelt gedrängt. So kommt es vor, dass Eltern heimlich leidmindernde Begleittherapien für ihre Kinder veranlassen. Sie leben dann noch in der Angst, dass die behandelnden OnkologInnen diese entdecken und sich gegen diese Therapien stellen könnten. Es handelt sich um Therapien, von denen die OnkologInnen meist keinerlei Wissen darüber haben, wie sie wirken und in welcher Form sie hilfreich sein können. Diese Machtkonstellation gepaart mit fehlendem ganzheitlichem medizinischem Wissen und die mangelnde Kommunikation und Wertschätzung zwischen den verschiedenen medizinischen Disziplinen geht zulasten der PatientInnen und deren Angehörigen.
Eine Situation, in der ich vom behandelnden Arzt um die Zustimmung zur Teilnahme an einer klinischen Studie gefragt wurde, und er mir erklärte, dass „ein Computer entscheide“, ob meine Tochter ein bestimmtes Chemotherapiepräparat einmal oder zehnmal verabreicht bekomme, machte mich in der persönlichen Betroffenheit auf eine Dimension aufmerksam, die in diesem Moment nicht benennbar war. Bekanntlich verursachen Chemotherapien oft schwerste Nebenwirkungen, des Öfteren weitere Krebsarten, manchmal sogar den Tod.
Viele körperlichen, verbalen und wortlosen Übergriffe gegenüber Kindern und Angehörigen durch im Gesundheitswesen Tätige mussten als Selbstverständlichkeiten hingenommen werden. Es waren Verhaltensweisen, die nicht mit dem Anschein überstimmten, dass diese Menschen helfen wollten, manche mit liebevoller Hingabe.
In diesen Jahren fand ich oft einige Stunden Schlaf in wohltätigen Einrichtungen, die von Unternehmen gesponsert werden, die gesundheitsschädigende Lebensmittel erzeugen. Die WHO stuft zum Beispiel Wurstwaren als krebserregend ein11. In Uruguay trägt der „Hogar“, das vorübergehende Zuhause in Montevideo für krebskranke Kinder und deren Angehörige den Namen eines sponsernden Wursterzeugungsunternehmens. In vielen Ländern, so auch in Österreich, sponsert die weltweit bekannteste Fastfoodkette Unterkünfte für Angehörige neben den onkologischen Behandlungszentren, um ihnen zu ermöglichen, in der Nähe ihrer leidenden Kinder zu sein. Wenn dann die kahlköpfigen Kinder noch lächelnd für diese Sponsoren und Erzeuger gesundheitsschädigender Lebensmittel vor die Kamera geholt werden12, findet eine Würdeverletzung statt, die die Betroffenen in diesem Moment meist gar nicht wahrnehmen. Betroffene befinden sich in einer derartigen Ausnahmesituation, in der jede Hilfe dankbar angenommen wird. Man durchlebt Situationen, in denen einige Stunden Ruhe als überlebensnotwendig empfunden werden.
In dieser Konstellation versammelt sich nach meinem Empfinden ein abartiger Ausdruck einer enthumanisierten und kommerzialisierten Medizin, unter der viele Menschen, die Hilfe benötigen, leiden müssen. Wie ist es überhaupt möglich, dass Unternehmen, die gesundheitsschädigende und zum Teil als krebserregend eingestufte Lebensmittel herstellen, mit derartigen Werbeaktionen ihr Image aufbessern können? Gleichzeitig leisten diese Unternehmen einen Beitrag zur Krankheitskultur der Gesellschaft und der Menschheit. Kinder werden hier unter dem Titel der Wohltätigkeit für die Zwecke dieser Unternehmen missbraucht. Diese Würdeverletzung stellt eine Gewaltform dar, die gesellschaftlich weitgehend toleriert ist, wird doch jede Hilfe für diese besonders bemitleidenswerten Kinder als mildtätig angesehen.
Viele dieser Erlebnisse förderten nicht unbedingt mein Vertrauen gegenüber dem konventionellen, also vorherrschenden Medizinsystem. Kinder werden nach Protokollen behandelt, die nach einem obsoleten mechanischen Menschenbild13 zustande gekommen sind, in denen jedwede leidmindernden Begleittherapien ausgespart und wissenschaftlichen Ansätze für ein ganzheitliches Menschenbild ignoriert werden. Aus eigenen Wahrnehmungen ist mir bekannt, dass den Kindern nicht selten Psychopharmaka, die weitere Nebenwirkungen verursachen, verabreicht werden, damit sie all die Umstände und aggressiven Therapien ertragen können. Dies geschieht, obwohl es aus anderen Medizinsystemen Wissen gibt, das wesentlich zur Leidminderung beitragen könnte. Dieses Wissen wird ignoriert, unterdrückt oder einfach als unwissenschaftlich abgetan.
Rasch zogen mich daher die Vorträge auf den jährlich stattfindenden internationalen Konferenzen in Santiago de Chile, die von der chilenischen Organisation Fundación Daya, mit deren Hilfe Mamá Cultiva entstanden ist, in den Bann. Internationale ExpertInnen, ForscherInnen und ÄrztInnen, die mit medizinischem Cannabis arbeiten, berichten dort von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und aktuellen Erfahrungen auf globaler Ebene. Ergänzt durch Erzählungen zahlreicher PatientInnen, die zum Teil von einer großen Verbesserung der Lebensqualität durch den Cannabiskonsum berichten, stieg ich eine Welt ein, die aus Geschichten voller Leid aber auch voller Hoffnung und neuer Perspektiven gezeichnet ist. Sei es die Reportage aus Israel über den Einsatz von Cannabis in Altenheimen14, oder Vorträge einer argentinischen Psychiaterin15, die über die Verbesserung der Lebensqualität durch Cannabis für viele psychisch Kranke spricht, all diese Formate vermittelten einen starken befürwortenden Tenor für medizinisches Cannabis zur Verbesserung der Lebensqualität und Verringerung von Leid. Die Behandlung von psychisch Kranken, die oft auch zu Zwangsunterbringungen und Zwangsmedikalisierungen führen, rührten an meine Erfahrungen aus der Arbeit als Juristin mit diesen vulnerablen Personen, die manchmal schwere Einschränkungen ihrer Grund- und Freiheitsrechte erfahren. Diese Einschränkungen werden auf psychiatrische Gutachten, die sich im Rahmen der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten der konventionellen Medizin bewegen, gestützt.
Als ehemalige langjährige Mitarbeiterin in einem Gewaltschutzzentrum bin ich für Gewaltstrukturen und -dynamiken besonders sensibilisiert. Ich begann im Laufe dieser letzten Jahre ein immenses Gewaltpotenzial wahrzunehmen, dessen Ursprung nicht unmittelbar benannt werden konnte, ein Gewaltpotenzial, welches viele menschenrechtliche Themen berührt. Je weiter ich in die Materie vordrang, umso stärker wurden für mich die Gewaltstrukturen auch benennbar. Im Laufe des Studiums der Angewandten Ethik wurden mir die geschichtlich gewachsenen Machtstrukturen in der Medizin und deren philosophische Grundlagen bewusster.
Die Geschichte und die Politik um die Cannabispflanze sowie die Aktivitäten von Mamá Cultiva und der Fundación Daya schienen mir ein großartiges Beispiel, um diese Machtstrukturen einer Medizin, die die Ganzheit des Menschen, dessen individuelle Bedürfnisse und seine Fähigkeiten zur Eigenverantwortung und Selbstheilung aus den Augen verloren hat und die Auswirkungen auf Hilfesuchende nachzuzeichnen. Wenn ich darauf zurückblicke, wie ich in der von Galerien, Antiquitätenhandlungen und Straßenkünstlern geprägten Altstadt von Montevideo flanierte, wo selbstverständlich niemand aus der Fassung gerät, wenn hie und da der süßliche Rauch von Marihuana in der Luft liegt, erinnere mich gleichzeitig an eine Nachrichtenmeldung in Radio Kärnten, in der von einer dramatischen Verhaftung eines jungen Mannes in einer Telefonzelle berichtet wurde, bei der einige Gramm Cannabis „sichergestellt“ wurden.
Persönlich immer nahe an den Lebenserfahrungen der Menschen, erschloss sich für mich in der Mamá Cultiva Bewegung und den Aktivitäten der Fundación Daya ein Forschungsfeld, in dem viele dieser Konfliktpotenziale repräsentiert werden.
1.3 Anschlussbedarf in der Medizinethik
Im Rahmen der Medizinethik sind Diskurse über alternative Therapieentscheidungen praktisch immer am herrschenden, konventionellen Medizinsystem ausgerichtet. Die Medizinethik hat die Aufgabe, bei konfliktbesetzten medizinischen Themen kritische Fragen aus den verschiedensten Perspektiven zu stellen, um den Diskurs in einer geordneten Weise anzuregen. Dazu gehören zum Beispiel Fragen der Sterbehilfe, des Schwangerschaftsabbruches, der künstlichen Fortpflanzung und der Forschung am menschlichen Genom. Ihre Aufgabe ist es auch, Stellungnahmen abzugeben, wenn medizinische Entscheidungen zu treffen sind oder neue Forschungsvorhaben bewilligt werden sollten. Die Medizinethik sollte für die Einhaltung bestimmter Grundwerte im Zusammenhang mit medizinischen und gesundheitspolitischen Entscheidungen sorgen. Den Konfliktthemen um abweichende Therapiemöglichkeiten und Therapieentscheidungen liegt jedoch auch in der Medizinethik meist die Annahme zugrunde, dass es eine einzige gültige wissenschaftliche Medizin gibt, die als Grundlage für medizinethische Empfehlungen heranzuziehen ist. Das herrschende biomedizinische Paradigma mit den industriell-pharmakologisch medikamentösen Behandlungen ist in dieser Grundannahme anderen Therapieformen übergeordnet. Die Grundfeste dieser Medizin sowie vergangene politische und ökonomische Einflüsse auf die Therapieentwicklungen in diesem System, auf das sich ärztliche Empfehlungen für ethische Stellungnahmen stützen, werden dabei gar nicht mehr hinterfragt.
In der Medizinethik wird bei alternativen Therapieentscheidungen kaum einmal aus der Sicht der Betroffenen reflektiert. In gelegentlich eskalierenden Fällen - wenn Eltern mit medizinischen Behandlungen wie Chemotherapien, die schwere Nebenwirkungen verursachen, nicht einverstanden sind, werden diese Konflikte aus dieser einzig gültigen Sicht beurteilt, auch verurteilt. Manchmal steht sogar ein Obsorgeentzug im Raum16. All die dahinterliegenden Problematiken, die zu solchen Konfliktsituationen führen, werden in der bisherigen medizinethischen Literatur kaum differenzierend ausgeleuchtet. Nicht selten informieren sich Eltern, die andere Medizinen in die Behandlungen ihrer Kinder miteinbeziehen, viel weitergehender als Eltern, die bedingungslos den schulmedizinischen Behandlungen zustimmen. Sie nehmen oft enorme Stresssituationen in Kauf, um die Heilung ihrer Kinder zu fördern. Zu rasch werden in solchen Fällen, sofern sie öffentlich werden, schuldige Gurus gesucht, die die Eltern angeblich verführen. Diese Fälle sind jedoch offenbar – soweit ich in diesen Jahren als Betroffene und später als Forschende erfahren konnte - die Spitze eines Eisberges der dahinterliegenden Probleme vieler Betroffenen, die durch ein selbstverständliches Zusammenarbeiten sämtlicher medizinischer Disziplinen und der Wahrnehmung des Menschen in seiner Ganzheit verhindert werden könnten.
Exemplarisch erinnere ich mich an eine Situation, bei der ein privat ordinierender Onkologe, der erwachsene





























