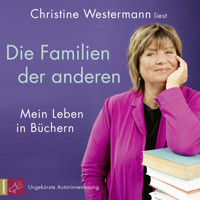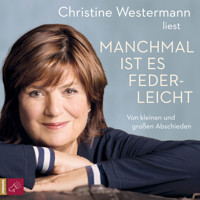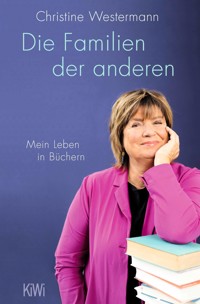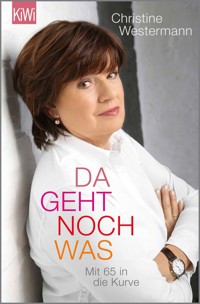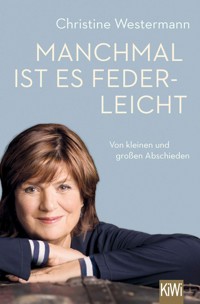
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kann man Abschiednehmen lernen? Das Thema Abschied begleitet uns ein Leben lang. Für Christine Westermann war es wie für viele Menschen von klein auf angstbesetzt. Erst jetzt, in einem Alter, in dem das Abschiednehmen zu einer häufig geübten Praxis wird, gelingt ihr ein offener, zugewandter Blick darauf. Mit unnachahmlichem Charme und Witz erzählt sie von der Kunst, Veränderungen anzunehmen. »Zur letzten Sendung komme ich nicht«, sagte Christine Westermann scherzhaft schon Jahre, bevor an ein Ende der von ihr und Götz Alsmann moderierten preisgekrönten Fernsehsendung »Zimmer frei« auch nur zu denken war. So tief saß ihre Angst vor drohenden Abschieden, dass sie sich nur mit Humor oder totaler Verdrängung zu helfen wusste. Der Humor ist geblieben, aber Christine Westermanns Umgang mit dem Thema Abschied hat sich tiefgehend gewandelt. In ihrem Buch erzählt sie von großen und kleinen Verlusten. Wie schwer wiegt der Abschied von einem Freund, von dem man sicher war, dass er einen überleben würde? Wie leicht kann es sein, eine Stadt, einen Wohnort hinter sich zu lassen, um neu zu beginnen? Wie schwer ist es, an sich selbst zu bemerken, dass Schönheit und Attraktivität verblassen? Natürlich ist die Furcht vor Verlust noch immer dabei, sie wird jedoch gepaart mit neuem Mut, Veränderung anzunehmen. Anekdotenreich, ernst und selbstironisch zugleich erzählt Christine Westermann von Erfahrungen und Situationen, die ihre Wahrnehmung geschult und sie auf einen neuen Weg gebracht haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christine Westermann
Manchmal ist es federleicht
Von kleinen und großen Abschieden
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Westermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Westermann
Christine Westermann ist mit ihren Buchempfehlungen im Stern, ihren Sendungen im Hörfunk (Buchtipps im WDR), als Kolumnistin des »Buchjournals« und als Podcasterin eine der bekanntesten Buchkritikerinnen. Sie war festes Mitglied in der Fernsehsendung »Das literarische Quartett«. Für ihre gemeinsam mit Götz Alsmann moderierte TV-Sendung »Zimmer frei« erhielt sie u.a. den Adolf-Grimme-Preis. Christine Westermann hat bislang fünf Bücher veröffentlicht, die allesamt Bestseller wurden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Zur letzten Sendung komme ich nicht«, sagte Christine Westermann scherzhaft schon Jahre, bevor an ein Ende der von ihr und Götz Alsmann moderierten preisgekrönten Fernsehsendung »Zimmer frei« auch nur zu denken war. So tief saß ihre Angst vor drohenden Abschieden, dass sie sich nur mit Humor oder totaler Verdrängung zu helfen wusste. Der Humor ist geblieben, aber Christine Westermanns Umgang mit dem Thema Abschied hat sich tief gehend gewandelt. In ihrem Buch erzählt sie von großen und kleinen Verlusten, von freiwilligen und unvermeidlichen Abschieden. Wie befreiend kann es sein, eine Stadt, einen Wohnort, einen Lebensabschnitt hinter sich zu lassen, um neu zu beginnen? Wie verkraftet man den Tod eines Freundes, der viel zu früh stirbt? Was passiert, wenn man bemerkt, dass äußere Schönheit und Attraktivität verblassen? Natürlich ist die Furcht vor Verlust noch immer dabei, sie wird jedoch gepaart mit neuem Mut, Veränderungen anzunehmen. Anekdotenreich, ernst und selbstironisch zugleich erzählt Christine Westermann von Erfahrungen und Situationen, die ihre Wahrnehmung geschult und sie auf einen neuen Weg gebracht haben.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
0. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Danksagung
Quellennachweis
Für meinen Vater
0. Kapitel
Die Reporter werden später in ihren Berichten die Zeit festhalten: 20.41 Uhr. Noch aber stemmt sich der Mann gegen die drohende Niederlage. Man kann es an seinem Gesicht sehen. Die Kiefermuskeln arbeiten heftig, er beißt die Zähne fest aufeinander. Guckt gen Himmel, legt den Kopf weit zurück, als könne er die Tränen damit zwingen, ihre Richtung zu ändern. Wieder in die Augen zurückzulaufen statt aus ihnen heraus.
Millionen Menschen sehen ihm dabei zu.
An einem Mittwochabend Ende August 2016 steht Bastian Schweinsteiger im Stadion von Borussia Mönchengladbach, Bilder seiner Fußballerkarriere flimmern über die Großbildleinwand, die Zuschauer erheben sich von ihren Sitzen, klatschen und jubeln ihm zu.
Da gibt er auf, endlich. 20.41 Uhr: Er weint.
Ich auch, zu Hause vor dem Fernsehapparat. Weine mit, beame mich mühelos in diesen fremden Menschen hinein, der sein letztes Spiel für die Fußballnationalmannschaft macht. Der mir so vertraut scheint, weil er an jener Klippe steht, die ich so gut zu kennen glaube. Springen zu müssen, ohne zu wissen, was einen auffangen könnte.
Die Idee, ein Buch über das Abschiednehmen zu schreiben, entstand lange vor dem Schweinsteiger-Abend. In jener Zeit, als das letzte Jahr von Zimmer frei begann. Wir haben damals an einer Wand hinter der Studiodekoration eine Strichliste darüber geführt, wie viele Sendungen uns noch blieben. Irgendwann waren wir bei elf, zehn, neun und dann war es nur noch eine. Eine letzte Sendung, vor der ich großen Respekt hatte, gepaart mit stiller Angst. Ich würde bei diesem Abschied nicht allein sein. Sollte ich die Fassung verlieren, würden mir viele Menschen dabei zuschauen. Ich fürchtete mich davor, unkontrolliert zu schluchzen, so wie Kinder es tun, wenn sie es vor Traurigkeit nicht mehr aushalten.
Es kam anders. Überraschend anders. So als wolle mich das Leben, das Schicksal versöhnen. Entschädigen für den ersten großen Abschied, den Tod meines Vaters, bei dem ich dreizehn Jahre alt war und der mir viele Jahre die Richtung zu weisen schien, was ich zu erwarten hatte, wenn etwas zu Ende ging: Sturz ins Bodenlose, sozialer Abstieg, emotionale Dunkelkammer.
Ich will in diesem Buch versuchen, dem Abschied näherzukommen. Dem großen und dem kleinen, dem beschwerlichen und dem federleichten.
Leichte Abschiede, gibt es die auch? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wenn ein Abschied leicht wäre, müsste man ihn nicht anders nennen? Wäre Abschied dann noch der richtige Begriff?
Wie erlebe ich den Abschied von einem Freund, von dem ich glaubte, er würde an meinem Grab stehen und nicht ich an seinem?
War es leicht, nach Deutschland zurückzukehren, San Francisco und Amerika zu verlassen, wo ich zehn Jahre gelebt hatte, und beim Umzug Menschen und Möbel zurückließ?
Wie schwer ist es, an sich selbst zu bemerken, dass Schönheit und Attraktivität verblassen? Was tritt an ihre Stelle? Eine große Leere? Oder etwas, von dem man nicht mal wusste, dass man es schon lange in sich trägt. Das überraschend schön ist, weil es unerwartet versöhnt mit dem stillen Schrecken ob der eigenen Unbeweglichkeit, der einen überkommt, wenn im Supermarkt an der Kasse die Apfelsine vom Band fällt und man darauf hofft, dass jemand zu Hilfe kommt, dem das Bücken leichtfällt.
Abschiede waren für mich immer gleichbedeutend mit einem neuen Lebensabschnitt. Die Kinderangst aber, dass es womöglich wieder böse enden könnte, hat sich erst in letzter Zeit vorsichtig, sehr zögerlich zurückgezogen.
Abschiednehmen ist eine Kunst.
Der Versuch, die fein austarierte Balance zu halten zwischen der Furcht vor Veränderung und dem Mut, sie anzunehmen.
Das hier ist erst mal nur ein Anfang.
Das Vorwort.
1. Kapitel
Das Foto ist schwarz-weiß, klein und quadratisch, hat den für die Bilder aus jener Zeit typischen gezackten Rand.
Ich war schon vier Jahre auf der Welt, als die Fotografie entstand, aber ich habe keine Erinnerung an jene Zeit Anfang der fünfziger Jahre. Nicht an die Musiktruhe mit ausklappbarem Plattenspieler, nicht an die große Stehlampe, unter deren Schirm mein Vater sitzt, ein Buch in der Hand. Und doch taucht genau jenes Bild unvermittelt auf, hat sich wie eine Verheißung in mir festgesetzt. Sollte ich erklären, was für mich Geborgenheit bedeutet, ist es genau jenes Wohnzimmer in Erfurt. Mit den hohen Bücherregalen, die sich über eine ganze Wand erstrecken, davor die schmale Leiter, um an die Bücher in der obersten Reihe zu kommen.
Mein Vater in seinem großen Lesesessel, einen Arm auf der Lehne, er scheint in sein Buch vertieft. Vielleicht ist es eine Pose, die er glaubt, dem späteren Bildbetrachter schuldig zu sein. Vielleicht hat ihn der Fotograf auch gebeten »Herr Westermann, schauen Sie doch bitte mal ins Buch …«. Die Haare meines Vaters sind akkurat gescheitelt, er trägt eine Strickjacke, ein weißes Hemd, eine Fliege, wie fast immer. Neben dem Sessel, auf einem Beistelltischchen, eine große Uhr und ein glänzend schwarzes Telefon, die Wählscheibe so groß wie ein Kinderkopf.
Das Licht aus der Stehlampe taucht die Szene in warmes goldenes Licht. Das stelle ich mir so vor. Wissen kann ich es nicht, das Foto zeigt nur mattes Schwarz, verblichenes Weiß. Aber das Licht muss golden gewesen sein. Auf meiner emotionalen Farbskala steht golden für ein Wir-haben-es-gut-Gefühl. Dass zu jener Zeit schon nichts mehr gut war, das schwarz-weiße Foto ein Trugbild, habe ich erst Jahre später begriffen.
Die Aufnahme entstand – so weist es die Schrift meines Vaters auf der Rückseite aus – im März 1953. Wenige Tage, bevor mein Vater mit einer schmalen Aktentasche die Wohnung und das Zimmer mit der Stehlampe verließ. In der sicheren Gewissheit, nie mehr zurückkehren zu können. Ziel seiner Flucht war erst mal Ostberlin, wo er am Bahnhof Friedrichstraße in eine S-Bahn stieg, die ihn und die Aktentasche von Ost nach West brachte.
In der Aktentasche steckten jene Papiere, die belegten, warum er nur mit einer Flucht in den Westen sein Leben und das seiner Familie retten konnte.
Als sich im Osten nach dem Krieg vorsichtig wieder politisches Leben regte, wurde mein Vater Gründungsmitglied bei den Liberalen Demokraten der DDR. Als die Gruppierung wenige Jahre später als Blockpartei in der Versenkung verschwand und zu einem Anhängsel der SED wurde, hat er sich nicht geduckt, sondern protestiert. Hat aus seiner Abneigung gegen die SED und die Kommunisten keinen Hehl gemacht. Es war nicht das erste Mal, dass er eintrat für seine Überzeugungen, seine politische Meinung. Jahre zuvor war er gegen die Nationalsozialisten aufgestanden, hatte öffentlich darüber gesprochen, was er bei der BBC, dem Feindsender, über Kriegslage und Konzentrationslager erfahren hatte. Seine Sekretärin schwärzte ihn an. Zwei Jahre vor Kriegsende kam er ins Zuchthaus. Dass es nicht das nahe gelegene Konzentrationslager Buchenwald war, verdankte er Freunden, die sich für ihn einsetzten. Gut vernetzte Freunde waren es auch, die ihn 1953 drängten, zu gehen. Ihm von der schwarzen Liste erzählten, auf der Staatsfeinde wie er standen. Endstation: ein Straflager in der Sowjetunion. Als die Verhaftungswelle anrollte, nahm mein Vater seine Aktentasche und ging.
Zurück blieben Freunde, Verwandte, Andenken, Fotos, Möbel, Bücher, fast ein ganzes Leben. Als er floh, war er vierundsechzig, nicht einmal zehn Jahre später starb er.
Wenige Tage nach meinem Vater nahm meine Mutter mit mir den gleichen Fluchtweg über Ostberlin in den Westen. Sie hat für mich entschieden: meine kahlköpfige Puppe Gisela durfte mit. Sonst nichts.
Was hätte mein Vater eingepackt, wäre die Zeit nicht so knapp gewesen? Wofür entscheidet man sich, wenn man flüchten muss? Hätte er mehr Zeit gehabt, was aus dem alten Leben hätte er ins neue retten wollen?
Woran sein Herz wirklich hing, habe ich erst viel später erfahren.
Ich habe nur einmal die Flucht in ein anderes Leben gewagt.
Ohne Not und in der Rückschau federleicht.
Habe Möbel, Geschirr, Klamotten und Kleinkram in den Kellern von Freunden untergestellt.
Bin mit zwei Koffern, zwei Kaffeetassen und einem Buch aus dem Regal meines Vaters nach Amerika aufgebrochen. Als könne mir dieses Buch Mut machen, die Reise ins große Ungewisse zu wagen.
Nein, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Kaffeetassen aussahen, und schon gar nicht, warum sie mitmussten.
Zehn Jahre habe ich in den USA gelebt und heute, lange nach dem Amerikaabenteuer, festigt sich die Erkenntnis, dass ich mitunter ein unerwartetes Talent zum Abschiednehmen habe. Ich kann leicht loslassen.
Dinge, manchmal auch Menschen.
Ich habe all die ab- und untergestellten Dinge nie mehr abgeholt. Nicht mehr gebraucht, nicht mehr gewollt.
Ich weiß nicht, bei wem ich was untergestellt habe. Erinnere mich schwach an einen schönen antiken Geschirrschrank, dem damals die zwei Kaffeetassen fehlten – was sonst drin war, ich weiß es nicht.
Es gab Klamotten, Bettwäsche, Bilder, Bücher, einen Strandkorb und ein Bett. Weg. Aus meinem Gedächtnis getilgt. Ich glaube, ich hatte ein paar schöne Sachen, alt und neu, eher IKEA als edel, aber offensichtlich hing mein Herz nicht an einzelnen Dingen.
Bis heute bedauere ich das kein bisschen.
Als ich San Francisco nach zehn Jahren wieder verließ, war es anders. Ich wollte nicht alles stehen und liegen lassen, ich wollte etwas mitnehmen, was mich für immer mit dieser Zeit verbinden würde. Erinnerungen waren mir wichtig, nicht nur die, die ich im Kopf und im Herzen hatte. Ein paar sperrige Sachen wie Bett, Sofa und einen sehr kalifornischen Sonnenschirm habe ich an Freunde verschenkt. Esstisch und Stühle, Handtücher, Lampenschirme und Bilder aber sollten unbedingt mit nach Europa.
San Francisco – Köln, ungewöhnliche Entfernung, aber im Grunde eben auch nur ein Umzug. Die Transportfirma hat meine halbe Wohnung in einen Container gepackt, der auf einem Schiff Richtung Rotterdam verstaut wurde und drei Monate später in einem Kölner Hinterhof ankam. Die Packer hatten sehr sorgfältig gearbeitet, selbst eine angebrochene Packung Frosties hatte den Weg über den Atlantik unbeschadet überstanden.
Die Dinge des Lebens, die sich in zehn Jahren Amerika angesammelt hatten, passten sich nahtlos der neuen Umgebung an. Genau wie ich. In der Rückschau ist mir der Abschied von Freunden, der Abschied aus der Stadt, aus meinem Viertel, von meinen Kneipen, Läden, nicht schwergefallen. Manchmal, ganz selten, wünsche ich mir heimlich die Vietnamesin herbei, bei der ich zehn Jahre die beste Pediküre meines Lebens bekommen habe. Oder die Sonntage im Bett mit sieben Stunden Livefootball im Fernsehen. Die Jogging-Strecke im Golden-Gate-Park.
Es sind Kleinigkeiten, an denen das Herz hängt.
Nie lange, nur für einen kurzen Moment flackert eine unbestimmte Sehnsucht auf. Wonach? Kann ich nicht einmal benennen. Aber das Sehnsuchtsgefühl erkenne ich gut.
Ich bin in meiner Amerikazeit oft gependelt, zwischen San Francisco und Köln, habe hier wie dort als Journalistin gearbeitet. Auf Flughäfen habe ich jene Sehnsucht besonders gut spüren können.
»Lufthansa Flug 454 von Frankfurt nach San Francisco«, eine Ansage, bei der ich damals einen fast körperlichen Schmerz erlebt habe. Immer verbunden mit dem Gedanken: Wie wird es sein, wenn diese Ansage irgendwann einmal nicht mehr mir gilt?
Wenn ich sie nur zufällig höre, weil ich gerade von Frankfurt nach Berlin und eben nicht nach San Francisco fliege? Und es schien völlig klar: Das könnte ich nur schwer aushalten, dieser Abschied darf nicht sein.
Warum der Gedanke so stark war, kann ich erst heute, mit vielen Jahren Abstand, vermuten: weil damals die Lust, beinahe schon die Begierde auf neue Erfahrungen, auf große und kleine Mutproben, die unweigerlich zum Leben in einer anderen Kultur gehören, beinahe übermächtig war.
Ich wollte sie erleben und bestehen.
Sich davon verabschieden? In diesem Stadium undenkbar. Wann es over und aus ist, wollte ich immer selbst bestimmen.
Wenn ich heute auf einem Flughafen stehe und die Durchsage für einen Amerikaflug höre, regt sich kurz das Gefühl von damals, als wolle es wieder bei mir andocken. Aber keine Chance.
Ich verspüre eine leise Freude, fast schon Genugtuung, dass das Loslassen damals so leicht ging. Dass ich einen Lebensabschnitt beenden konnte, weil etwas Neues zu beginnen verlockender, lohnender war. Nach Hause zurückzukehren.
Oder vielleicht auch nur, weil es genug war? Genug Amerika? Genug Football-Spiele, Golden-Gate-Park-Jogging?
Heute laufe ich am Rhein, habe eine Dauerkarte beim 1. FC Köln, und meine Fußnägel schneide ich mir selbst.
Ist es gutes Timing, das Abschiede leicht oder schwer macht? Hat wirklich alles seine Zeit?
Ist es immer dann schwer, wenn die Zeit noch nicht reif ist? Wenn man neu anfangen muss, bevor etwas spürbar zu Ende gehen konnte, seinen Abschluss gefunden hatte?
Ist es das?
Mein Vater hat wenige Jahre vor seinem Lebensende ein neues Leben angefangen. Anfangen müssen. Mit seiner Frau und seinem Kind in einer winzigen Einzimmerwohnung. Ich erinnere mich ganz schwach an diese Wohnung, an mein Kindergitterbett, das in der schmalen Küche stand. Es gibt kein Foto aus dieser Zeit, aber golden ist in meiner Erinnerung nichts. Dafür taucht rot auf. Das Rot einer Süßigkeit, die mir meine Eltern schenkten, verbunden mit der Nachricht, dass sie sich scheiden lassen würden.
Meine Mutter zog aus, mein Vater blieb, er bekam Jahre später im selben Haus eine Zweizimmerwohnung. Hatte wieder Platz für eine Stehlampe, für einen Radioapparat mit kleinem Plattenspieler. Und für ein Bücherregal. Ohne Leiter.
Als meine Eltern aus der DDR flohen, hatten sie keine Zeit, das Danach zu organisieren. In den wenigen Tagen, bevor die Flucht entdeckt wurde, haben Freunde Bücher, Fotos und Erinnerungsstücke heimlich aus der Wohnung geholt. Die Nachbarn, denen mein Vater sich nah fühlte, bekamen die Musiktruhe, die Stehlampe. Der große Rest? Ich weiß bis heute nicht, was in der DDR mit den Sachen eines Republikflüchtlings geschehen ist.
Stück für Stück hat mein Vater ein paar Dinge aus seinem alten Leben zurückbekommen. Zwei Teller und Kaffeetassen aus dem Haushalt seiner Mutter, ein Besteck aus Hirschgeweih von seinem Vater, Seidenschal und Zylinder, die er bei Premieren im Erfurter Theater trug, dessen Verwaltungsdirektor er war. Freunde, die in den Westen reisen durften, brachten heimlich ein paar seiner Bücher mit. Auch Berta von Suttners »Die Waffen nieder«, jenes Buch, das ich fast fünf Jahrzehnte später mit nach Amerika genommen habe.
Ich konnte nie mit meinem Vater darüber reden, wie er diesen Abschied von seiner Heimat erlebt, wie er ihn verkraftet hat. Ich war zu klein, zu jung, um zu begreifen, dass man es Abschied nennt, wenn man sich von etwas trennen muss.
Dass es wehtut, wusste ich schon.
Die Scheidung der Eltern zu erleben, das kommt dem Schmerz eines ungewollten Abschieds schon ziemlich nahe.
Am Ende seines Lebens kam mein Vater schließlich doch noch nach Erfurt, in seine Heimatstadt zurück. Das hatte er sich gewünscht, in seinem Testament so verfügt. Seine Asche wurde in einem Grab auf dem Erfurter Nordfriedhof beigesetzt. Unter einem Holzkreuz, auf dem Geburtstag und Todestag seines Sohnes standen.
Der war 1941 als junger Soldat in einem Wald bei Smolensk nach einem Bauchschuss verblutet. Sein Tagebuch erzählt von den letzten Stunden seines Lebens, ganz am Ende stehen die Abschiedsworte an seine Eltern.
Jenes Tagebuch hat mein Vater wie einen Schatz gehütet. Es lag in der schmalen Aktentasche, mit der er von Ost nach West ging.
2. Kapitel
Ich habe schöne Füße. Ist leider all die Jahre keinem aufgefallen, außer mir natürlich. Ich dachte übrigens immer, dass Models auch automatisch mit schönen Füßen ausgestattet sind. Ein attraktives Gesamtpaket: Erst werden sie mit Klamotten fotografiert, später kommen die Strümpfe dran und am Ende die Flipflops und die Korksandalen. Falsch kombiniert. Es ist durchaus möglich, einen Gehrock in Größe 46 zu tragen und unten auf schönen, schmalen Füßen zu stehen.
Diese ungewöhnliche Kombination gibt es, man kann sie sich bei mir anschauen. Interessiert aber keinen.
Frauen mit besonders schönen Füßen machen Werbung für Hornhautentferner und Hühneraugenpflaster, für Gesundheitssandalen oder knallroten Nagellack. Vorausgesetzt, sie sind jung.
Hätte ich das mal früher gewusst, meine Füße und ich wären groß rausgekommen.
Dass Westermann Werbung machen könnte, daran habe ich nie einen Gedanken verschwendet.
Bis neulich dieser Brief kam. An mich adressiert.
Mit einem »Vorteilsgutschein für Frau Westermann« und einer persönlichen Einladung zum kostenlosen Hörtest.
Die Hörgeräte könnte ich in meinem privaten Umfeld testen, bevor ich mich für die »optimale Hörlösung« entscheiden würde.
Hörtest? Ich verstehe nur Bahnhof.
Hat sich jemand beschwert, dass die Glotze zu laut ist?
Habe ich in einer Konferenz zu oft nachgefragt?
Oder ist Schwerhörigkeit und damit Post vom Hörgerätemann ganz automatisch die Folge eines Geburtsdatums kurz nach der Währungsreform?
Im Alter lässt alles nach, auch die Ohren kriegen so eine Art Zellulitis. Haben Sie mich verstanden?
Wenn Werbeleute eine Frau wie mich sehen, denken sie ganz offensichtlich nicht mehr an schöne Füße. Sie bewegen sich in anderen Bereichen. Versuchen es hintenherum.
Ein Pharmaunternehmen möchte mich unbedingt als Werbepartner gewinnen. Das Angebot ist hochdotiert, der Aufwand für den Fernsehdreh, heißt es, sei denkbar gering, das Bild in der Apothekerzeitung würde nur unwesentlich größer als ein Passbild werden. Ich müsse nur vorne in die Kamera lächeln und mit der Hand freundlich nach hinten zeigen, auf die Maxi-Packung Hämorhoidensalbe.
Ich habe das erst mal dankend abgelehnt.
Rechne jetzt aber täglich mit einem Werbeangebot für Treppenlifte. Bin ich dabei. Unter der Bedingung, barfuß nach oben zu schweben. Eine späte Chance für meine schönen Füße.
So wie sie wollte ich immer sein. So schön. Ich war in Männer verknallt, mit denen sie zusammen war, vielleicht fand ich die Männer auch nur deshalb attraktiv, weil sie in ihrer Nähe sein durften. Der Mann, in den eine wie Erika Pluhar sich verlieben konnte, musste etwas Magisches haben.
André Heller war so einer. Erika Pluhar, die Schauspielerin, die Sängerin, hat ihn geheiratet. Die Liebeslieder, die er in den 1970er-Jahren für sie schrieb, ich habe sie rauf und runter gehört. Die Langspielplatten stehen noch heute in einer Kiste unten im Keller.