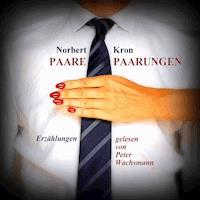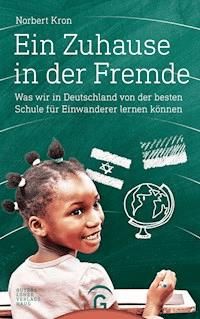19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von honigsüßen Schmeicheleien über emotionale Erpressung bis kurz vor der finstren Höllendrohung: Es gibt kaum ein Register, das der Erzähler und seine alternde Mutter nicht ziehen, bis sie endlich das erreichen, was ihnen guttut … »Kennen Sie den Witz von der Mutter, die ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten schenkt? Nein? Also: Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten. Eigentlich hat er sich Geschenke dieser Art von ihr nachdrücklich verbeten. Als er ihr zuliebe beim nächsten Festessen dennoch eine davon trägt, sieht sie ihn verletzt an und sagt: ›Und die andere? Hat dir wohl nicht gefallen!‹« Der Leser ahnt: Leicht war dieses Mutter-Sohn-Verhältnis noch nie. Mit dem Älterwerden der Mutter wird es nicht eben leichter. Und so gerät zum fintenreichen Scharmützel, was angesichts eines wüst verbeulten Autos eigentlich selbstverständlich sein sollte: dass die fast blinde Mutter endlich ihren Autoschlüssel abgibt. Und zum herkulischen Kampf, wenn der Sohn sie dazu bringen will, eine Vorsorgevollmacht zu unterschreiben oder gar die Hilfe eines Pflegedienstes zu erwägen. Was wie Verwandtschafts-Catchen beginnt, bringt allerdings auch existenzielle Einsichten mit sich – über Liebe, Tod und Familiengeheimnisse: Warum die komplizierte deutsche Geschichte aus der heimatvertriebenen Mutter machte, wer sie ist, und wie aus lebenslangen Kämpfen am Ende noch Versöhnung und Glück erwachsen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Norbert Kron
Manchmal ist es sogar lustig
Meine Mutter, ihr langes Leben und ich. Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Norbert Kron
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Norbert Kron
Norbert Kron, Jahrgang 1965, ist Journalist, Filmemacher und Autor. Er studierte in München und macht Kulturbeiträge vor allem für ARD/ttt und ZDF/Aspekte und veröffentliche zahlreiche Bücher. Er gründete den YouTube-Kanal Norbert Kron ARTstories, auf dem er Hintergrundgespräche mit Schriftstellern, Philosophen, Schauspielern und anderen Künstlern führt, z. B. mit Jodie Foster, Wolfram Eilenberger, Hildur Guðnadóttir, Ingo Schulze und Willem Dafoe. 2022 erschien sein Roman Der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Von honigsüßen Schmeicheleien über emotionale Erpressung bis kurz vor der finstren Höllendrohung: Es gibt kaum ein Register, das der Erzähler und seine alternde Mutter nicht ziehen, bis sie endlich das erreichen, was ihnen guttut …
»Kennen Sie den Witz von der Mutter, die ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten schenkt? Nein? Also: Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten. Eigentlich hat er sich Geschenke dieser Art von ihr nachdrücklich verbeten. Als er ihr zuliebe beim nächsten Festessen dennoch eine davon trägt, sieht sie ihn verletzt an und sagt: ›Und die andere? Hat dir wohl nicht gefallen!‹«
Der Leser ahnt: Leicht war dieses Mutter-Sohn-Verhältnis noch nie. Mit dem Älterwerden der Mutter wird es nicht eben leichter. Und so gerät zum fintenreichen Scharmützel, was angesichts eines wüst verbeulten Autos eigentlich selbstverständlich sein sollte: dass die fast blinde Mutter endlich ihren Autoschlüssel abgibt. Und zum herkulischen Kampf, wenn der Sohn sie dazu bringen will, eine Vorsorgevollmacht zu unterschreiben oder gar die Hilfe eines Pflegedienstes zu erwägen.
Was wie Verwandtschafts-Catchen beginnt, bringt allerdings auch existenzielle Einsichten mit sich – über Liebe, Tod und Familiengeheimnisse: Warum die komplizierte deutsche Geschichte aus der aus Böhmen stammenden, heimatvertriebenen Mutter machte, wer sie ist, und wie aus lebenslangen Kämpfen am Ende noch Versöhnung und Glück erwachsen.
Inhaltsverzeichnis
Eins Darf ich vorstellen: meine Mutter
Nachträgliches Vorwort des Sohns
Zwei Der Weihnachtswunsch
1. Kapitel
2. Kapitel
Drei Bescherung bei den Becketts
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Vier Alles neu macht der März
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Fünf Hotel California
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Sechs Musik liegt in der Luft
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Sieben Große Oper
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Acht Mordslust auf Freiheit
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Neun Carola
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Zehn Das wahre Geheimnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Elf Leinen los
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Zwölf Wer seine Mutter liebt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Dreizehn Ein einziger Augenblick
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Vierzehn Last Christmas
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Fünfzehn Das Beste kommt zum Schluss
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Nachwort des Autors
Quellenangaben und Lektüreempfehlungen
»Das Leben ist wie ein Kaktus.
Man kann die Stacheln betrachten
oder die Blüten.«
(Kalenderspruch)
EinsDarf ich vorstellen: meine Mutter
Kennen Sie den jüdischen Witz von der Mutter, die ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten schenkt? Nein?
Also: Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Krawatten. Eigentlich hat er sich Geschenke dieser Art von ihr nachdrücklich verbeten. Als er ihr zuliebe beim nächsten Festessen dennoch eine davon trägt, sieht sie ihn verletzt an und sagt:
»Und die andere? Hat dir wohl nicht gefallen!«
Jetzt kennen Sie den Witz. Und Sie kennen meine Mutter.
Als ich an diesem Sommertag zu ihr ins Wohnzimmer trete – sie ist 91 und wohnt noch immer allein in ihrem Reihenhaus am Münchner Stadtrand –, blickt sie vorwurfsvoll zu mir auf:
»Ja, wo bleibst du denn? Ich dachte, du kommst viel früher. Hast du was eingekauft?«
Es ist zwölf Uhr mittags, ich bin um halb sieben in Berlin in den Zug gestiegen und nach der Ankunft am Münchner Hauptbahnhof gleich zu ihr gefahren, um schnellstmöglich bei ihr zu sein.
»Wir haben doch gestern am Telefon besprochen, dass ich vor dem Einkaufen zu dir komme«, sage ich ruhig. »Wenn ich erst einkaufen gegangen wäre, wäre ich noch später hier.«
Sie schaut mich an, als würde ich eine fremde Sprache sprechen.
»Ich hab Hunger. Ich kriege hier doch nichts. Du hättest wenigstens gleich – na, du weißt schon was – besorgen können. Das, was ich am liebsten ess.«
Das, was sie am liebsten isst, ist – Eis. Ja, sie liebt Eis, isst es zu jeder Gelegenheit, ob zu Kaffee und Kuchen, zum Frühstück und zum Abendessen, Hauptsache: viel. Weshalb ich es ihr in Großpackungen kaufen muss. Wenn ich ihr sage: »Iss nicht so viel Süßes! Das ist nicht gesund!«, lacht sie das weg: »Der Papa war Österreicher, ich bin mit Süßspeisen aufgewachsen!« So ist sie 91 geworden, am 1. Juni 2021, und immer noch munter und voller Widerspruchsgeist. Wenn auch etwas schwerhörig.
»Wir wollten ja deine Einkaufsliste zusammen machen. Damit ich beim Einkaufen all deine Essenswünsche erfüllen kann, nicht nur die süßen –«
Sie schaut mich verständnislos an.
»Ach, ich versteh dich nicht«, macht sie eine wegwerfende Handbewegung. »Du musst lauter sprechen. Aber dir ist es egal, ob ich verhungere.«
Sie versteht mich nicht, natürlich, weil sie ihre Hörgeräte nicht drin hat. Vermutlich erinnert sie sich auch nicht an unser Telefonat. Im letzten halben Jahr hat sich das Problem mit ihrer Vergesslichkeit zugespitzt. Sie wirft immer öfter die Zeit durcheinander, erzählt mir im Sommer, dass Weihnachten unmittelbar vor der Tür stehe, und wenn ich ihr sage, dass ich sie Samstag besuchen komme, weiß sie anderntags nichts mehr davon. Auch dass ich alle zwei, drei Wochen zu ihr fahre, stellt sie regelmäßig in Abrede – und behauptet, dass ich sie monatelang im Stich ließe.
So auch jetzt wieder:
»Du kommst mich ja sowieso nie besuchen.«
»Wie bitte? Ich war erst vor zwei Wochen da. Und ich muss ja schließlich auch arbeiten.«
»Was sagst du?«
»Dass ich zwischendurch arbeiten muss!«
»Ach! Was arbeitest du denn? Es ist Monate her, dass du hier warst! Und ich bin hier ganz allein.«
»Es ist erst zwei Wochen her – und ich bin leider kein vollberuflicher Krankenpfleger. Ich habe dir schon oft gesagt: Wenn du in ein Heim umziehen würdest, nach Berlin …«
»Was? Ich verstehe kein Wort.«
»Nach Berlin, in ein Heim – dann könnte ich dich alle zwei Tage besuchen!«
»Berlin!? Kommt nicht infrage. Die reden da doch so preußisch! Außerdem ist es bei mir schön.«
»Gut. Wie wäre es, wenn eine 24-Stunden-Pflegerin bei dir einziehen würde? Die kann sich dann den ganzen Tag um dich kümmern.«
»Was? Wer?«
»Eine Pflegerin. Die oben bei dir im Haus wohnt. Ich räume ihr ein Zimmer frei.«
»Hier? Wohnen? Aber ich will meine Ruhe haben!! Ich bin gern allein!«
Die Lautstärke unseres Gesprächs hat sich bei den letzten Dialogen ganz von selbst gesteigert. So ist es immer, egal welches Thema wir haben. Anfangs liegt es nur daran, dass sie ihre Hörgeräte nicht drin hat, dann treibt die Auseinandersetzung die Lautstärke in die Höhe. Es hilft auch nichts, wenn ich ihr zurufe: »Es reicht jetzt. Nimm deine Hörgeräte« – was sie ohnehin erst versteht, nachdem ich es dreimal wiederholt habe. Wenn sie es schließlich doch verstanden hat, schüttelt sie energisch den Kopf und ruft zurück: »Auf keinen Fall. Die fallen so leicht raus. Dann verliere ich sie.« Worauf ich, mit weiter angeschwollener Stimme, schreie: »Aber wenn du sie nicht hernimmst, brauchst du sie doch überhaupt nicht.« Natürlich schaut sie mich dann strafend an und stößt aus: »Ah, du nuschelst wieder so. Wenn du nicht so nuscheln würdest, könnte ich dich auch verstehen.«
Es ist nicht leicht, Sie verstehen. Das Ganze geht schon seit Jahren so. Trotzdem, oder richtiger: Deshalb fahre ich alle zwei, drei Wochen von Berlin zu ihr nach München, um den Feuerwehrmann zu spielen. Es kostet mich viel Kraft. Meine Partnerin, genau wie viele andere in meinem Freundeskreis, sagen, dass ich zu viel Kraft für meine Mutter aufwenden würde – dass sie selbst schuld an ihrer Lage sei und meine Mühe nicht wertzuschätzen wisse. Das stimmt, denke ich, und trotzdem, so schwierig das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir sein mag: Ich bin der Meinung, dass ich sie nicht im Stich lassen kann. Sie würde ja wirklich verhungern.
Da stehe ich also wieder vor ihrem großen Sessel, noch immer mit der Reisetasche, und versuche es noch einmal von vorn. Tief durchatmen, nicht aufregen. Sie schaut von unten zu mir herauf, wobei sie mehr liegt als sitzt, ein zierliches, fragiles Wesen, in dessen Augen die muntere Widerstandskraft blitzt, mit der sie allen Anfeindungen des Alters trotzt. Am Fensterbrett stehen die Agaven und Kakteen, die sie hegt und pflegt, während die Wohnzimmerwände von der großen Bibliothek flankiert sind, die mein Vater einst angesammelt hat. Er ist schon vor dreißig Jahren gestorben, nachdem er lange Pflegefall war, und meine Mutter und ich haben ihn hier versorgt. Es war eine schreckliche Zeit, die bei uns beiden Narben hinterlassen hat, und wahrscheinlich fühle ich mich auch deshalb verpflichtet, ihr zur Seite zu stehen.
»Also, was soll ich einkaufen?«, versuche ich mit lauter, ruhiger Stimme zu ihr durchzudringen. »Sag mir einfach, was du dir alles wünschst. Ich gehe sofort los.«
Ihre Augen leuchten jetzt dankbar aus dem Sessel zu mir auf. Na also, ein echter Neustart.
»Das habe ich doch schon gesagt. Das, was ich am liebsten mag – du weißt schon – ein –«
Ihr fällt das Wort nicht ein.
»Du meinst – ein Eis.«
»Nein! Nicht Eis! Doch nicht jetzt vor Weihnachten! Ich meine das andere – was wie die Soldaten heißt!«, ruft sie trotzig.
Kein Eis? Sondern – »Wie die Soldaten?«
Ich bin verwirrt. Das Blut pocht noch immer in meinen Adern, ich kann wahrscheinlich nicht richtig denken.
»Na, wie heißen die denn?«, beharrt sie. »Nach denen mein Lieblingsessen benannt ist!«
Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon sie spricht. Ich stehe im Raum wie ein Schuljunge, der an die Tafel gerufen wird und nicht einmal die Frage mitbekommen hat. Dann plötzlich eine Eingebung:
»Du meinst – Fürst-Pückler-Eis!?« Ich strahle angesichts der Erleuchtung, die mir gekommen ist: »Pückler war Soldat!«
Hermann Graf von Pückler-Muskau, der Mann, nach dem das Eis benannt ist, war nicht nur ein berühmter Landschaftsarchitekt, sondern – tatsächlich: Generalleutnant der preußischen Armee.
»Doch nicht Pückler«, lacht sie mich aus. »Dschinghis Khan!! Denk doch nach. Der ist mit seinen Reiterhorden aus dem Osten eingefallen – wie hießen die denn?«
Ich stehe im Wohnzimmer und starre Kreuzworträtsel-Fragezeichen in die Luft. Östliches Kavallerievolk, nach dem ein Essen benannt ist?
»Die – Hunnen? Die – Kosaken?«
»Ha, bist du dumm!«, sie macht mit der Hand den Scheibenwischer vor der Stirn. »Nein! Das ist so weich, das ess ich mit der Hand.«
»Die Mongolen? Die Tar-«
Und auf einmal springt mir das Wort wie ein Wildpferd in den Kopf. Begleitet von einem wilden Lachen, das den Buchstabenhufen hinterherjagt:
»Du meinst, haha, die Tartaren!«
Tatsächlich. Ihre Augen leuchten auf:
»Tartar!! Ein Tartar, ja! Kauf mir welches, bitte!«
Natürlich. Außer Eis will meine Mutter auch immer Tartar essen. Auch ein »österreichisches« Gericht, wie Sie sagt, das sie von ihrem »Papa« übernommen habe. Aber Tartar – wie die Tartaren? Ich fasse es nicht, darauf kann nur meine Mutter kommen.
»Das Tartar hat aber nichts mit den Tartaren zu tun«, schüttle ich den Kopf. »Das ist ja kein Pferdefleisch.«
Ich war gerade erst im Frankreichurlaub, wo Lea, meine Lebensgefährtin, und ich des Öfteren Tartar gegessen haben. In Frankreich ist das beinahe ein Nationalgericht – wie Foie Gras oder Crêpe Suzette: »Steak tartare frites«! Anders als die Franzosen isst meine Mutter das Tartar aber ohne Ei, Kapern, Pfeffer, Tabasco – sondern pur: mit der Hand in den Mund.
»Schlag das mal nach«, ruft sie bestimmt. »Im Brockhaus.«
»Das kann ich googeln«, hebe ich die Schultern. Als ich ihr ratloses Gesicht sehe, gebe ich aber sofort nach. Meine Mutter ist der einzige Mensch weltweit, der noch immer nicht weiß, wer oder was »das Internet« ist. Also hole ich den alten Brockhaus aus dem Regal und schlage den Band Ta-Tz auf.
»Tartaren« – da steht es ja, ein kurzer Eintrag: »Tartaren, fälschlich für –> Tataren.«
Ich bin ein wenig überrascht und fühle mich zugleich bestätigt. Denn von »Tartar« ist hier nirgendwo etwas zu lesen. Ich blättere zwei Seiten weiter und finde jetzt den richtigen Artikel. Ich lese, nein, vielmehr schreie ihn in den Raum hinein:
»TATAREN! Ursprünglich ein Stamm der –> MONGOLEN! Dann auf das Neuvolk angewandt, das sich im Staat der –> GOLDENEN HORDE im 13./14. Jahrh. bildete! Die Reitertruppen, die unter dem Großkhan DSCHINGIS KHAN in Europa einfielen, wurden in manchen Quellen als TA(R)TAREN bezeichnet!«
Und das Tartar? Fehlt im Brockhaus. Und sowenig wie es einen Eintrag für »Tartar« gibt, gibt es einen für »Tatar«. Na, bitte! Weit und breit kein Hinweis.
Allerdings ist jetzt meine Neugier geweckt. Ich google das Ganze doch am Handy. Verblüffenderweise finde ich auch bei Wikipedia keinen Eintrag zu »Tartar«. Erst als ich weitersuche, entdecke ich einen Lexikoneintrag namens »Beefsteak Tatar«. Ich klicke ihn an – und es schlägt dreizehn! Ich traue meinen Augen nicht. Da steht es:
»Beefsteak Tatar ist nach dem asiatischen Steppenvolk der Tataren benannt, denen damals noch nachgesagt wurde, sie hätten früher rohe Fleischstücke unter ihren Sätteln mürbe geritten und anschließend verzehrt.«
Ich schaue zu meiner Mutter hinunter. Sie liegt im Sessel, der Heißhunger glimmt in ihren Augen, es ist ein geradezu tatarisches Leuchten. Sie hat recht gehabt. Haben Sie das gewusst? Hand aufs Herz! Dass Tatar von den Tataren kommt?
»Du hast recht gehabt«, räuspere ich mich halblaut. »Na gut. Dann hole ich jetzt Tatar wie von den Tataren. Und sonst? Was soll ich sonst einkaufen?«
Sie blickt mich befriedigt an, und wir machen eine gemeinsame Einkaufsliste – wobei sie jetzt in der glücklichen Erwartung ihres Tatars auf einmal viel besser zu hören scheint. Ich notiere: Kaffee im Sonderangebot, 10 x Kondensmilch 7,5 %, süßen Joghurt, Bananen, Pralinen, nicht zu vergessen: eine frische Breze und Butter.
Da steht alles schwarz auf weiß. Ich bin ebenfalls befriedigt, weil ich mich endlich auf den Weg machen kann – und genau weiß, was ich mitbringen muss. Heute wird es keinen Streit mehr über den Einkauf geben.
Tatsächlich: Als ich zurückkomme und ihr das Tatar an den Sessel bringe, einen weichen Fleischklumpen im Einwickelpapier, strahlt sie über das ganze Gesicht. Sie reißt das Papier sofort auf – greift mit der Hand zu. »Ein bisschen kalt«, sagt sie. »Egal!« Es ist unglaublich, wie sie das Tatar in sich hineinschlingt. Das geht eins, zwei, drei. Als ich die anderen Einkäufe in der Küche verräumt habe und ins Wohnzimmer zurückkehre, hat sie bereits die ganze Portion aufgegessen. In ihrem Gesicht scheint eine Wonne auf, die über das pure Sättigungsgefühl, über jede Form physischer Befriedigung hinausreicht. Es ist, als hätte sie vom Glück an sich gekostet.
Ich nehme ihr das leere Einwickelpapier vom Schoß. Rechts und links von ihr liegen kleine Tatarstückchen auf dem Sessel, die ich ihr in die Hand drücke. Sie steckt sie sogleich in den Mund. In dem Glanz, der in ihrem Gesicht liegt, regt sich ein neuer Impuls. Nein, kein Dank, sie sieht mich unternehmungslustig an.
»Wunderbar. Und jetzt!«, ruft sie. »Jetzt hätt ich gern – ein Eis!«
»Eis!?«
Ich stehe da und schüttle den Kopf.
»Du hast vorhin nichts von Eis gesagt«, schreie ich.
»Ich versteh dich nicht. Du nuschelst schon wieder!«
Ich halte ihr die Liste vors Gesicht.
»Hier, das ist alles, was du haben wolltest.« Verstehen Sie nun, warum ich Einkaufslisten lieber schwarz auf weiß mache?
»Ah, wie soll ich das lesen? Du hast doch meine Brille wieder verlegt.«
Ich muss aufpassen, dass ich ruhig bleibe. Ihnen muss ich es nicht sagen – aber für das Protokoll halte ich fest: Ich habe ihre Brille nicht verlegt. Ich habe sie noch gar nicht gesehen, seit ich im Reihenhaus angekommen bin. Garantiert werde ich die nächsten zwanzig Minuten zwischen Esstisch und Sofa herumkriechen, bis ich sie – halb verbogen und verschmutzt – zwischen Bonbonpapieren und anderem Müll auf dem Boden wiedergefunden habe. Aber das Thema lasse ich jetzt. Ich atme tief ein. Ich bin auf diesen Moment vorbereitet.
»Du willst also Eis?«
»Natürlich! Was Süßes! Eine Nachspeise.«
»Du hast nichts davon gesagt«, sage ich laut und deutlich. Und setze dann ein kleines Lächeln auf: »Aber ich habe dir trotzdem ein Eis gekauft.« Worauf ich eine Großpackung Fürst Pückler hinter dem Rücken hervorziehe.
»Ach, wunderbar!«, ruft sie. »Gib mir einen Löffel! Aber einen großen!« Und dann schaufelt sie das Eis direkt aus der Packung in sich hinein.
Jetzt haben Sie einen ersten Eindruck von meiner Mutter. Und von dem, was ich Ihnen hier erzählen will. Auch wenn meine Mutter schwer hört, brennt in ihr ein lebenslustiger Furor, ein fast militärisches Feuer der Lebensfreude, mit der sie sich und alle anderen durch die Schlacht des Alters kommandiert. Die Waffen, die sie dabei nutzt, sind ihre Erinnerungen und Süchte. Warum sollte ich ihr das Eis vorenthalten, das sie so liebt? Weil es gesünder für sie wäre? Das wäre so, als hätte man Helmut Schmidt am Ende seines historischen Lebens das Rauchen verboten.
Meine Mutter ist eine x-beliebige Frau und hat im Gegensatz zu Helmut Schmidt nicht die geringste Bedeutung in der deutschen Geschichte. Und trotzdem glaube ich, dass man von ihr etwas lernen kann. Es hat mit der Art zu tun, wie sie unserer heutigen Welt begegnet. Wie sie sich mit ihrem ganzen Wesen querstellt, gegen so vieles, was unsere Zeit ausmacht. Von diesem Querstellen handelt dieses Buch. Und damit natürlich vom Altern, vom näher rückenden Tod. Der uns ja dummerweise alle betrifft.
Die erste Lektion, die Sie für sich mitnehmen können, lautet also: Essen Sie viel Tatar und Eis, wenn Sie auf die hundert zugehen wollen. Und versüßen Sie Ihrer Familie das Ganze, indem Sie Ihre Hörgeräte verwenden – auch auf die Gefahr hin, sie beim Tragen zu verlieren.
Denn so ist es nun mal mit dem Leben: Man verliert es, indem man es lebt.
Nachträgliches Vorwort des Sohns
Dieses Buch handelt also von meiner Mutter: Ida Kämpfer, geborene Feurig. Genauer gesagt: Es handelt von ihr und den Fragen, die das Altwerden aufwirft, von einer 91-jährigen alten Dame und dem, wofür sie steht – gewissermaßen von der Mutter aller Fragen: wie wir mit der Vergänglichkeit umgehen. Es geht es also um Ida Kämpfer und ihren Überlebenskampf – ihren Willen, nicht unterzugehen, ihre Lebensklugheit und ihren Witz, ihre Bosheit auch und diese unerschütterliche Energie, mit der sie sich gegen alles, was ihr von Anfang an in ihrem Leben widerfahren ist, zur Wehr gesetzt hat, auch gegen den Schmerz und die Enttäuschungen, die das Leben mit sich gebracht hat.
Eine dieser Enttäuschungen in ihrem Leben bin natürlich – ich: Nikolaus Kämpfer. Vermutlich bin ich nicht die größte Enttäuschung in ihrem Leben, aber zumindest die, nun, gegenwärtigste. Wobei ich, wie Sie mitbekommen haben, eben nicht so gegenwärtig bin, wie sie es sich wünschen würde. Weil ich von Beruf Dolmetscher bin (für Französisch), bin ich oft im Ausland auf internationalen Kongressen. Es ist nicht so, dass meine Mutter das nicht akzeptiert, dass sie nicht heilfroh wäre, dass es mich gibt. Sie braucht mich und ist manchmal sogar ein wenig stolz auf das, was ich beruflich mache (»der kann richtig parlieren, wie so ein hochnäsiger Franzos«). Aber im Wesentlichen überwiegt die Enttäuschung – zum Beispiel darüber, dass ich aus der katholischen Kirche ausgetreten bin, dass ich ihr keine Enkel geschenkt habe, dass ich mich nicht rund um die Uhr um sie kümmere. (»Der Quatsch, den die Politiker reden. Da red lieber mit mir!«) Sie verstehen: ihr Sohn als Privatsekretär – das hätte sie gerne.
Ich – bitte entschuldigen Sie meine Offenheit – würde dabei wahnsinnig werden. Und um das geht es in diesem Buch auch: wie ich versuche, mit dem dauernd drohenden Wahnsinn klarzukommen, den die Situation erzeugt. Was ich auch tue, ich kann meine Mutter nicht zufriedenstellen. Daran würde meine Daueranwesenheit nichts ändern. Auch als Privatsekretär wäre ich eine permanente Enttäuschung für sie.
Dieses Buch handelt daher, ja, auch von meinem Überlebenskampf. Und das ist nichts Außergewöhnliches, nein, sondern etwas, das jeder Sohn und jede Tochter kennt, deren Mutter oder Vater alt werden. Wenn ich ausgelaugt von einem meiner Besuche in München zurückkehre und jemandem von den zurückliegenden Abenteuern erzähle, erlebe ich oft ein wissendes Nicken, gepaart mit einem zitronensauren Lächeln. Die allermeisten erleben ähnliche Situationen mit ihren Eltern oder sehen bei Freunden oder Verwandten die Pflegeproblematik am Horizont aufziehen. Ich höre unentwegt solche Geschichten – von Eltern, die im Moment noch recht fit sind und daher eine Patientenverfügung für überflüssig erachten. Die die Wochentage zu verwechseln beginnen, aber nicht im Traum eine vorbeugende Alzheimersprechstunde aufsuchen würden. Die keinen Lebenspartner haben, aber den Gedanken an einen Umzug ins Heim weit von sich weisen.
Wir sind nicht nur eine Gesellschaft, die immer älter wird, wir fühlen uns dabei auch immer länger jung. Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich an, und auch wenn dabei nach und nach einzelne Körperfunktionen ausfallen, denkt der Mensch als Gesamtorganismus noch lange nicht daran, den Geist aufzugeben. Und wenn es der Geist selbst ist, der nachlässt, läuft die Körpermaschine oft jahrelang auf Autopilot weiter, dank guter Ernährung und medizinischer Technik. 2023 waren etwa 4,9 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig – im Jahr 2030 werden es knapp 6 Millionen sein. Schon heute pflegen oder unterstützen 13 % der Erwerbstätigen zwischen 40 und 60 eine pflegebedürftige Person – wobei 70 % der Hauptpflegenden Frauen sind. Insgesamt kümmern sich 4,8 Millionen Deutsche um Angehörige, die Pflege benötigen.
Die Sache mit meiner Mutter hat also eine gesellschaftliche und darüber hinaus: eine ethische und philosophische Dimension. Was bedeutet es für uns, immer älter zu werden? Warum tun wir alles, um den Zeitpunkt des Sterbens um jeden Preis hinauszuschieben? Gibt es das heute noch: ein Altern in Würde – einen würdigen Tod? Und umgekehrt, mit Blick auf die Last, die wir als Kinder tragen: Wie halten wir die Zumutung aus, die die Alten für uns darstellen? Haben wir eine moralische Verpflichtung, uns um die Elternpflege zu kümmern? Wie steht es um Sterbehilfe, ab welchem Punkt sollte sie erlaubt sein?
Man kommt unweigerlich zu diesen konkreten, zugespitzten Fragen, wenn man sich mit dem Alter beschäftigt. All diese Fragen betreffen nicht nur die Eltern, sondern vor allem uns selbst – mich genauso wie Sie. Denn wir sind ja die Alten von morgen. Müssen wir nicht selbst in den Spiegel schauen und uns um die letzten Dinge kümmern, um nicht den eigenen Kindern oder der Allgemeinheit unzumutbar auf den Keks zu gehen?
Meine Mutter, gebürtige Feurig, ist 1930 geboren, als mittlere der drei Feurig-Schwestern, und auch das wirft in diesem Zusammenhang ein besonderes Schlaglicht auf all diese Fragen, weil sie fast ein ganzes Jahrhundert überschaut, mit drei (oder richtiger: vier) deutschen Staaten, in denen sie gelebt hat. Es ist nicht nur die Zeit des Nationalsozialismus, die sie maßgeblich geprägt hat, hinzu kommt, dass sie aus dem »Sudetenland« stammt, jenen Regionen des tschechoslowakischen Staatsgebiets, die von Deutschen bewohnt waren, die sich von Dialekt und Folklore her den Franken und Sachsen nah fühlten. Beim »Münchner Abkommen« 1938 lenkte Chamberlain als Verhandlungsführer der Alliierten gegenüber Hitlers Aggressionskurs ein und gestand, um die Kriegsdrohung abzuwenden, diesem die Eingliederung der »Sudetendeutschen« ins »Dritte Reich« zu. Die Familie meiner Mutter stand bei der Einzugsparade winkend am Marktplatz von Kraslice (damals: Graslitz), und die ältere Schwester meiner Mutter, so die Familienlegende, ist dabei sogar von Hitler am Kopf getätschelt worden. Nach dem Krieg wurde die Familie wie alle Sudetendeutschen aus ihrem Zuhause vertrieben und mit einer »Flüchtlingskiste« in ein bayerisches Dorf umgesiedelt, wo sie von heimischen Bauern angefeindet wurde. Die Kiste steht noch heute im Reihenhaus-Keller.
Mit der Geschichte meiner Mutter prallt also ein halb vergessener Teil deutscher Geschichte auf die Gegenwart unserer Einwanderungsgesellschaft und das Schicksal Hunderttausender, die selbst aus Kriegs- und Krisengebieten vertrieben oder geflohen sind. Meine Mutter hat zu beidem etwas zu sagen. Es ist nicht immer einfach auszuhalten, was sie äußert, aber es hilft, die Risse und Spaltungen zu verstehen, die sich in unserer Gesellschaft auftun, die alles schön eindeutig und politisch korrekt wahrnehmen möchte. Das alles, das ganze Themenfeld der Zuwanderung, ist zugleich unmittelbar mit der demografischen Situation verknüpft, dem fundamentalen Riss zwischen Alt und Jung, der durch unsere Gesellschaft geht. Wer soll all die Alten pflegen und zu welchen Preisen, wenn die wenigen Nachgeborenen es nicht tun können (oder wollen)? Wie ist es, wenn nur noch zugewanderte Menschen bereit sind, diese schwierige Arbeit zu leisten?
In den letzten Jahren bin ich mit den ganz praktischen Fragen dieser Thematik konfrontiert worden, mit der Suche nach Pflegediensten oder Heimplätzen. Auch davon handelt dieses Buch ganz automatisch. Sie können es daher in vielerlei Hinsicht auch als Ratgeber lesen, da ich im Laufe der Zeit viele Erfahrungen gesammelt habe, die sich weitergeben lassen.
Das betrifft auch das große, geradezu metaphysische Thema unserer Zeit: Demenz. Diesen Gegenwartsfluch, der wie ein Gespenst in den westlichen Wohlstandsgesellschaften umgeht, habe ich in den vergangenen Jahren in all seinen vielschichtigen, meist niederschmetternden, dann wieder liebenswürdigen und philosophischen Facetten kennengelernt. Neben meiner Mutter und ihrer älteren Schwester (jener, die von Hitler getätschelt wurde) ist da auch noch die jüngste der drei Schwestern, die ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren wurde (sie liegt mir am meisten am Herzen). Ich kann nicht von meiner Mutter erzählen, ohne von ihr zu erzählen. Über sie und ihr Schicksal zu berichten, ist mir auch deshalb ein so großes Anliegen, weil der Anblick der Versinkenden, zu denen meine Tante gehört, und die Erinnerung an ihr leichtes glückliches Leben die Frage aufwerfen, was vom Guten bleibt, das Menschen tun, und wie wir dem Leben Sinn verleihen, wo doch scheinbar alles in Vergessenheit gerät.
Vielleicht sind diese Fragen auch der Grund, warum ich so oft gesagt bekommen habe: Du musst ein Buch über deine Mutter schreiben. Wann immer ich nach meiner Rückkehr ausgelaugt von den jüngsten Erlebnissen mit ihr berichte, lächeln die Leute kopfschüttelnd, als spräche ich von einer guten Bekannten: Deine Mutter! Tatsächlich sind die Berichte für Außenstehende nicht nur meist komisch, sondern wirken wie Episoden jener Weltkomödie des menschlichen Lebens, bei der es natürlich um die ersten und letzten Dinge geht, sprich: um Leben und Tod, oder vielleicht richtiger: um Leben und Lachen, Liebe und Tod.
Deshalb ist dieser Roman auch ein Buch über die Liebe – über die ursprünglichste, unbedingteste Form der Liebe, die es gibt. Wie jeder starken Liebe wohnt der Mutterliebe das Potenzial zu größtem Glück und größtem Schmerz inne, zu Schöpfung und Zerstörung. Die Liebe, die Kinder für ihre Eltern empfinden, verleiht Letzteren schließlich enorme Macht. Ich will nicht von Übermacht sprechen, eher von »Überliebe«. Auch das ist ein Grund, warum sie hier zwei Mütter kennenlernen werden: eine wahrhaft liebende und eine »zu sehr liebende«. Ich bin mit beiden aufgewachsen, bin von beiden geprägt: der, die mir meine Fähigkeiten geschenkt hat, und der, die mich mit aller Macht an sich zu binden versucht, egal, ob ich dabei ein glücklicher Mensch werde. So ist alles doppeldeutig und paradox, wie in dem jüdischen Witz. Liebe und Kampf gehen beim Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter Hand in Hand. Ich versuche noch immer, zu mir zu finden und dabei ein gerechter, liebender Sohn zu sein – um die Frau, die mir mein Leben geschenkt hat, mit allem, was ich zu geben habe, verantwortungsvoll bis zu ihrem Tod zu begleiten.
»Der Mensch mit seiner einzigartigen Fähigkeit,
aus den Fehlern anderer zu lernen,
ist ebenso einzigartig in seiner festen Weigerung,
genau dies zu tun.«
(Douglas Adams)
ZweiDer Weihnachtswunsch
1
Beginnen wir gut drei Jahre früher, an Weihnachten 2017. Im Nachhinein erscheinen die damaligen Feiertage wie der Schlüssel zu allen Ereignissen, von denen ich erzählen möchte. Wie immer reise ich zu Heiligabend nach München, um im Reihenhaus meiner Mutter die Feiertage zu verbringen. Ich habe noch nie ein Weihnachtsfest woanders verbracht, obwohl ich am 24.Dezember gerne einmal, wie viele meiner Freunde, zu einem Dinner in Berlin geblieben wäre, mit anschließendem Feierngehen. Aber die Krankheit meines Vaters und die Verwitwung meiner Mutter haben das schon immer undenkbar gemacht, erst recht, seit sie selbst Unterstützung braucht.
Diesmal habe ich mich sogar noch früher auf den Weg gemacht, da neben den üblichen Ritualen (Weihnachtseinkäufen, Christbaumschmücken etc.) noch ein besonderer – geradezu historischer – Termin ansteht. Seit Tagen liegt eine Anspannung in der Luft, die auch in den vorausgegangenen Telefonaten mit meiner Mutter zu spüren war.
»Nein, ich hol dich ab!«, verfügte sie mit Nachdruck, »wir haben viel vor!«
»Aber du brauchst nicht zur S-Bahn kommen«, versuchte ich zu insistieren. »Ich nehm von da den Bus.«
»Das dauert viel zu lang. Mit dem Auto sind wir schneller.«
»Wäre es nicht besser, wenn du nicht Auto fährst?«
»Ja! Das würdest du mir auch gern verbieten!«
Wir streiten uns schon länger über Vernunft und Unvernunft des Autofahrens. Ich – und mit mir vermutlich die gesamte deutsche Auto-Motor-Welt – bin überzeugt, dass meine Mutter nicht mehr hinters Steuer gehört. Ihren alten Honda Jazz hat sie vor ein paar Jahren kurz nach Einbruch der Nacht so gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug gesetzt, dass ihr Wagen einen Totalschaden erlitt. Was nicht halb so schlimm ist wie die Tatsache, dass sie mir danach nicht erklären konnte, wie das Ganze passiert ist: Sie hat das andere Auto überhaupt nicht gesehen. Trotzdem habe ich ihr damals (das ist die Unvernunft, die ich mir selbst anlaste) wieder ein Auto gekauft, eine tiptop erhaltene A-Klasse, dreizehn Jahre alt, keine 40.000 km auf dem Tacho – ein wunderbares Rentnerfahrzeug. Der Wagen war so gut erhalten, dass ich unsere Reihenhaus-Garage auf beiden Seiten mit Styropor ausgekleidet habe. Wie sich jetzt zeigt: ohne Erfolg.
Denn da kommt sie auch schon um die Ecke gebogen. Was für ein Anblick: Der wunderschöne Silberling ist mittlerweile völlig verschrammt, sieht aus wie ein Autocross-Bolide. Ich stehe in der Haltebucht vor dem S-Bahnhof Feldmoching und verfolge mit aufeinandergebissenen Zähnen, wie sie im Zeitlupentempo durch das Nadelöhr der Zufahrtsstraße auf mich zurollt und die parkenden Autos nur um Zentimeter verfehlt. Hinter dem Lenkrad ist sie kaum zu sehen, doch dann hebt sich ihre Hand, und ihr luchsgleicher Blick bugsiert den Wagen in die Haltebucht.
»Geh, kauf da drüben einen Kuchen«, ruft sie mir gut gelaunt zu, als ich den Koffer auf den Rücksitz werfe, »ich setz mich in der Zwischenzeit rüber. Als Erstes müssen wir zum Friedhof.«
Das Eiscafé »Il Sole Mio«, mit der italienischen Flagge auf der Leuchtschrifttafel, wird von einer kroatischen Familie betrieben, die die Kunden immer mit »Dober dan, prego« begrüßt. In der Wintersaison bietet es statt Eisbechern ein klassisches Kaffeekränzchen-Kuchensortiment an. Als ich eintrete, stehen gerade eine junge schwarze Frau und ein junger asiatisch aussehender Mann an der Theke und bestellen in münchnerischem Singsang Sacher- und Schwarzwälder Kirschtorte. Was für ein Wandel, den Feldmoching seit meiner Schulzeit durchlaufen hat. Früher lag der Bahnhof wie ein einsamer Wildwestposten zwischen endlosen Feldern da, jetzt flankiert eine vierstöckige Retortensiedlung den Verkehrsknotenpunkt, zu dem die Station mitsamt unterirdischem U-Bahn-Terminal geworden ist. Das einstige Dorf, in dessen Volksschule ich mit krachbayrischen Bauernkindern gegangen bin, ist ein postmigrantischer Melting Pot geworden. Mich fasziniert diese Entwicklung – vor allem, wenn ich mir klarmache, dass meine Eltern in den Fünfzigerjahren selbst als Zugewanderte hierhergezogen sind. Ja, auch sie waren Migranten: meine Mutter als Sudetendeutsche, mein Vater als Brandenburger. Was sich heute wahrscheinlich niemand vorstellen kann: Meine Eltern waren einst größere Exoten als jeder syrische Flüchtling heute. Vor allem mein Vater: ein Romantikforscher aus Preußen – also ein Saupreiß und Intellektueller in einem.
Das nur als kleiner Hintergrund zum Schauplatz, an dem diese Geschichte spielt. Stellen Sie sich nun meine 87-jährige Mutter vor, die mit Luchsaugen auf dem Beifahrersitz (immerhin!) sitzt, das Kuchenpapier aufreißt und die Sahne mit dem Finger von der Schwarzwälder Kirschtorte leckt.
»Daoud des gaoud!«, stößt sie in ihrem sudetendeutschen Dialekt aus, den sie in Situationen höchster Emotionalität spricht. Also: Tut das gut! – »Ich ho scho seit Eywichkeiten kaan Kaouchen mehr ghott!«
So steuern wir – ich am Fahrersitz – auf Feldmoching Downtown zu, mit dem Spitzkirchturm als Ground Zero. Auf dem Weg passieren wir das Elternhaus des berühmten Volksschauspielers Walter Sedlmayr, bekannt nicht nur aus legendären Fernsehrollen in »Monaco Franze« und »Polizeiinspektion 1«, sondern vor allem aufgrund seiner ebenso grauenhaften wie ominösen Ermordung. Im Juni 1990 wurde er in seiner Wohnung mit einem Hammer erschlagen, wobei die Täter am Tatort die Szenerie eines sadomasochistischen Sexspiels nachstellten. Nur ein Jahr später starb, ebenfalls mit 63 Jahren, mein Vater auf ganz andere qualvolle Weise: nach jahrelanger, schwerer Pflegebedürftigkeit. Sein Grab will meine Mutter nun unbedingt für Weihnachten richten – ein gepflegtes Grab ist für sie die Visitenkarte eines anständigen Lebens.
Doch diesmal ist da noch etwas anderes, das sie umtreibt.
»Du musst gleich das Annerl anrufen, wenn du mich nach Hause gebracht hast«, sagt sie, als sie mit ihren beiden Gehstöcken zum Grab humpelt, »es wird immer schlimmer mit ihr. Sie weiß nicht mehr, welcher Wochentag ist. Verliert immer mehr an Gewicht.«
Das Annerl ist: meine Tante Anna, ihre jüngere Schwester. Ich hatte sie ja im ersten Kapitel erwähnt. Sie ist neun Jahre nach meiner Mutter geboren – und gehört zu unserer Familie wie das Amen in der Feldmochinger Kirche. Es gibt ein Foto, das sie in ebendieser Kirche als junge blonde Frau zeigt. Sie sieht wie 16 aus, muss aber schon Mitte 20 sein. Wie ein Barockengel steht sie zwischen meinen schwarzhaarigen Eltern vor dem Altar und hält ein rüschenbesetztes Päckchen im Arm. Das bin ich als Baby – nach meiner Taufe. Das Annerl ist meine Patentante, sie hat mit uns im Feldmochinger Mietshaus gewohnt, hat mich mit ihrem orangen Käfer oft in die Schule gefahren. Vor allem aber hat sie meiner Mutter beim Umzug in die neue Reihenhaussiedlung in der Fasanerie geholfen und meinen Vater daraufhin dort mitgepflegt. Für mich ist sie wie eine zweite Mutter.
»Ich hab ihr heute Morgen am Telefon gesagt, dass du sie um zwei abholst und wir zusammen aufs Amt fahren«, sagt meine Mutter, als wir am Grab stehen. »Und morgen holt ihr dann den Fisch. Da hat sie gefragt: Den Fisch? Warum?«
Ihr halbes Leben hat sie den Heiligabend mit uns gefeiert. Immer war sie für Fisch und Fischsuppe zuständig. Jetzt weiß sie nicht mehr, dass Weihnachten ist. Deswegen müssen wir mit ihr heute aufs Amt.
Ich stelle die Blumen aufs Grab, die meine Mutter mitgebracht hat, klaube Blätter und Äste auf und zünde das »Ewige Licht« an. Das ist also der Grund, warum meine Mutter vor diesen Feiertagen so aufgeregt ist: der Zustand meiner Tante. Es hat Anfang des Jahres begonnen, dass sie sich auf einmal in Wortschleifen verhedderte, Fragen zu wiederholen begann oder den Termin für ihr klassisches Konzert vergaß.
»Du musst dich um sie kümmern«, sagt meine Mutter. »Sie hat niemanden. Du bist der Einzige.«
Meine Mutter macht das Kreuzzeichen über den Blumen. Ich blicke auf die Inschrift auf dem Grabstein, deren Gold im Schein des »Ewigen Lichts« glänzt: Dr. Wolfram Kämpfer. 1927–1991.
Hier, in diesem Grab, werden auch meine Mutter und meine Tante beerdigt werden. Die Frage ist auf einmal: Wer von beiden zuerst? Seit Tante Anna krank geworden ist, mache ich mir um sie weitaus größere Sorgen als um meine Mutter.
»Mein Gott, wenn das der Feurig-Papa wüsst«, seufzt meine Mutter, als wir wieder im Auto sitzen. »Dass sein Annerl so abbaut. Sie war doch die Nachzüglerin, sein Ein und Alles. Ob das vom Krieg kommt? Ob sie die Vertreibung nicht vertragen hat? Wir anderen sind doch gar nicht so sensibel – der Feurig-Papa am allerwenigsten. Der war ja ein Sauhund. Wenn der am Morgen in die Arbeit gefahren ist, hat er im Bus absichtlich ein paar fahren lassen – das waren die Bierfürze vom Abend. Dann hat er einen der Buben neben sich angeschnauzt, weil es so gestunken hat. Du Saubaou!, hat er geschrien. Und ihn bei der nächsten Station lachend rausgeschmissen.«
Ich muss schmunzeln. Von solchen Anekdoten hat sie eine Menge auf Lager.
»Solche Schweinereien hat er bei der Burschenschaft gelernt«, raunt sie, »genau wie die Sauferei. Das war ja noch vor dem Ersten Weltkrieg – als er in Prag studiert hat. Er war der Jüngste und der Einzige von sechs Kindern, der studieren durfte. Im Grunde ein armer Hund. Die Vorfahren, die Feurig-Ahnen, waren ja Schmiede und müssen irgendwann ins Sudetenland ausgewandert sein, weil dort Bergbau war. Für die Wagen, die Pferde und die Fässer, da hat es Schmiede gebraucht. Der Feurig-Schmied, das war ein stehender Begriff in Graslitz. Aber dass da eins von den Schmied-Kindern studieren könnte – daran war finanziell gar nicht zu denken! Also muss der Apotheker das Studiergeld bezahlt haben. Der Apotheker hat keine Kinder gehabt, und weil der Papa ein begabtes Bürscherl war, hat der ihm das Studium ermöglicht. Prag gehörte wie das Sudetenland zu Österreich-Ungarn, da gab es zwei Universitäten, die deutsche und die tschechische. Er war natürlich auf der deutschen, der ältesten Universität überhaupt. Dort ist er in eine Burschenschaft gekommen, in der er das Saufen gelernt hat – und die schlechten Manieren.« Sie schüttelt den Kopf und sieht mich an: »Trotzdem schade, dass du nicht in eine Burschenschaft gegangen bist. Die Burschenschaftler halten zusammen. Ein Leben lang.«
Jetzt bin ich es, der den Kopf schüttelt. Wenn meine Mutter von ihrer Jugend zu reden beginnt, redet sie ohne Punkt und Komma. Sie erzählt von ihrem Heimatort im Sudetenland, von ihren Eltern, dem Feurig-Papa und der Feurig-Mama, oder von der Zeit nach der Vertreibung.
Ehe ich etwas erwidern kann, kommen wir vorm Reihenhaus an. Es liegt am Rand eines Gewerbegebiets, das fast schon zum Speckgürtel Münchens gehört. Ich halte im Halteverbot und will ihr beim Aussteigen helfen.
»Geh weg, ich muss das allein können. Ruf das Annerl an, dass du sie abholst. Die weiß das sicher nicht mehr. Ich hole die Formulare.«
Ich schaue meiner Mutter nach, wie sie mit ihren Krücken ins Innere stakst, wie ein großes, ungelenkes Insekt. Seit ihrer Knieoperation kann sie sich ohne Gehhilfen nicht mehr bewegen. Zwar hat sie auch einen Rollator, einen teuren, leichten. Aber gegen den verwahrt sie sich mit Händen und Füßen. Auch das wieder so ein Querstellen von ihr: »Ich bin doch kein altes Weib«, zetert sie. »Ich nehm die Stöck.«
Ich wähle am Handy die Nummer vom Annerl.
»Ja bitte, Feurig«, meldet sie sich mit ihrer singenden Stimme, »wer ist denn da?« Sie ist die einzige der drei Schwestern, die nicht geheiratet hat.
»Ich bins. Dein Neffe. Nikolaus.«
»Ja, aber hallo lieber Neffe. Was verschafft mir die Freude? Kommst du nach München?«
»Ich bin sogar schon da, liebe Tante. Und hole dich gleich ab. Das hat dir die Mutter doch gesagt?«
»Die Mutter? Die Ida? Achso, natürlich, gesagt hat sies. Und warum bist du in München?«
»Vor allem wegen – morgen. Du weißt, was morgen ist, oder?«
Den Gang aufs Amt erwähne ich erst Mal nicht.
»Morgen? Ja, natürlich, da ist morgen.«
»Genau, das heißt: Weihnachten. Da komme ich dich auch abholen. Dann kaufen wir zusammen den Fisch und feiern Heiligabend. So wie wir es immer gemacht haben.«
»Das weiß ich schon, dass wir das immer gemacht haben.«
»Und weil ich ohnehin in München bin, haben wir heute noch den anderen Termin hingelegt. Wir gehen doch zusammen aufs Amt, mit der Mutter.«
Ich sage es, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Dabei habe ich Angst, dass sie sich doch noch weigern könnte.
»Ach ja, das Amt. Hoffentlich schimpft sie da nicht, die Ida.«
»Warum soll sie schimpfen?«, staune ich. »Sie will doch, dass wir da hinfahren.«
»Nein, dass du mich abholst«, lacht sie. »Und wann kommst du morgen?«
»Nicht morgen, jetzt. Morgen ist der Fisch dran. Heute gehts aufs Amt.«
»Was, jetzt? Mein Gott, da muss ich mich ja anziehen. Und wo ist das?«
»Am Stachus. Praktisch da, wo du immer den Fisch gekauft hast.«
»Achso, am Stachus. Aber da brauchst du doch nicht mitgehen. Den Fisch hab ich ja immer allein gekauft.«
»Zieh dir jetzt den Mantel an und komm runter. Sonst schimpft die Mutter doch noch.«
Es ist schmerzhaft, ihre Verwirrtheit zu erleben. Meine Patentante Anna, liebevoll »das Annerl« genannt, war immer eine hochpatente Frau, nicht nur im Privaten, auch im Beruf. Bis zu ihrer Pensionierung stand sie in einer großen Münchner Zeitung ihre Frau, hielt ihrem Chef den Rücken frei. In gewisser Weise liegt es in ihrem Wesen, sich um die Belange anderer zu kümmern. So war sie auch in der Familie immer der gute dienstbare Geist – typisch ihre Angst vor meiner Mutter, die immer die Tonangebende war. Nachdem das Annerl anfänglich bei uns im Mietshaus »mitlief«, passte es ins Bild, dass sie sich nach dem Umzug ins Reihenhaus eine Wohnung ganz in der Nähe nahm, im Arbeiterstadtteil Harthof. Man kann es als Anhänglichkeit des Annerl betrachten, als Solidarität mit der größeren Schwester, aber ich hatte immer den Verdacht, dass hinter dem Ganzen ein Schachzug meiner Mutter steckte, das geschickt eingefädelte Arrangement, das alleinstehende Annerl weiterhin als gute helfende Seele in der Nähe zu haben – nicht nur in Bezug auf meinen kranken Vater. Doch nun, wer hätte damit gerechnet, ist auf einmal sie die Hilfsbedürftige. Das ist der Grund, warum uns heute eine viel bedeutendere Aufgabe bevorsteht, als den jährlichen Weihnachtsfisch zu kaufen. Wir wollen aufs Amt, auf die sogenannte »Betreuungsstelle«. Es geht darum, eine Vollmacht von meiner Tante zu erhalten. Und nicht nur das: auch eine Vollmacht von meiner Mutter. Es ist ein wahrlich historischer Tag: Seit Jahren habe ich darum gerungen.
Ich biege in die Straße ein, in der das Annerl wohnt, und womit ich nicht gerechnet habe: Da steht sie an der Straßenecke, zierlich und adrett wie immer, im blauen Lodenmantel, mit dem blond gefärbten Lockenkopf. Sie lacht auf, als ich mit der zerbeulten Silberkugel vor ihr halte.
»Ja, dass du auf einmal kommst«, sagt sie kopfschüttelnd beim Einsteigen. »Das ist ja eine Freude.«
Anders als meine Mutter, die in mindestens zweihundert Gelenken an Arthrose leidet, ist sie bestens zu Fuß. Sie war immer eine begeisterte Bergwanderin – im Nu klettert sie ins Auto und schaut mich neugierig an:
»Wie gehts dir denn? Was machst du hier?«
»Na, ich bin wegen Weihnachten hier. Aber jetzt fahren wir aufs Amt.«
Sie ist noch schmaler, als ich es in Erinnerung habe. Und ihre Erinnerungsaussetzer haben seit dem letzten Mal zugenommen. Aber das Gefühl, das ihr Anblick in mir weckt, ist sofort von der alten kindlichen Zuneigung geprägt.
»Weihnachten?« Sie macht ein entsetztes Gesicht. »Ja, um Gotteswillen!«
»Warum um Gotteswillen? Das ist doch schön!«
»Ja, freilich ist das schön. Aber – da muss ich ja –«, sie schaut mich ganz bleich an. »Da muss ich ja einen Fisch kaufen!«
2
Ihre Demenzerkrankung ist für uns alle ein Schock – weil sie erst 78 ist und körperlich vollkommen gesund. In ihr schönes Rentnerinnenleben mit Wanderurlauben und Kulturreisen hat sich die Krankheit wie ein Parasit eingenistet. Anfangs war er nur wie ein Mäuslein, das in ihrem Haushalt Unterschlupf gefunden hat und ihr kleine Streiche zu spielen begann – die kleinen Vergesslichkeiten, skurrilen Eigenheiten, die dem Außenstehenden als Launen eines älteren Menschen erschienen. Warum sie Großpackungen von Puddingpulver im Vorratsschrank horte? Und die drei Stangen Zigaretten im Kühlschrank? Bald begann das Nagetier in ihrem Leben größer zu werden und seltsame Kapriolen zu veranstalten, etwa indem es das Annerl zum Konzert in die Stadt fahren ließ, obwohl das Konzert erst eine Woche später stattfand. Oder indem es ihr in der U-Bahn nicht mehr verriet, an welcher Haltestelle sie aussteigen musste – was freilich nur dadurch ans Tageslicht kam, dass ihr Konzert- und Essensbegleiter allein in der Innenstadt dastand. (Von ihm, von Roland, gleich noch mehr.) Mittlerweile ist der Nager in ihrem Kopf ein ausgewachsenes Tier, hat sich tiefer in ihr Gehirn hineingefressen, knabbert an Zellen und Synapsen, frisst sich durch alles, was in ihrem Geist verschaltet ist, wie ein Marder, der sein Quartier im Motorraum eines Autos aufgeschlagen hat und genüsslich die Kabel zerbeißt, die der Wagen zum Starten benötigt. Längst haben die Ausfallerscheinungen in ihrem Leben so fatale Formen angenommen, dass die Außenwelt auf das Annerl regelmäßig einredet – wegen des unübersehbaren Gewichtsverlusts, ihrer Vergesslichkeit und Verwirrung. Meinst du nicht … Solltest du nicht mal … Du musst unbedingt … Aber davon will das Annerl nichts hören.
Kein Wunder: Das Annerl weiß von diesen Dingen gar nichts. Auch das erinnert mich an meinen Vater, der die Konsultation jedweder Ärzte mit cholerischen Schreiattacken von sich wies. Genau das macht diese Erkrankungen so niederträchtig: dass die Betroffenen von ihr nichts mitbekommen. Für die Angehörigen ist es aber nicht nur die Uneinsichtigkeit, mit der sie zu kämpfen haben, nein, es ist auch der Schrecken, den diese Krankheit einflößt. Wovor könnte man größere Angst haben als vor einer Krankheit, die man nicht als Krankheit erkennt? Die strukturelle Unfähigkeit zur Einsicht in den eigenen Zustand ist nicht nur ein existenzielles Paradox, sondern entmenschlicht den Kranken vom Fleck weg, sie beraubt ihn der grundlegendsten Wesensart des Menschseins, des Selbst-Bewusst-Seins. Wie fürchterlich die Vorstellung, selbst in diesen Zustand der Selbstvergessenheit zu geraten. Wie soll man wissen, wann man selbst darunter leidet?
Es gibt nur eine gute Seite an der Krankheit des Annerl – so zumindest rede ich mir das Ganze schön –: dass auch meine Mutter sich mit lang verdrängten Altersthemen zu beschäftigen begonnen hat. Jahrelang habe ich auf sie eingeredet, dass wir zu Vorsorgegesprächen gehen oder gewisse Dinge mit dem Haus regeln müssen. Immer hat sie es von sich gewiesen. Später mal! Doch jetzt noch nicht! Und dann begann sie mich auf einmal zu drängen, dass wir mit meiner Tante im »Seniorenzentrum Harthof« die Alzheimersprechstunde aufsuchen müssten. Und was ich ihr schon seit Jahren predige: Eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung auszufüllen, erscheint ihr nun ein absolutes Muss. Zumindest für ihre Schwester Anna.
Das ist es also, was dieses Weihnachtsfest so außergewöhnlich macht. Heute, einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember 2017, haben wir um 15 Uhr nachmittags einen Termin auf dem Münchner Amt, das Vorsorgevollmachten mit einer offiziellen Beglaubigung versieht. Daher seit Tagen die Aufregung: weil sich nicht nur das Annerl, sondern auch meine Mutter auf den Weg in die sogenannte »Betreuungsstelle« machen will.
Wir holen meine Mutter ab, die mit ihren Krücken und den vorausgefüllten Formularen vor dem Haus wartet. Sie öffnet die Autotür, blickt ins Innere und sagt zum Annerl:
»Schlecht schaust du aus. Isst du was?«
»Was ist?«, erwidert das Annerl überrumpelt.
»Ob du auch gescheit isst. Du bist ja nur Haut und Knochen.«
»Sag einmal, ich schmeiß dir die Tür an den K–«
»Ach, nimm das nicht ernst«, wiegle ich ab, »sie meint es nur gut. Du weißt ja selbst, dass du ein bisschen abgenommen hast.«
»Ich muss ehrlich sagen, ihr seids ekelhaft zu mir. Ich bin doch erwachsen.«
»Natürlich bist du erwachsen«, sage ich besänftigend, »aber gerade deshalb darfst du ein bisschen mehr auf dein Gewicht achten. In der letzten Zeit glaubt man fast, du wolltest Model werden.«
Meine Tante ist über meine Worte überhaupt nicht amused.
»Ja, sag einmal, bin ich deppert? Ich koch mir doch was. Jetzt fängt der Nikolaus auch noch an.«
Ich fädle resigniert in den Verkehr ein und meine Mutter fährt fort:
»Ach, Annerl, wir sagen dem Nikolaus nicht, dass du nicht weißt, wann du Geburtstag hast.«
»Was weiß ich nicht?«
»Wann du geboren bist.«
»Im Februar!«
»Am wievielten?«, bohrt meine Mutter.
»Jetzt hör doch auf. Ich bin ein erwachsener Mensch.«
»Der nicht weiß, wann er Geburtstag hat.«
»Am 12. Januar! Oder so. Der 12. ist es auf jeden Fall.«
»Wenn der Mann auf dem Amt danach fragt, musst du es wissen.«
»Muss ich gar nicht! Ich bin so enttäuscht. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt! Wo fahren wir überhaupt hin?«
»Wir fahren, wie wir es besprochen haben, in die Betreuungsstelle«, versuche ich Ruhe in das Gespräch zu bringen. »Damit wir das mit der Vollmacht erledigen. Du warst ja dabei, in dem Seniorenzentrum, wo sie uns gesagt haben, dass man für später eine Vollmacht braucht. Die haben wir mit dir bereits ausgefüllt.«
»Von wem brauche ich eine Vollmacht?«, sagt meine Tante. »Ich kann doch alles.«
»Natürlich kannst du alles«, beschwichtige ich. »Aber irgendwann – in der Zukunft – kann es ja mal sein, dass du Hilfe brauchst. Auch die Mutter stellt mir solch eine Vollmacht aus«, sage ich so beiläufig wie möglich. »Selbst als Sohn kann ich sonst nichts für sie machen.«
»Solche Sachen erzählt er mir ständig«, schüttelt meine Mutter den Kopf. »Da ist er ganz besessen davon. Von mir kriegst du aber nur, was wir angekreuzt haben. Aus dem Haus schmeißen – lass ich mich nicht. Das ist mein Haus, das hab ich mir mit dem Vater bitter abgespart. Das würdst du mir glatt unter dem Arsch wegziehen! Bei dem muss man aufpassen, Annerl.«
Ich glaube, ich höre nicht richtig. Wir fahren schon die Leopoldstraße hinunter, und von einem Moment auf den anderen verschwistert sie sich mit dem Annerl gegen mich. Was zum Teufel –
Seit Ewigkeiten versuche ich meine Mutter davon zu überzeugen, dass sie mir eine Vorsorgevollmacht ausstellt. In guten Momenten sind wir sogar das Formular durchgegangen – von der Frage, ob ich ihre Telefonrechnungen bezahlen darf, über den Punkt, wo es um die Einwilligung in ärztliche Eingriffe geht, bis hin zur Vermögenssorge. Spätestens wenn wir an die Stelle stießen, wo es um das Aufenthaltsrecht geht, war Schicht im Schacht. Paragraph 4: »Der Bevollmächtigte darf, sofern es zum Wohle des Vollmachtgebers ist, über dessen Aufenthaltsort, inklusive Auflösung des Haushaltes, sowie eine Unterbringung mit freiheitsentziehenden Maßnahmen bestimmen.«
»Ha, das hättest du gern«, rief sie aufgebracht aus: »Mich ins Heim stecken. Damit du dir hier ein schönes Leben machen kannst.«
»Aber Mutter. Kein Mensch will dich ins Heim stecken. Du sollst hierbleiben, solange es nur geht.«
»Die Helbel Hella, die hat es erlebt. Die hats den Kindern unterschrieben. Und schwupps war sie im Heim.«
»Ich habe keine Ahnung, was bei der Hella Helbel war. Die hatte doch – Krebs?«
»Bauchspeicheldrüse. Das hat mir die Fischer Inge erzählt. Kaum dass sie im Krankenhaus war, haben sich ihre Fratzen wie die Geier aufs Haus gestürzt und es verkauft.«
»Wenn die Kinder zu mehreren sind, war es vielleicht die einzige Möglichkeit, Heimplatz und Operation zu finanzieren.«
»Das wär dir sowieso das Liebste. Dass ich Krebs kriege. Ich weiß nicht, woher du diese Art hast, von mir nicht. Aber nein, mein Herr Sohn, ich will noch ein bisschen leben.«
»Mensch, Mutter!«, ich schüttle mich bei dem, was sie da redet. »Wenns nach mir geht, sollst du noch zehn, zwanzig Jahre leben.«
»Ha, neinnein, so lang leb ich nicht mehr. Vielleicht noch zwei, drei Jahre. Aber das unterschreiben – niemals!«
Wie viele schlaflose Nächte ich seitdem hatte. All die Fragen bezüglich des Hauses, der Vermögensdinge, der Kranken- und Pflegeversicherung überfordern mich ohnehin. Das Einzige, was ich begriffen habe – was alle mir eingeschärft haben, ob Verwandte oder Beratungsstellen –: Ich benötige eine Vorsorgevollmacht. Und eine Bankvollmacht. Ohne diese kann ich nicht für sie sorgen. Beides hat sie immer strikt von sich gewiesen.
Und dann – wegen des Annerl – hat sie auf einmal eine 180-Grad-Wendung gemacht. Jetzt hieß es auf einmal: »Du brauchst eine Vollmacht von ihr! Und zwar bald, wenn das so weitergeht …«
»Das habe ich doch immer gesagt. Sie hat es abgelehnt. Genau wie du.«
»Nein, du bist faul. Du hast es schleifen lassen. Das hätte längst erledigt gehört.«
»Dann machen wir es jetzt – auch für dich. Nur für den Fall der Fälle.«
»Worauf wartest du noch? Mach einen Termin. Wir fahren zu dritt. Das muss erledigt werden!«
So kam es, dass ich den erstmöglichen Termin auf der »Betreuungsstelle« gebucht habe, den letzten Zeitslot in diesem Jahr.
Wir haben das Siegestor passiert und steuern auf die Feldherrnhalle zu. Plötzlich frage ich mich: Wird der Beamte die Vollmachten ausstellen? Wird er beim Annerl nicht sofort feststellen, dass sie längst zu verwirrt ist, um ihren freien Willen zu äußern?
Sie ist nun gänzlich durcheinander und murmelt vor sich hin:
»Ich versteh gar nicht, was ihr überhaupt wollts.«
»Ich will gar nichts von dir«, sage ich, um sie zu beruhigen. »Es geht darum, was du willst – falls du einmal Hilfe brauchst.«
»Mein Gott«, lenkt meine Tante ein, »es kann alles kommen.«
»Genau. Und nur falls es dazu käme, dass jemand für dich, sagen wir, die Telefonrechnung bezahlen muss, braucht er eine Vollmacht von dir. Sonst darf er dir nicht helfen. Dann beruft ein Gericht jemand Wildfremden. Das ist deine Entscheidung.«
»Und wenn ich dann sag, dass ich … dass …«, kommt sie jetzt ins Schwimmen. »Mein Gott, ich komm nicht mehr mit. Ich komm nicht mehr mit. Wir waren doch alle so friedlich beieinander. Und jetzt dieses Theater. Hab ich denn jemanden schlechtgemacht? Bin ich denn schuld?«