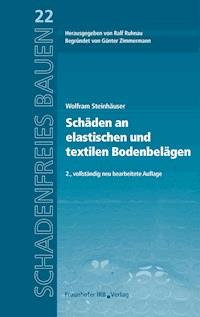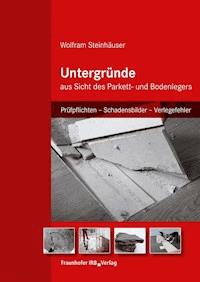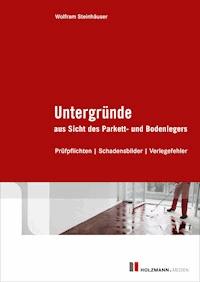39,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fraunhofer IRB Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Ursachen für Mängel und Schäden in der Bodenlegerpraxis sind vielfältig, fallen aber stets auf das Image des Planers und der Fußbodenfirma zurück. Langes Streiten kostet außerdem meist mehr, als das Beseitigen der Mängel.Der Autor erklärt in seinem Buch ausführlich die unterschiedlichsten Mängel, wie sie jeden Tag in der Praxis zu finden sind. Neben Schäden durch Feuchteeinwirkung und solche, die durch mangelhafte Untergründe oder Untergrundvorbereitungen entstehen, erläutert er außerdem Schäden, deren Ursache in einer fehlerhaften Verlegearbeit oder in der falschen Reinigung liegen.Damit wird dieses Buch zu einem echten Hilfsmittel, um Fehler und Mängel zu vermeiden. Für Sachverständige und Bodenleger bietet es außerdem eine echte Unterstützung, um Schäden schneller ausfindig zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wolfram Steinhäuser
Mängel und Schäden aus der Bodenlegerpraxis
Probleme erkennen – verhindern – bewerten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
ISBN (Print): 978-3-8167-9674-9
ISBN (E-Book-PDF): 978-3-8167-9675-6
ISBN (E-PUB): 978-3-8167-9775-3
ISBN (MOBI): 978-3-8167-9776-0
Lektorat: Volker Schweizer
Redaktion: Birgit Azh
Stylesheet und E-PUB-Herstellung: Angelika Schmid
Die hier zitierten Normen sind mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e. V. wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden einer Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung des Fraunhofer IRB Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von jedermann benutzt werden dürften.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert werden, kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
© Fraunhofer IRB Verlag, 2016
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB
Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart
Telefon +49 711 970-2500
Telefax +49 711 970-2508
www.baufachinformation.de
Vorwort
Durch Entscheidungs-, Planungs- und Ausführungsfehler, aber auch durch Produktions- sowie Nutzungsfehler, werden allein in Deutschland im Bauwesen jährlich über fünf Milliarden Euro vernichtet. Zynisch könnte man sagen, was sind schon fünf Milliarden Bauschäden im Vergleich zu den Milliardensummen, mit denen unsere Politiker jährlich in Europa und Deutschland jonglieren. Geschädigte werden wohl kaum so denken, denn gerade von Insolvenzen und Konkursen hängt ja auch das persönliche Schicksal der Betroffenen ab.
Fakt ist aber, dass Anwälte und Sachverständige sehr gut von diesen offensichtlich immer zunehmenden Mängeln und Schäden am Bau leben. Das trifft auch auf die Fußbodenbranche zu, auch hier sind die Gewinner in der Regel die Sachverständigen und Juristen. Ursachen für den sogenannten Pfusch sind vor allem Unvermögen, Fehlentscheidungen, Gleichgültigkeit und fehlendes Qualitätsbewusstsein, auch der starke Preisdruck spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Aber jeder Mangel, jeder Schaden beschädigt das Image des Planers und der Fußbodenfirma und jede Mängelbeseitigung kostet Geld. Langes Streiten beansprucht meist ein Vielfaches der Mängelbeseitigungskosten, nämlich Kosten für Anwälte, Sachverständige und nicht zu vergessen die Gerichtskosten. Häufig wird aber auch beim Streit über Mängel und Schäden über das Ziel hinausgeschossen. Unregelmäßigkeiten stellen sich nicht selten am Ende als unvermeidbar und hinnehmbar heraus.
Denn eines ist auch Fakt: Von Baugewerken kann nicht die Vollkommenheit und Exaktheit erwartet werden, wie man sie von industriell hergestellten Produkten kennt. Bauherren erwarten trotzdem in der Regel die absolut perfekte Ausführung der Bauleistung, was nicht immer möglich ist. Jede Bauleistung ist ein Unikat, das bei Wind und Wetter sowie häufig bei schlechten Baustellenbedingungen hergestellt werden muss. Diese Tatsache soll jedoch nicht die Mängel und Schäden entschuldigen, die tagtäglich auf den Baustellen anzutreffen sind.
In diesem Buch werden Schäden und Mängel aus der Bodenlegerpraxis vorgestellt, wie sie tagtäglich auf Baustellen und bei Kunden anzutreffen sind. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf den Rechtsbegriff des Mangels wird in den folgenden Ausführungen nicht eingegangen, das ist Sache der Juristen und Gerichte. In der Baupraxis ist ein Gewerk frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit besitzt. In der Regel werden vertraglich bindende Abmachungen über Art, Güte oder Qualität des herzustellenden Gewerks getroffen. Weicht das vom Auftragnehmer hergestellte Gewerk von dem vertraglich Geschuldeten negativ ab, dann ist das Gewerk mangelhaft. Hier taucht dann häufig die Frage nach der »Hinnehmbarkeit« kleinerer Mängel auf. Mit dem Bauherrn kommt es dann nicht selten zu Streitigkeiten darüber, welche Unregelmäßigkeiten dieser hinnehmen muss.
Deshalb ist es erforderlich, zulässige Grenzwerte im Gewerk »Bodenbelagsarbeiten« festzulegen, die vom Bauherrn zu akzeptieren sind. Darauf soll in diesem Buch beispielhaft eingegangen werden, denn die Bodenleger kennen sehr oft diese zulässigen Grenzwerte nicht. Manche Grenzwerte sind allerdings auch unter Fachleuten umstritten, hier muss dann letztendlich das Gericht entscheiden. Bei Unregelmäßigkeiten geht es in erster Linie auch im Bodenbelagsgewerk um optische Beeinträchtigungen. Über optische Beeinträchtigungen lässt sich immer streiten. Wann das Erscheinungsbild des verlegten Bodenbelages völlig mangelfrei ist, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes manchmal »reinste Ansichtssache«. Erhöhte optische Ansprüche sollten ausdrücklich vertraglich vereinbart werden.
Planungsleistungen werden in erster Linie von Architekten ausgeführt. In der Fußbodenbranche werden besonders in der Sanierung und Renovierung die Bodenleger als Planer aktiv. In der Regel übernehmen sie dann eine Doppelrolle, als Planer und Ausführender. Deshalb ist es hier besonders wichtig, dass Bodenleger wissen, auf was sie sich bei der Planung einlassen. Wofür müssen eigentlich Architekten einstehen, wenn sie Planungsleistungen ausführen und dabei Fehler machen? Leider sind sich viele Handwerker darüber nicht im vollen Umfang im Klaren.
Dieses Buch zeigt nicht nur mögliche Schäden und Mängel in der Bodenbelagsbranche auf, es will auch vor diesen Schäden und Mängeln warnen und Hinweise zur Vermeidung geben. Was ist zu beachten, damit Schäden und Mängel erst gar nicht entstehen? Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Dieses Buch will aber auch Sachverständigen und Bodenlegern helfen, die Ursachen der Schäden und Mängel etwas leichter zu finden. In der Baupraxis ist es doch häufig so, dass vor allem die Sachverständigen Sherlock Holmes spielen müssen, um mit einer sehr intensiven Detektivarbeit die wahren Schadensursachen herauszufinden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Schäden durch Feuchteeinwirkung
1.1 Einleitung
1.2 Belegereife und Feuchtemessung
1.3 Feuchteschäden – Ursachen und Auswirkungen
1.4 Richtige Untergrundtrocknung
2. Mängel an Untergründen
2.1 Einleitung
2.2 Oberflächenfestigkeit von mineralischen Untergründen
2.3 Maßtoleranzen und Ebenheiten
2.4 Anschlusshöhen von Fußböden
2.5 Fugen, Risse, Einbrüche, Fehlstellen
2.6 Spezielle Untergründe
2.7 Treppen
2.8 Erdberührte Fußbodenkonstruktionen
2.9 Korrosionsschäden an Heizungsrohren
3. Schäden aufgrund von Fehlern bei der Untergrundvorbereitung
3.1 Einleitung
3.2 Schäden durch mangelhafte Untergrundvorbereitung
3.3 Fehler beim Grundieren der Untergründe
3.4 Fehler beim Spachteln mit mineralischen Spachtelmassen
3.5 Abplatzen der Spachtelmasse vom Untergrund – zehn vermeidbare Schadensursachen
4. Schäden aufgrund von Verlegefehlern
4.1 Einleitung
4.2 Verlegefehler allgemein
4.3 Verlegefehler bei textilen Bodenbelägen
4.4 Verlegefehler bei Nadelvliesbelägen
4.5 Verlegefehler bei PVC-/CV-Belägen
4.6 Verlegefehler bei Linoleumbelägen
4.7 Verlegefehler bei Kautschukbelägen
4.8 Verlegefehler bei Korkbelägen
4.9 Typische Schadensfälle bei PVC-Designbelägen
4.10 Blasen und Beulen in elastischen Bodenbelägen
4.11 Schäden durch falsche Klebstoffauswahl und falsche Verarbeitung der Klebstoffe
4.12 Schäden durch falsche Verlegung leitfähiger Beläge
4.13 Schäden an Sockelleisten
5. Gerüche aus dem Fußboden
5.1 Einleitung
5.2 Hinweise zur Feststellung und Bewertung von Gerüchen
5.3 Materialspezifische Eigengerüche
5.4 Falsches Lüften
5.5 Altuntergründe
5.5 Feuchtigkeit und Wärme
5.6 Allgemeine Hinweise zur Geruchsproblematik
6. Fehler bei der Reinigung und Pflege von Bodenbelägen
6.1 Übergabe
7. Bewertung von Mängeln und Schäden bei Bodenbelägen
7.1 Wertminderung
Literaturverzeichnis
1. Schäden durch Feuchteeinwirkung
1.1 Einleitung
Für jeden Bauherrn, Auftraggeber, Architekten, Bauleiter und Handwerker heißt Bauen auch immer »Kampf gegen die Feuchtigkeit«. Über 50 % aller Schäden und Mängel am Bau haben mit Feuchtigkeit zu tun. Um Schäden und Mängeln am Bau vorzubeugen, muss die Feuchtigkeit aus allen mineralischen Baustoffen abdampfen und über die Raumluft abtransportiert werden. Je nach der Gesamtfeuchtmenge, der Temperatur und der relativen Luftfeuchte stellt sich im Bau ein Raumklima ein, das das Abdampfen der Feuchtigkeit fördern oder verhindern kann. Alle mineralischen Baustoffe gehen mit der sie umgebenden Luft einen Gleichgewichtszustand ein. Bei hoher Luftfeuchte können die mineralischen Baustoffe ihre Feuchtigkeit an die Raumluft nicht abgeben, das heißt, bei hoher Luftfeuchte trocknen diese Baustoffe nicht. Diese Zusammenhänge sind auch in der Fußbodenbranche bei der Trocknung mineralischer Untergründe bekannt, auch wenn sie häufig beispielsweise aufgrund von Bauablauf- und Zeitproblemen gern ignoriert werden.
1.2 Belegereife und Feuchtemessung
Jedem Bodenleger ist bekannt, dass er nur auf einem belegereifen Untergrund Oberbeläge schadensfrei verlegen kann. Die Belegereife eines mineralischen Untergrundes ist dann erreicht, wenn diese Untergründe Feuchtegehalte erreicht haben, die nach den allgemeinen Erfahrungen keine Feuchteschäden an Bodenbeläge verursachen. Die Feuchtewerte für die Belegereife sind höher als die der Ausgleichsfeuchte. Hierfür sind zwei Gründe verantwortlich. Zum einen ändert sich die Ausgleichsfeuchte mit der relativen Luftfeuchte, zum anderen wären zu lange Trocknungszeiten zum Erreichen der Ausgleichsfeuchte erforderlich. Die Ausgleichsfeuchte ist bekanntlich der Feuchtegehalt eines mineralischen Untergrundes, der sich im Gleichgewicht mit der relativen Luftfeuchte einstellt. Die Belegereife darf man allerdings nicht nur auf die Restfeuchtigkeit eingrenzen. Entscheidend sind auch eine ausreichende Festigkeit und ein ausreichender Schwindungsabbau.
Schwerpunkt bei den Prüfpflichten der Bodenleger ist eindeutig die Überprüfung des Feuchtegehaltes des zu belegenden Untergrundes. Jeder Verarbeiter sollte bedenken, dass er nicht nur den Feuchtegehalt von Neuuntergründen prüfen muss, auch für die sogenannten Altuntergründe besteht diese Prüfpflicht. Die meisten Verarbeiter sind der Meinung, dass die Altestriche aufgrund der langen Liegezeit ausreichend trocken sind. Das ist sicher in den meisten Fällen richtig, kann sich aber auch als großer Trugschluss herausstellen. Wenn es zu einem Feuchteschaden an den Oberbelägen kommt, muss der Handwerker anhand eines Prüfprotokolls nachweisen, dass er die Feuchte gemessen hat und der Untergrund ausreichend trocken war. Kann er das nicht, haftet er im Fall einer Reklamation für den vollen Schaden.
Mineralische Estriche und Betonuntergründe
Die Grenzwerte für die Belegereife von mineralischen Estrichen und Betonuntergründen sind u. a. in den folgenden Merkblättern vorgegeben:
BEB-Merkblatt »CM-Messung« Ausgabe Januar 2007
[1]
BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, Holzfußböden und Holzpflaster, Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« Stand März 2014
[2]
Merkblatt TKB-8 »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten« Stand Juni 2004
[3]
TKB-Merkblatt 16 »Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung« Stand März 2016
[37]
Sie betragen konkret im Einzelnen:
Calciumsulfatestrich
beheizt
0,3 CM-%
unbeheizt
0,5 CM-%
Zementestrich
beheizt
1,8 CM-%
unbeheizt
2,0 CM-%
Die überarbeitete Estrichnorm DIN 18560-1 trat ab November 2015 in Kraft. In diese Norm wurde unter anderem die CM-Messung des Restfeuchtegehalts zur Bewertung der Belegereife mineralischer Estriche neu aufgenommen. In dieser Estrichnorm wurde der Grenzwert für beheizte Calciumsulfat-/Calciumsulfatfließestriche neu festgelegt, er beträgt laut dieser Norm wie bei unbeheizten Calciumsulfat/Calciumsulfatfließestrichen kleiner gleich 0,5 CM-%. Diese Festlegung wurde durch die Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) im Industrieverband Klebstoffe e. V.: Düsseldorf in ihrem neusten TKB-Merkblatt 16 »Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung« Stand März 2016 mit folgender Begründung wieder aufgehoben:
»Da für diesen erhöhten Belegereif-Richtwert von 0,5 CM-% für beheizte Calciumsulfatestriche keine Daten, Begründungen oder Publikationen vorliegen, wird im vorliegenden Merkblatt am bisherigen Richtwert von 0,3 CM-% festgehalten, der sich in der Praxis über viele Jahre als sinnvoll und verlässlich erwiesen hat. Eine Anhebung des Richtwertes auf 0,5 CM-%, was einer Erhöhung um 67 % entspricht, würde zwar die Trockenzeit des Estrichs bis zum Belegereiffeuchte-Richtwert verkürzen, würde aber auch für den Verleger des Bodenbelags und damit auch für den Bauherrn das Risiko eines Feuchteschadens signifikant erhöhen.«
Zu Magnesia- und Steinholzestrichen wird im BEB-Merkblatt »CM-Messung« Ausgabe Januar 2007 Folgendes ausgeführt [1]:
»Die Belegereife von Magnesiaestrichen beträgt je nach Anteil der organischen Bestandteile im Industriebereich 1,0 bis 3,5 CM-%. Erfahrungswerte sind bei den Herstellern anzufragen. Steinholzestriche sind Magnesiaestriche mit hohem Holzgehalt. Sie können deshalb sehr unterschiedliche Ausgleichsfeuchte haben. Gemessen wurden CM-Werte von 2,5 bis 10 CM-%. Die Erfahrungswerte sind bei dem jeweiligen Hersteller zu erfragen.«
Da Magnesia- und Steinholzestriche in erster Linie in der Sanierung/Renovierung anzutreffen sind, können Erfahrungswerte für die Belegereife kaum noch beim Hersteller dieser Estriche erfragt werden. Hier kann eine Feuchteprüfung durchaus problematisch werden. Deshalb ist diese Aussage eigentlich nur graue Theorie.
Grundsätzlich muss der Feuchtegehalt von Betondecken und Betonbodenplatten mittels der Darr-Methode ermittelt und in Masse-% angegeben werden. Im Merkblatt TKB-8 »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten« Stand Juni 2004 [3] wird für Stahlbeton ein Grenzfeuchtegehalt für die Belegereife von 3,0 bis 3,5 CM-% vorgegeben. Diese Vorgaben für die Belegereife für Beton stehen im Widerspruch zur Aussage, dass der Feuchtegehalt von Betondecken nicht mit einem gewerbeüblichen Messgerät (CM-Gerät) ermittelt werden kann, sondern nur nach der Darr-Methode. Somit ist die Vorgabe zur Belegereife von unbeheiztem Beton von 3,0 bis 3,5 CM-% völlig wertlos und unsinnig.
In der Fachliteratur findet man zur Belegereife von Betonuntergründen ansonsten keine konkreten Angaben. Hier findet man lediglich den Hinweis, dass bei der Planung von Fußbodenkonstruktionen die Restbaufeuchte des Betons besonders berücksichtigt werden muss.
Auf Betondecken mit und ohne Verbundestrich sowie auf Betonbodenplatten werden recht häufig Bodenbeläge verlegt. Deshalb wird im Kommentar zur DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« Ausgabe April 2010 [4] zu diesen Untergründen Folgendes gesagt:
»Bei Betondecken mit und ohne Verbundestrich ist eine aussagefähige Messung des Feuchtegehaltes mit gewerbeüblichen Messgeräten nicht möglich. Die in den oberen Zonen des Untergrundes gemessenen Werte lassen keinen Rückschluss auf die Feuchte der Betondecke im restlichen Querschnitt zu. Da bei Betondecken mit und ohne Verbundestrich Austrocknungszeiten von einem Jahr und mehr erforderlich werden, sind durch die verbliebene Feuchte in solchen Untergründen Mängel oder Schäden an darauf verlegten Bodenbelägen aller Art nicht auszuschließen. Der Auftraggeber hat deshalb durch geeignete planerische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Feuchte aus dem Untergrund den Klebstoff und Bodenbelag nicht beeinträchtigt.«
Betonbauteile sind bekanntlich die am langsamsten austrocknenden Bauteile eines Bauwerks. Nach Professor Klopfer [5] haben beispielsweise Betonplatten mit einer Plattendicke von 20 cm bei beidseitiger Austrocknung eine Austrocknungsdauer von 1,5 Jahren, bei einseitiger Austrocknung (erdberührten Betonbodenplatten) eine Austrocknungsdauer von vier Jahren. Die Ermittlung der Feuchte von Betonuntergründen ist aufgrund der langen Trocknungszeiten von ein und mehreren Jahren auch uninteressant. Diese langen Trocknungszeiten will und kann kein Bauherr/Auftraggeber abwarten, um auf diesen Untergründen schadensfrei Bodenbelagsarbeiten ausführen zu können. Deshalb ist es auch Stand der Technik, Dampfbremsen aus Reaktionsharzen auf Betonuntergründe zu applizieren und so eine sofortige und schadensfreie Verlegung von Bodenbelägen zu ermöglichen. Die dampfbremsenden Reaktionsharze verringern die vom Betonuntergrund abgegebenen Wasserdampfmengen auf ein unschädliches Maß, so dass keine Feuchteschäden am Bodenbelag entstehen. Diese Vorgehensweise erfordert in der Regel keine Feuchtemessungen an den Betonuntergründen.
Aufgrund der Vielzahl von verschiedenen mineralischen Untergründen, auf denen Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden, sind die Risiken und Grauzonen im Hinblick auf die Feuchteprüfung und die Belegereife dieser Untergründe nicht zu unterschätzen. Beispielsweise für die Untergründe – Hartstoffestriche, Kunstharzestriche, Beton mit Zusatzmitteln, Leichtbeton, Porenbeton, Reaktionsharzbeton, Schaumbeton, Walzbeton, Betonkernaktivierung – findet man in der Fachliteratur keine Grenzfeuchtegehalte für die Belegereife. Bei der Verlegung von Oberbelägen auf diese Untergründe geht der Verarbeiter somit ein hohes Risiko ein.
Vor Gericht anerkannte Verfahren zur Prüfung des Feuchtegehaltes von mineralischen Untergründen sind das CM-Gerät und die Darr-Prüfung. Die Feuchtewerte werden bei der Prüfung mit dem CM-Gerät in CM-% bei der Darr-Prüfung in Masse-% angegeben. Die Darr-Methode ist übrigens keine handwerksübliche Prüfung und muss deshalb nicht vom Handwerker ausgeführt werden. Diese Prüfung kann nur von Sachverständigen und dafür autorisierten Einrichtungen erfolgen.
Zur Feuchtemessung von mineralischen Untergründen werden zahlreiche Messgeräte angeboten. Die Messgeräte funktionieren beispielsweise nach dem elektrischen Widerstandsprinzip, dem Prinzip der kapazitiven Messung oder der Messung der relativen Luftfeuchte in einem Bohrloch.
Im BEB-Merkblatt »CM-Messung Ausgabe Januar 2007 [1] wird dazu Folgendes ausgeführt:
»Demnach ist die CM-Methode für das ausführende Gewerk bewährt und die Messmethode zur Bestimmung der Belegereife von Calciumsulfat-, Magnesia- und Zementestrichen. Andere Messmethoden dienen trotz anderslautenden Aussagen einiger Gerätehersteller bei Calciumsulfat- und Zementestrichen ausschließlich zur Vorprüfung und zur Eingrenzung feuchter Flächen. Trotz jahrzehntelanger Bewährung der CM-Methode gibt es in der Praxis immer wieder Diskussionen, die die Messmethode wegen der möglichen Abweichungen in Frage stellen. Eine sorgfältige Prüfung setzt eine möglichst gleichmäßige Probenahme über den gesamten Estrichquerschnitt voraus. Die nach der Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen bei Estrichen unter Parkett traditionsgemäß praktizierte Probenahme im mittleren bis unteren Bereich weicht davon ab.«
Die Vorgehensweise bei der Messung des Feuchtegehaltes nach der CM-Messmethode ist ausführlich in folgenden Unterlagen beschrieben:
DIN 18560-4 »Estriche im Bauwesen Teil 4 Estriche auf Trennschicht« Stand Juni 2012
[6]
Bundesverband Estrich und Belag »Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in bestehenden Gebäuden«, Ausgabe Januar 2009
[7]
BEB-Merkblatt »Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, Holzfußböden und Holzpflaster, Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen« Stand März 2014
[2]
.
Bei den CM-Messungen sind die folgenden Schwerpunkte besonders zu beachten:
Der Verarbeiter muss bei jeder CM-Messung auch die Estrichdicke messen und ins Messprotokoll eintragen. Grundsätzlich liegt aber die Prüfung der Estrichdicke nicht im Rahmen der Prüfpflichten des Verarbeiters. Bei auf der Baustelle festgestellten Minder- als auch bei Mehrdicken muss der Verarbeiter schriftlich Bedenken anmelden. Minderdicken beeinträchtigen die Tragfähigkeit des Estrichs. Mehrdicken werden die Trocknungszeit des mineralischen Untergrundes je nach Dicke und den raumklimatischen Bedingungen mehr oder weniger intensiv verlängern. Bei größeren Mehrdicken werden beispielsweise Calciumsulfatestriche sehr langsam, im Extremfall überhaupt nicht mehr trocknen.
Die erste CM-Messung ist vom Bodenleger als Nebenleistung zu erbringen. Alle weiteren CM-Messungen sind eine besondere Leistung und somit dem Verarbeiter zu vergüten.
Je Estrichebene bis 100 m
²
ist mindestens eine CM-Messung durchzuführen. Bei größeren Flächen wird eine Messung je 200 m
²
als ausreichend angesehen.
Zur Ermittlung des Feuchtegehaltes eines beheizten mineralischen Estrichs müssen im Heizestrich Messstellen markiert sein.
Die CM-Messungen müssen unmittelbar vor der Verlegung der Oberbeläge durchgeführt werden.
CM-Messungen müssen immer an den feuchtesten Stellen durchgeführt werden. Diese Raumbereiche sind beispielsweise fensterlose Raumecken, Bereiche ohne oder zumindest mit wenig Sonneneinstrahlung und geringer Luftbewegungsmöglichkeit. Die feuchtesten Stellen lassen sich beispielsweise mit Hilfe von elektrischen Messgeräten leicht und zerstörungsfrei aufspüren.
Die Bodenleger haben bei schwimmenden Estrichen den Untergrund nur bis zur abgedeckten Dämmschicht zu prüfen. Bei Estrichen auf Trennschicht muss die Feuchteprüfung bis zur Trennschicht erfolgen. Bei Verbundestrichen ist der mineralische Untergrund bis zur Oberfläche der darunter befindlichen Tragschicht (Betondecke, Betonbodenplatte) zu prüfen.
Sonderestriche
Im Bauwesen werden immer häufiger sogenannte Sonderestriche eingebaut, die über Normen weder erfasst noch geregelt sind. Dazu gehören beispielsweise:
Trocknungsbeschleunigte Estriche auf Zement- und Calciumsulfatbasis
Schnellestriche, hergestellt mit speziellen Bindemitteln
Acrylatestriche (»Bio-Estriche«)
Leichtestriche auf Basis, Perlit, Blähton und Bims
Monokornestriche
Gebundene Ausgleichsschüttungen
Landläufig wird in der Baupraxis vor allem über »Schnellestriche« gesprochen. Mit dem Begriff »Schnellestrich« verbinden Bauherrn, Auftraggeber, Architekten, Planer und Bauleiter die Erwartung, dass auf diesem, vor allem mineralischen Estrich, so schnell wie möglich Bodenbeläge schadensfrei verlegt werden können. Der Begriff »Schnellestrich« ist nicht genormt. Sowohl in der Fachliteratur als auch unter den Fachexperten ist die Begriffssituation relativ unübersichtlich. Nach Altmann [6] kann man unter Schnellestrich verstehen:
»Estriche, die schnell eingebaut werden (z. B. alle Fließestriche)
Estriche, die schnell Festigkeit aufbauen und deshalb schnell genutzt werden können (z. B. Estriche mit Erhärtungsbeschleunigern oder Kunstharzestriche)
Estriche, die schnell aufgeheizt werden können (z. B. Alpha-Halbhydrat-Estriche)
Estriche, die schnell trocknen (z. B. Estriche mit Zusatzmitteln oder Trocknungsbeschleunigern)
Estriche, die schnell belegereif sind (z. B. Estriche, die mit Schnellzement hergestellt wurden)«
Die Technische Kommission Bauklebstoffe hat die Problematik erkannt und deshalb im August 2015 das TKB-Merkblatt 14 mit dem Titel »Schnellzementestriche und Zementestriche mit Estrichzusatzmitteln« veröffentlicht [7]. Hier heißt es u. a.:
»Zementestriche lassen sich anhand ihrer Zusammensetzung und Eigenschaften in vier Gruppen einteilen:
Schnellzementestriche auf Basis von ternären(aus drei Stoffen bestehend) Bindemittelsystemen (SZ-T): Schnelle Erhärtung, schnelle Trocknung, geringe Schwindung.
Schnellzementestriche auf Basis von binären (aus zwei Stoffen bestehend) Bindemittelsystemen (SZ-B): Schnelle Erhärtung.
Estriche auf Basis von Normalzementen mit Estrichzusatzmitteln (EZM): Reduzierter Wassergehalt, verbesserte Verarbeitung.
Estriche auf Basis von Normalzementen: Schwierige Verarbeitung, lange Trocknungszeit.«
Übrigens gibt es für Schnellzemente und Schnellzementestriche keine eigenständige Norm, hier gelten die Anforderungen nach DIN 18560. Die Eigenschaften sogenannter »beschleunigter« Estriche sind in der DIN 13813 geregelt. Diese Norm beinhaltet jedoch keine Regelungen zur Belegereife.
In der Baupraxis stehen ganz klar mineralische Schnellestriche im Vordergrund, die schnell erhärten, schnell trocknen und gering schwinden. Diese Erwartung verbindet jeder Architekt, Planer und Bauleiter mit dem Begriff »mineralischer Schnellestrich«. Außerdem wird erwartet, dass sich diese Estriche als Estriche auf Dämm- und Trennschicht sowie als Verbundestrich einbauen lassen.
Die Wahl, welcher Schnellestrich im jeweiligen Bauvorhaben eingebaut wird, hat entscheidende Konsequenzen für die weitere Vorgehensweise bei der Ausführung der Bodenbelagsarbeiten. In der Baupraxis erfährt der Bodenleger nicht selten rein zufällig, dass ein Schnellestrich eingebaut wurde.
Der Bodenleger sollte sich deshalb bereits im Vorfeld vom Bauherrn/Planer/Estrichleger darüber informieren lassen, welcher Estrich tatsächlich eingebaut wurde. Das trifft übrigens auch auf die Sachverständigen zu, wenn Sachverständige beispielsweise zur Klärung von Schadensfällen hinzugezogen werden. Auf die »charakteristischen« Merkmale, wie zum Beispiel Farbe, Körnung, Textur, Ebenheit oder Fugenbild kann sich der Sachverständige und der Bodenleger nicht allein verlassen, um daraus die richtigen Schlussfolgerungen über die Art des Estriches zu ziehen. Das Ergebnis der Befragung sollte der Bodenleger auf jeden Fall schriftlich festhalten und seiner Bauakte hinzufügen.
Verlegearbeiten auf mineralischen Schnellestrichen, die mit Wasser angemacht werden, setzen einen bestimmten Grenzfeuchtegehalt voraus.
Erst nach dem Erreichen bzw. Unterschreiten dieses Grenzfeuchtegehaltes können auf einen Schnellestrich Oberbeläge verlegt werden, ohne dass die bekannten Mängel und Schäden aufgrund zu hoher Untergrundfeuchte auftreten werden. In der Technischen Information des BEB zur CM-Messung – Stand 01/2007 [1] heißt es:
»Schnellestriche und mit trocknungsbeschleunigenden Zusatzmitteln hergestellte Estriche sind Sonderestriche, die auch mit der CM-Methode gemessen werden können. Allerdings gibt es keine allgemeinverbindlichen Grenzwerte. Die Vorgabe, wann solch ein Sonderestrich gefahrlos belegt werden kann, muss über den Hersteller des »Schnell«-Bindemittels bzw. des Zusatzmittels erfolgen. Ein aussagefähiges Prüfzeugnis des Herstellers sollte vertraglich eingebunden werden.«
Bisher war es so:
Bei jedem Sonderestrich musste der Feuchtegehalt mit dem CM-Gerät ermittelt werden. Die für die Belegereife maßgebenden Messungen mussten unmittelbar vor der Verlegung der Oberbeläge erfolgen.
Die zulässigen Grenzfeuchtegehalte mussten für beheizte und unbeheizte Sonderestriche grundsätzlich vom Bauherr/Planer/Estrichleger dem Sachverständigen und Bodenleger vorgeben werden. Die zulässigen CM-Werte stehen in der Regel in den Technischen Merkblättern bzw. in den Technischen Informationen der Sonderestriche. Wenn nicht, musste der Bauherr/Planer/Estrichleger dem Bodenleger die zulässigen Grenzfeuchtegehalte für den jeweiligen unbeheizten oder beheizten Sonderestrich schriftlich mitteilen.
Der Bauherr/Planer/Estrichleger hatte dem Sachverständigen und Bodenleger vorzugeben:
Wie mit dem CM-Gerät gemessen werden muss!
Wie viel Prüfgut ist einzuwiegen!
Nach welcher Zeit ist der Manometerdruck und somit der Feuchtegehalt am CM-Gerät abzulesen!
Diese Angaben stehen in der Regel in den Technischen Merkblättern bzw. in den Technischen Informationen der Sonderestriche.
Wie bei allen Heizestrichen üblich, mussten dem Bodenleger auch bei beheizten Sonderestrichen markierte Messstellen für die CM-Prüfung vorgegeben werden. Um die Messpunkte herum darf sich im Abstand von 10 cm (Durchmesser 20 cm) kein Fußbodenheizungsrohr befinden.
Offensichtlich hat es bei dieser Vorgehensweise häufig Probleme gegeben. Die Estrichleger, aber auch die Bauherrn, Planer und Bauleiter waren hier wenig kooperativ und die Bodenleger mussten um die erforderlichen Angaben zur Feuchtemessung regelrecht betteln. Deshalb gibt es seit 2014 ein Protokoll zur Dokumentation der CM-Messung gemäß der Arbeitsanweisung des Bundesverband Estrich und Belag [8] in dem Folgendes steht:
»Sonderestriche – die rechtsverbindliche Freigabe der Belegereife ist dem Bodenleger vom Bauherrn zu übergeben«.
Für jeden Bodenleger ist diese Vorgehensweise eine einfache und sichere Sache, die sehr zu begrüßen und vollkommen richtig ist. Trotzdem bleiben Zweifel an der Kooperationsfähigkeit der Bauherren, die einen Fachmann mit der Überprüfung des Feuchtegehaltes des Sonderestrichs beauftragen und die Kosten für diese Prüfung tragen müssen. Der Zeitdruck auf die Bodenleger wird sein Übriges dazu beisteuern.
Jeder Bodenleger sollte wissen, wenn er ohne rechtsverbindliche Freigabe einen Oberbelag auf einen Sonderestrich verlegt, dass er dann ein hohes Risiko eingeht.
Bei beheizten Sonderestrichen muss in jedem Fall das Funktionsheizen durchgeführt werden. Das Funktionsheizen dient dem Heizungsbauer als Nachweis für die mangelfreie Erstellung seines Gewerkes. Ob ein Belegreifheizen erforderlich ist, wie beispielsweise bei den normalen mineralischen Heizestrichen, muss beim Hersteller des Sonder-Heizestrichs erfragt werden. Es gibt Hersteller, die bei ihrem Sonder-Heizestrich auf ein Belegreifheizen verzichten. Andere Hersteller bestehen auf einem Belegreifheizen, in der Regel genau nach ihren Vorgaben. Diese Hersteller bestehen auf dem von ihnen vorgegebenen Aufheizprotokoll.
Abb. 1: Normaler Zementestrich oder Schnellzementestrich? Optisch gibt es keine Unterscheidungsmerkmale, hier muss der Bodenleger den Estrichleger oder Bauherrn fragen, welcher Estrich tatsächlich eingebaut wurde.
Wände
Ein Beispiel aus der Fachpresse [9]. Kunststoffummantelte Fußbodenleisten wurden auf einen mineralischen Putzuntergrund angebracht, der offensichtlich nicht ausreichend trocken war. Es kam zu Verformungen und Ablösungen der Fußbodenleisten. Der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten wurde durch das OLG Köln zur Mängelbeseitigung aufgefordert, obwohl der Auftragnehmer unter Hinweis auf die DIN 18365 einwand, dass er nur den Boden und nicht auch die Wände auf Restfeuchtigkeit überprüfen müsse.
Das OLG Köln begründet das Urteil vom 8. Februar 2006 – 11 U 93/04 wie folgt:
»Der Auftragnehmer haftet, weil er die ihm obliegenden Prüf- und Hinweispflichten aus § 4 Nr. 3 VOB/B verletzt hat. Richtig ist zwar, dass die DIN 18365 in Abschnitt 3.1.1 eine Prüfpflicht hinsichtlich der Wandflächen nicht ausdrücklich vorsieht. Der Umfang der Prüfpflicht wird durch die DIN aber nicht abschließend, sondern nur beispielhaft umschrieben. Für alle Faktoren, die sich unmittelbar auf die Qualität der Werkleistung auswirken können, obliegt dem Werkunternehmer in vollem Umfang die Prüfpflicht.«
Aus bautechnischer Sicht ist die Problematik »Wandfeuchte« für die Bodenleger ein nicht zu unterschätzenden Faktor. Bekanntlich werden Estriche erst nach der Ausführung der Putzarbeiten eingebaut.
Normale mineralische Estriche brauchen bis zum Erreichen der Belegereife ca. 4 bis 5 Wochen. Während dieser Trocknungszeit sind die 1 bis 2 cm dicken, neuen Innenputze ebenfalls in der Regel auf ihre Belegereife heruntergetrocknet. Aus Zeitgründen werden immer häufiger Schnellbauestriche eingebaut, die teilweise bereits ein bis zwei Tage nach dem Einbau mit Oberbelägen belegt werden können.
Kritisch kann es dann werden, wenn die Schnellbauestriche sofort nach der Belegreife des Schnellbauestriches mit Oberbelägen belegt und anschließend die Sockelleisten ebenso schnell auf die frischen mineralischen Wandputze angebracht werden. Die Fußbodenabdichtung und die waagerechte Abdichtung der Innen- und Außenwände müssen so ausgeführt sein, dass ein Feuchtigkeitsdurchtritt ausgeschlossen ist. Sind diese Abdichtungen defekt oder nicht vorhanden, kann Feuchtigkeit in den Innen- und Außenwänden aufsteigen und die bekannten Schäden an den Sockelleisten verursachen. Auch und gerade deshalb müssen die Wände im Neu- wie im Altbau auf ihre Belegereife geprüft werden.
Zur Beurteilung der Belegereife von Wanduntergründen muss der Ausführende zuerst einmal wissen, auf welchen Wanduntergründen er die Sockelleisten anbringen soll. Im Neubau ist es auf jeden Fall sicherer, beim Auftraggeber, Architekten, Bauleiter oder beim Putzer nachzufragen, welcher Putz aufgebracht wurde und aus welchen Baustoffen die aufgehenden Wände bestehen, auf die der Putz aufgetragen wurde.
Wandputze werden analog zu den mineralischen Estrichen mit den gleichen Bindemitteln unter Beimischung von Anmachwasser hergestellt. Deshalb sind beim Wandputz annähernd die gleichen werkstoffspezifischen Eigenschaften zu erwarten wie bei mineralischen Estrichen. Das Trocknungsverhalten der neuen Wandputze ist dem der mineralischen Estriche ähnlich. Die zahlreichen Bindemittelkombinationen (verschiedene Herstellerrezepturen) ermöglichen jedoch auch andere bauspezifische Trocknungs- bzw. Aushärtezeiten. Hier sind die Herstellerangaben bindend und müssen unbedingt erfragt werden.
Im Bestand wird das schwieriger, wie die Baupraxis immer wieder zeigt. Im Altbau gehen die Handwerker in der Regel davon aus, dass die Innen- und Außenwände aufgrund der langen Standzeit ausreichend trocken sind. Aber Vorsicht bei fehlenden oder defekten Abdichtungs- und Sperrschichten in den aufgehenden Wänden und Bodenplatten. Durch nachschiebende Feuchte können sich auch im Altbau die Wände so stark auffeuchten, dass es zu Schäden an den Sockelleisten kommen kann.
Aus bautechnischer Sicht sind folgende Fragen offen, da es hierfür keine verbindlichen Richtlinien, Vorgaben oder Merkblätter für die Bewertung der Belegereife von Wanduntergründen gibt:
Wie ist der Feuchtegehalt dieser Untergründe zu ermitteln?
Wie »tief« muss der Auftragnehmer die Wandfeuchte messen?
Welchen Feuchtegehalt müssen die verschiedenen mineralische Wanduntergründe besitzen, um die erforderliche Belegereife zu gewährleisten?
Die Bodenleger messen in der Regel die Wandfeuchten mit Messgeräten, die nach dem elektrischen Widerstandsmessverfahren funktionieren.
Abb. 2: Messung der Wandfeuchte mittels elektrischen Widerstandsverfahren
Laborspezifische Analyseverfahren bieten gemeinsam mit Darr-Prüfungen bei der Feststellung der Wandfeuchte zwar die größte Sicherheit, kommen aber nur in ganz speziellen Sonderverfahren zur Anwendung, wenn es beipielsweise um Streitigkeiten mit hohem Streitwert geht.
Bei den in Deutschland üblichen Innenputzen kann man davon ausgehen, dass ca. 95 % aller Neuputze aus Maschinengipsputz bestehen. Auf diesen Neuputzen können in der Regel ca. 4 bis 6 Wochen nach der Ausführung der Putzarbeiten die Tapezierarbeiten ausgeführt und die Sockelleisten angebracht werden.
Nach den Erfahrungen eines namhaften Herstellers des Maschinengipsputzes sind bei Feuchtigkeitswerten des Gipsputzes von unter einem Masse-% keine Schäden beim Anbringen der Sockelleisten zu erwarten. Dieser Wert hat jedoch keinen allgemein verbindlichen Charakter. Nach den Angaben dieses Herstellers können die Feuchtewerte der Gipsputze auch mit dem CM-Gerät ermittelt werden, in gleicher Weise wie die Messungen mit dem CM-Gerät bei Calciumsulfatestrichen.
Aufgehende, nicht verputzte, neue Betonwände werden in der Regel verspachtelt oder verbleiben als sogenannter Sichtbeton. An diesen Wänden sind ebenfalls Sockelleisten anzubringen. Auch wenn diese Wände nach beiden Seiten austrocknen können, beträgt die Trocknungszeit des Betons häufig ein Jahr und länger.
Wie bei Betondecken auch, ist eine aussagefähige Messung des Feuchtegehaltes mit gewerbeüblichen Messgeräten (CM-Gerät) bei Betonwänden nicht möglich. Feuchtemessungen können nur mittels der Darr-Methode ausgeführt werden. Die Prüfung der Trockenheit der Betonwände ist somit keine Prüfpflicht des Handwerkers.