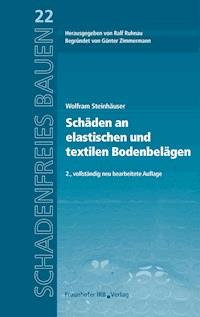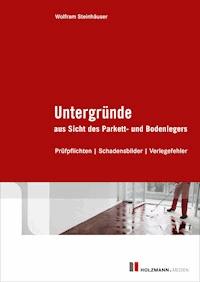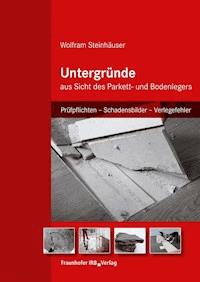
39,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fraunhofer IRB Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Verlegung von Bodenbelägen und Parkett auf mineralische Estriche, Gussasphaltestriche, Holzdielen, Trockenestriche, Span- und OSB-Platten gehört zum Standardprogramm eines jeden Parkett- und Bodenlegers.Das Spektrum der auf der Baustelle anzutreffenden Untergründe ist jedoch wesentlich vielfältiger. Nicht selten fragt sich der Parkett- und Bodenleger, wie er im speziellen Fall vorzugehen hat, um schadenfrei Belagsarbeiten ausführen zu können. Kompetent und sachkundig stellt Wolfram Steinhäuser in seinem Buch die in der Praxis vorkommenden, unterschiedlich beschaffenen Untergründe vor. Detailliert beschriebene Schadensbilder helfen dabei, Verlegefehler und damit teure Folgekosten zu vermeiden. Eine genaue Beschreibung der erforderlichen Prüfpflichten macht das Werk zu einem unverzichtbaren Helfer für Parkett- und Bodenleger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wolfram Steinhäuser
Untergründe aus Sicht des Parkett- und Bodenlegers
Prüfpflichten | Schadensbilder | Verlegefehler
Fraunhofer IRB Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
ISBN (Print): 978-3-8167-9763-0 ISBN (E-Book): 978-3-8167-9774-6 ISBN (E-PUB): 978-3-8167-9869-9 ISBN (MOBI): 978-3-8167-9870-5
Lektorat: Achim Sacher, Carmen Kirchner, Holzmann Medien | Buchverlag
Herstellung · Satz: Markus Kratofil, Holzmann Medien | Buchverlag
Umschlaggestaltung: Martin Kjer
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
Die hier zitierten Normen sind mit Erlaubnis des DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden einer Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung des Fraunhofer IRB Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von jedermann benutzt werden dürften.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert werden, kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
© Fraunhofer IRB Verlag, 2016
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB
Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart
Telefon +49 711 970-2500
Telefax +49 711 970-2508
www.baufachinformation.de
Vorwort
Die Verlegung von Bodenbelägen und Parkett auf mineralische Estriche, Gussasphaltestriche, Holzdielen, Trockenestriche, Span- und OSB-Platten gehört zum Standardprogramm eines jeden Parkett- und Bodenlegers. Diese Untergründe sind am häufigsten auf Baustellen anzutreffen. Das Spektrum an Untergründen, die in der Baupraxis auftreten und auf die ebenfalls Bodenbeläge und Parkett verlegt werden sollen, ist jedoch wesentlich vielfältiger. Nicht selten fragt sich dann der Parkett- und Bodenleger, wie er bei diesem speziellen Untergrund vorzugehen hat, um darauf schadensfrei Belagsarbeiten ausführen zu können. Jedem Parkett- und Bodenleger muss klar sein: Egal um welchen Untergrund es sich handelt und wie der Untergrund beschaffen ist – er muss seinen Prüfpflichten nachkommen. Grundsätzlich muss jeder alte wie auch jeder neue Untergrund für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten gemäß DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ sowie für die Ausführung von Parkettarbeiten gemäß DIN 18356 „Parkettarbeiten“ eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, frei von Trennmitteln sowie zug- und druckfest sein. Jeder Auftraggeber (Bauherr) hat dem Auftragnehmer (Bodenleger, Parkettleger) den Untergrund so zur Verfügung zu stellen, dass der Auftragnehmer seine Werkleistung mangelfrei erbringen kann. Jeder Auftragnehmer für Parkett- und Bodenbelagsarbeiten ist andererseits verpflichtet, mit der im Verkehr üblichen Sorgfalt und unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie des Standes der Technik den Untergrund auf seine Belegereife zu überprüfen. Weist der Untergrund Mängel auf oder sind aufgrund der gewählten Fußbodenkonstruktion Schäden zu erwarten, muss der Auftragnehmer schriftlich Bedenken geltend machen.
Bauherren, Architekten, Parkett- und Bodenleger müssen sich nicht selten mit alten Untergründen auseinandersetzen.
Die richtige Planung eines Fußbodens ist für dessen Erfolg entscheidend. Die genaue und realistische Planung erfordert technisches und wirtschaftliches Wissen sowie praktische Erfahrung. Der Planer schuldet in der Regel die für die Durchführung der Bauleistungen notwendigen Pläne, Ausschreibungsunterlagen und sonstigen Beratungsleistungen als auch die Objektüberwachung. Der Planer hat wie jeder Werkunternehmer für die Entstehung eines mangelfreien und zweckgerechten Gewerkes einzustehen. Entspricht seine Leistung nicht den Anforderungen, so ist seine Leistung fehlerhaft, und zwar unabhängig davon, ob die anerkannten Regeln der Technik eingehalten worden sind oder nicht. Planungsleistungen werden in erster Linie von Architekten ausgeführt. In der Fußbodenbranche jedoch werden insbesondere Parkett- und Bodenleger als Planer in der Sanierung und Renovierung aktiv. In der Regel übernehmen sie eine Doppelrolle als Planer und Ausführender. Deshalb ist es hier besonders wichtig, dass Parkett- und Bodenleger wissen, worauf sie sich bei der Planung einlassen. Wofür müssen eigentlich Architekten einstehen, wenn sie Planungsleistungen ausführen und dabei Fehler machen? Leider sind sich viele Handwerker darüber nicht im vollen Umfang im Klaren. Die Ausführungen im BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau, Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, Holzfußböden und Holzpflaster, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“, Absatz 1.2, Stand März 2014, gelten für Planer und Ausführende. Hier heißt es beispielsweise im Punkt „Besondere Hinweise für den Planer/Architekten“:
„Zur Vermeidung von Missverständnissen und zur eindeutigen Leistungsbeschreibung müssen folgende Angaben im Leistungsverzeichnis enthalten sein:
Angaben über den Gesamtaufbau einer Fußbodenkonstruktion, wie z.B.
Anforderungen hinsichtlich Nutzung und Art der Beanspruchung
Art und Aufbau des Estrichs und der verwendeten Bindemittel und Zusätze (z.
B. beschleunigte Estriche)
beheizte/gekühlte Untergründe
Nenndicke des Estrichs
Anordnung, Art und Dicke der einzelnen Schichten (Estrich und ggf. Abdeckung, Dämmstoffe, Trennschichten sowie Sperrschichten gegen Wasserdampf)
Abdichtungen gegen Wasser
alte Schichten (Klebstoffe, Spachtelmassen, Unterlagen usw.)
Anordnung von Fugen (Fugenplan) etc.
Der tatsächliche Aufbau ist sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen zu dokumentieren und dem Bodenleger rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen.“
Diese Forderungen sind vollkommen berechtigt und auch zwingend notwendig, aber leider oft graue Theorie. Besonders häufig fehlen selbst bei der Planung durch einen Architekten die Angaben über die Nenndicke des Estrichs, Anordnung, Art und Dicke der einzelnen Schichten, Abdichtungen gegen Wasser und der Fugenplan.
Wenn der Parkett- und Bodenleger die Mängel in der Planung feststellt, muss er Bedenken anmelden und die fehlenden Angaben beim Bauherrn einfordern. Wenn der Parkett- und Bodenleger die Fußbodenplanung und die Ausführung allein übernimmt und keine vollständigen Angaben zu den geforderten Planungsunterlagen machen kann, muss er das dem Bauherrn mitteilen und eventuell die Gewährleistung ausschließen. Häufig gehen hier die Parkett- und Bodenleger große Risiken ein.
Die Sanierung von Gebäudebeständen nimmt nach wie vor in Deutschland wie auch in Europa einen dominanten Raum ein. Architekten, Planer, aber auch Estrichleger, Parkett- und Bodenleger müssen sich mit alten Untergründen auseinandersetzen.
Altuntergründe sind grundsätzlich keine normgerechten Untergründe gemäß BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen", Stand März 2014.
Die Art der zu sanierenden Fußböden ist ebenso vielfältig wie der Umgang von Bauherrn, Architekten, Planern und Handwerkern mit den verschiedenen Untergründen. Landläufig herrscht die Meinung vor, dass der „gute alte Estrich“, der bereits die vergangenen 50 Jahre oder länger schadlos überdauert hat, auch die nächsten Jahrzehnte überstehen wird. Leider wird dabei außer Acht gelassen, dass auch ein Fußboden Alterungsprozessen unterworfen ist, wie in der Baupraxis täglich festgestellt werden kann. Dipl.-Ing. (FH) Peter Kunert hat im Jahr 2005 einen Fachbeitrag unter dem Titel „Nutzungsdauer von Estrichen im Wohnungs- und Objektbau und von Nutzböden im Industriebau“ veröffentlicht mit dem Ziel, zu diesem Thema eine Diskussion unter den Fachleuten auszulösen. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind dazu keine Stellungnahmen bekannt. Die Vorgaben in diesem Fachbeitrag zur Nutzungsdauer und zur Abschreibung von Estrichen sind bemerkenswert.
Kunert gibt beispielsweise folgende Nutzungsdauer für schwimmende Estriche im Wohnbereich an:
Beanspruchung hoch: 20 Jahre
Beanspruchung mittel: 30 Jahre
Beanspruchung leicht: 40 Jahre
Im Objektbereich verkürzen sich diese Zeiten wie folgt:
Beanspruchung hoch: 15 Jahre
Beanspruchung mittel: 20 Jahre
Beanspruchung leicht: 25 Jahre
Solche Angaben werden von den Architekten und Planern in der Altbausanierung so gut wie nie berücksichtigt, in der Regel sogar völlig ignoriert, obwohl eine solche Nachlässigkeit erhebliche Reklamationen nach sich ziehen kann. Deshalb wird auch grundsätzlich empfohlen, unbedingt auf eine bauseitige Bestandsaufnahme zu bestehen. In dieser Problematik liegt die große Chance, jedoch auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Boden- und Parkettleger. Boden- und Parkettleger werden häufig gefragt, ob der alte Untergrund in seinem jetzigen Zustand so bleiben kann, sanierungsfähig ist oder ob es ausreicht, lediglich „kleinere“ Ausbesserungen vorzunehmen, um einen verlegereifen Untergrund zu erzielen. Machen die Handwerker dazu verbindliche Aussagen, sind die Boden- und Parkettleger in einem solchen Fall automatisch Planer. Was bedeutet das für den Handwerker? Der Parkett- und Bodenleger muss gegenüber dem Bauherrn für technische und wirtschaftliche Planungsfehler einstehen. Ist ein Planungsfehler gegeben, kann der Bauherr vom Verarbeiter Regress fordern.
Was ist ein Untergrund, und was müssen Parkett- und Bodenleger über Untergründe wissen? Eine heikle Frage, die man einfach so beantworten könnte: Eigentlich fast alles. Allerdings schützt hier die Verarbeiter die folgende Aussage im bereits zitierten BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau“, Stand März 2014, vor allzu forsch vorgehenden Bauherrn bei der Klärung der Schuldfrage bei Reklamationen. Hier heißt es im Punkt 1.2 „Besondere Hinweise für den Planer/Architekten“:
„Die Prüfpflicht des Bodenlegers erstreckt sich auf den Untergrund (Lastverteilschicht, z.B. Estrich) und nicht auf darunterliegende Schichten (z.B. Trennlagen/Dämmschichten und/oder Abdichtungen).“
Dieser eine Satz hat schon manchen Parkett- und Bodenleger vor größerem Schaden bewahrt, denn selbst Architekten und Bauleiter sind oft der Meinung, dass Parkett- und Bodenleger den gesamten Fußbodenaufbau überprüfen müssen. Nicht selten sind dann Planer ganz überrascht darüber, dass sie falsch geplant haben, weil sie beispielsweise auf die fachgerechte Abdichtung auf einer neu eingebauten Betondecke verzichtet haben.
Der Parkett- und Bodenleger muss auf dem Untergrund seine Leistungen ausführen. Das betrifft den Boden- und auch den Wandbereich, an dem er die Sockelleisten befestigen muss. Wie man in den folgenden Ausführungen erkennen kann, gehen die Meinungen darüber, was der Parkett- und Bodenleger über Untergründe wissen sollte und prüfen muss, häufig weit auseinander. Das zeigen auch die zahlreichen Gerichtsurteile, die ja bekanntlich besonders bauherrnfreundlich sind. Bei den Neuuntergründen dürfte diese Problematik nicht ganz so dramatisch sein. Hier kann man nur jedem Parkett- und Bodenleger empfehlen, beim Bauherrn, Architekten, Bauleiter oder am besten gleich beim Estrichleger nachzufragen, welcher Estrich tatsächlich eingebaut wurde. Die Betonung liegt hier auf den Worten „tatsächlich eingebaut“. Es gab und gibt immer wieder Baustellen, bei denen beispielsweise Zementestrich in der Ausschreibung steht und tatsächlich ein Schnellestrich eingebaut wurde. Besonders problematisch sind mineralische Sonderestriche, denn anhand von Farbe, Körnung, Textur, Ebenheit oder Fugenbild kann der Parkett- und Bodenleger unmöglich erkennen, welcher Estrich tatsächlich eingebaut wurde und was er bei der Verlegung auf diese Untergründe besonders beachten muss. Bei den Altuntergründen ist häufig die Frage, um welchen Untergrund es sich handelt und wie hier vorzugehen ist, besonders problematisch. Die Bauherrn wollen hier fast immer Planungskosten einsparen und lassen den Parkett- und Bodenleger entscheiden, wie er hier vorgehen will. Somit liegt alle Verantwortung beim Parkett- und Bodenleger.
Auf diesem kritischen und nicht tragfähigen Altuntergrund kann kein Parkett oder Bodenbelag verlegt werden.
Im Kommentar zur DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Absatz 4.2.4 Beseitigen alter Beläge und Klebstoffschichten, Stand 2010, heißt es:
„Durch evtl. auftretende chemische Wechselwirkungen zwischen Altuntergrund und Neuaufbau können teilweise sehr unangenehme Geruchsbelästigungen entstehen. Zudem kann es zu Haftungsproblemen zwischen den aufzubringenden Materialien kommen. Um den Altuntergrund richtig zu bewerten, muss deshalb bauseits eine Dokumentation der vorliegenden Schichten vorgelegt bzw. eine umfangreiche Analyse veranlasst werden. Dafür hat der Auftraggeber Sorge zu tragen. Bei geplanter Nutzungsänderung ist auch die Tragfähigkeit des zu belegenden Untergrundes durch den Auftraggeber/Planer neu zu bewerten.“
Diese Forderungen im Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sind zwar voll und ganz zu unterstützen, aber leider nur sehr theoretischer Natur. Dokumentationen der vorliegenden Schichten sowie umfangreiche Analysen bei Altuntergründen werden dem Parkett- und Bodenleger so gut wie nie vorgelegt. Weiterhin ist dringend zu empfehlen, die Tragfähigkeit des Altuntergrundes generell neu zu bewerten und nicht erst bei geplanter Nutzungsänderung. Besonders bei Parkettverlegungen auf Altuntergründen hat es diesbezüglich erhebliche Schäden gegeben.
Im bereits zitierten BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau“, Stand März 2014, wird darauf hingewiesen, dass alle Altuntergründe grundsätzlich keine normgerechten Untergründe darstellen. Parkett- und Bodenleger sollten deshalb immer Bedenken anmelden. Das ist sicher richtig, aber auch sehr theoretisch. Wenn ein Boden- und Parkettleger vor der Verlegung auf einen Altuntergrund Bedenken anmeldet, könnte es mit dem Auftrag und dem Bauherrn problematisch werden. Es sei denn, der Bodenleger kann seine Bedenken hinreichend begründen.
Rudolstadt, im August 2016
Wolfram Steinhäuser
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
1. Prüfungen und Eigenschaften von Untergründen
1.1 Einleitung
1.2 Belegereife und ihre Eigenschaften
2. Untergründe bei der Ausführung von Parkett- und Bodenbelagsarbeiten
2.1 Zementestrich/Zementfließestrich
2.2 Calciumsulfat-/Calciumsulfatfließestriche
2.3 DDR-Anhydritestriche
2.4 Sonderestriche
2.5 Steinholz- und Magnesiaestriche
2.6 Kunstharzestriche/Hartstoffestriche
2.7 Schlackeestriche
2.8 Heizestriche
2.9 Schwarze Untergründe
2.10 Trockenunterböden
2.11 Holzwerkstoffplatten
2.12 Holzuntergründe
2.13 Betonuntergründe
2.14 Keramische Fliesen/Naturwerksteinplatten/ Betonwerkstein- und Terrazzoplatten
2.15 Beschichtungen
2.16 Industrieböden aus Reaktionsharzen
2.17 Metalluntergründe
2.18 Systemböden
2.19 Alte Bodenbeläge
2.20 Altuntergründe mit Restklebstoffen und Restspachtelmassen
2.21 Dämmunterlagen/Entkopplungsunterlagen
Literatur-/Quellenverzeichnis
Der Autor
Stichwortverzeichnis
1. Prüfungen und Eigenschaften von Untergründen
1.1 Einleitung
Die Prüfpflichten für Bodenleger werden ausführlich im Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sowie im Kommentar und Erläuterungen VOB DIN 18365 – Bodenbelagsarbeiten behandelt. Hier heißt es übereinstimmend:
„Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken (siehe §4 Nr.3 VOB/B) insbesondere geltend zu machen bei
größeren Unebenheiten,
Rissen im Untergrund,
nicht genügend trockenem Untergrund,
nicht genügend fester, zu poröser und zu rauer Oberfläche des Untergrundes,
verunreinigter Oberfläche des Untergrundes, z.
B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste,
unrichtiger Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes im Verhältnis zur Höhenlage anschließender Bauteile,
ungeeigneter Temperatur des Untergrundes,
ungeeignetem Raumklima,
fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen,
fehlendem Überstand des Randdämmstreifens,
fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen.“
Wichtig und interessant ist hier der Ausdruck „insbesondere“! Dazu heißt es im Kommentar und Erläuterungen VOB DIN 18365 – Bodenbelagsarbeiten:
„Der Ausdruck ‚insbesondere‘ besagt, dass die aufgeführten Mängel des Untergrundes nur als Beispiele zu bewerten sind und dass die Verpflichtung des Auftragnehmers auch für andere, hier nicht aufgeführte Mängel gilt (z.B. das Vorhandensein spezieller, für den Auftragnehmer erkennbarer Trennschichten auf der Oberfläche des Untergrundes, Ausblühungen etc.). Der Auftragnehmer ist zu einer Prüfung des Untergrundes im Rahmen der vorstehend angeführten Beispiele verpflichtet. Die Prüfungen müssen vom Bodenleger mit den ihm zur Verfügung stehenden gewerblichenMitteln und Geräten durchgeführt werden. Dabei ist es wichtig, dass der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung die vorhandene Art des Untergrundes eindeutig angibt, damit sich der Auftragnehmer auf seine diesbezüglichen Sorgfalts- und Prüfpflichten einstellen kann.“
Alles vollkommen richtig, aber wie sieht die Baupraxis aus? Bei Neubauprojekten dürften diese Aussage und Forderung eigentlich kein Problem sein.
Bei Altuntergründen, besonders bei Privatkunden, ist eine solche Forderung illusorisch. Hier erwartet der Auftraggeber, dass der Bodenleger feststellen kann, welcher Untergrund vorhanden ist und wie er hier vorzugehen hat. Im Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten werden die genannten Prüfpflichten ebenfalls relativiert. Hier heißt es:
„Ggf. sind zusätzlich weitere darüber hinausgehende Prüfungen notwendig, um eine schadensfreie Verarbeitung zu gewährleisten (z.B. Prüfung der Wände auf Feuchtigkeit zur schadensfreien Befestigung von Sockelleistensystemen). Zur eigenen Absicherung sollte der Auftragnehmer eine schriftliche Dokumentation der Prüfungen fertigen.“
Auch das ist vollkommen richtig, aber welcher Bodenleger macht das schon? In der Baupraxis kann man schon zufrieden sein, wenn der Bodenleger ein Feuchtemessprotokoll angefertigt hat.
Im Kommentar zur DIN 18356 Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzpflasterarbeiten werden die Prüfpflichten für den Parkettleger wie folgt formuliert:
„Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken (siehe §4 Nr.3 VOB/B) insbesondere geltend zu machen bei
unrichtiger Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes, im Verhältnis zur Höhenlage anschließender Bauteile,
größeren Unebenheiten des Untergrundes als nach DIN 18202 ‚Toleranzen im Hochbau – Bauwerke‘ zulässig,
Rissen im Untergrund, nicht genügend fester, zu poröser, zu rauer oder verunreinigter Oberfläche des Untergrundes,
ungenügenden Bewegungsfugen im Untergrund,
fehlendem Überstand des Randdämmstreifens,
nicht genügend trockenem Untergrund,
nicht genügend trockenen angrenzenden Bauteilen,
fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen,
fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen,
ungeeigneter Temperatur des Untergrundes,
Fehlen von Schienen, Schwellen und dergleichen als Anschlag für das Holzpflaster,
ungeeignetem Raumklima.“
Im Wesentlichen sind die Prüfpflichten für den Bodenleger und den Parkettleger identisch. Zwei abweichende Prüfpflichten beim Parkettleger sind jedoch bemerkenswert. Einmal die Prüfung auf genügend Bewegungsfugen. Die Fugenproblematik ist bei beiden Gewerken häufig Streitpunkt auf der Baustelle. Auch die Feuchteprüfung der angrenzenden Bauteile (vor allem der aufgehenden Wände) ist nicht ganz unumstritten. Zu beiden Prüfpflichten werden deshalb in den folgenden Ausführungen einige Hinweise gegeben.
1.2 Belegereife und ihre Eigenschaften
In unmittelbarem Zusammenhang mit den Prüfpflichten steht der Begriff der „Belegereife“. Unter Belegereife eines Untergrundes versteht man den Zustand eines Untergrundes, der für eine dauerhafte, schadens- und mangelfreie Verlegung/Klebung eines Oberbelages geeignet ist. Die Belegereife beinhaltet die Mangelfreiheit eines Untergrundes im Sinne der genannten Prüfpflichten, aber auch die folgenden Eigenschaften des zu belegenden Untergrundes, die der Parkett- und Bodenleger zwar nicht prüfen muss, die häufig jedoch zu Auseinandersetzungen in der Baupraxis führen:
Festigkeit/Tragfähigkeit/Dicke des Estrichs
Dauertrockenheit
Wandfeuchte
Saugfähigkeit
Fugenausbildung
Schwinden
Oberflächenfestigkeit/Oberflächenbeschaffenheit
Diese Eigenschaften werden in den folgenden Ausführungen näher betrachtet.
1.2.1 Festigkeit/Tragfähigkeit/Dicke des Estrichs
Bei neu eingebauten Estrichen muss und kann der Parkett- und Bodenleger davon ausgehen, dass diese Untergründe mit den erforderlichen Festigkeiten eingebaut sind und somit über die notwendige Tragfähigkeit verfügen. Aber auch hier gibt es Kuriositäten, mit denen Parkett- und Bodenleger konfrontiert werden. Wenn beispielsweise ein neuer Estrich aufgrund mangelhafter Festigkeit und Estrichdicke in Schollen zerbricht und sich diese Schollen im neu verlegten Oberbelag abzeichnen, muss sich der Bodenleger für diesen Mangel rechtfertigen und nicht selten auch dem Architekten erklären, dass er für diesen Schaden keine Verantwortung trägt.
Ein spezielles Kernthema bei der Sanierung von Altuntergründen ist deren Festigkeit und Tragfähigkeit, die in der Regel nie überprüft werden. Dabei altern auch Estriche und verlieren ihre Festigkeit und Tragfähigkeit. Bei zahlreichen alten Estrichen wären zwingend Bestätigungsprüfungen im Hinblick auf Druck- und Biegezugfestigkeit erforderlich.
Bei vielen Altuntergründen wäre die Überprüfung der Tragfähigkeit zwingend erforderlich.
Viele Architekten sehen das nicht so eng. Sie sind der Meinung, der Estrich hat die vergangenen 50 Jahre überstanden, dann wird er wohl auch die Gewährleistungsfrist überstehen. Dabei wird vergessen, dass Prüfungen auf Druck- und Biegezugfestigkeit sowie Haftzugprüfungen keine handwerksüblichen Prüfungen sind. Parkett- und Bodenleger haben nicht die Pflicht, solche Prüfungen vorzunehmen oder durchführen zu lassen. Werden solche Prüfungen erforderlich, muss der Bauherr/Auftraggeber/Architekt diese Prüfungen an dafür autorisierte Einrichtungen bzw. Sachverständige in Auftrag geben. Parkett- und Bodenleger sind im Rahmen ihrer Prüfungs- und Hinweispflicht lediglich gehalten, die Oberflächenfestigkeit der Untergründe daraufhin zu prüfen und zu beurteilen, ob die von ihnen aufzubringenden Verlegewerkstoffe eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingehen. Durch die Untergrundvorbereitung und die Verlegewerkstoffe wird die Estrichkonstruktion/Lastverteilungsschicht nur nach bestem Wissen und Gewissen verlegereif hergestellt. Der Parkett- und Bodenleger kann deshalb für alle Bruchzonen unterhalb der von ihm eingesetzten Verlegewerkstoffe keine Haftung übernehmen. Es sei denn, er war als Planer tätig. Der Boden- und Parkettleger kann lediglich eine oder mehrere Estrichproben aus dem Altestrich herausstemmen und den Estrich gemeinsam mit dem Bauherrn, Architekten oder Bauleiter visuell begutachten und bewerten sowie unverbindliche Hinweise geben – mehr aber auch nicht. Der Bauherr muss dann entscheiden, wie er hier weiter vorgehen will, ob der alte Estrich entfernt und durch einen neuen Estrich ersetzt werden muss oder ob er das Risiko eingeht und auf dem problematischen Altestrich die Verlegung der Oberbeläge verlangt. Bei Estrichen auf Dämmschicht und auf Trennschicht ist übrigens die Druckfestigkeit nicht relevant. Hier ist im Hinblick auf die Bewertung der Tragfähigkeit die Biegezugfestigkeit entscheidend. Aber wer überprüft schon die Biegezugfestigkeit bei der Renovierung bzw. Sanierung von Fußböden? In meiner langjährigen Tätigkeit als Fachberater war mir dieses Erlebnis noch nie vergönnt. Reklamationen betreffend mangelhafter Tragfähigkeit von Untergründen gab es zur Genüge. So wurde beispielsweise ein Gussasphaltestrich in Lagerräumen von einem Bodenleger fachgerecht gespachtelt und der geforderte Belag ohne Beanstandung verlegt. Es wurden Regale aufgestellt, die mit unterschiedlichen Produkten befüllt wurden. Nach geraumer Zeit stellte der Bauherr fest, dass die Regale in den Gussasphalt eingesunken waren. Reklamiert wurde beim Bodenleger, er hätte die Härteklasse des Gussasphaltes überprüfen müssen. Das Gericht hat dann den Bauherrn nach zahlreichen Ortsterminen, Ärgernissen und unnötigen Aufwendungen in seine Schranken gewiesen.
Die Dicke eines jeden Estrichs ist ein ganz entscheidender Faktor im Hinblick auf die Tragfähigkeit. Der Parkett- und Bodenleger muss die Estrichdicke bei mineralischen Estrichen lediglich bei der CM-Prüfung im Prüfloch messen. Wenn er feststellt, dass erhebliche Minder- oder Mehrdicken vorhanden sind, muss er beim Bauherrn Bedenken anmelden. Erhebliche Minderdicken beeinträchtigen die Tragfähigkeit eines Estrichs. Erhebliche Mehrdicken verursachen längere Trocknungszeiten.
1.2.2 Dauertrockenheit
Für jeden Bauherrn, Auftraggeber, Architekten, Bauleiter und Handwerker bedeutet Bauen auch immer „Kampf gegen die Feuchtigkeit“. Über 50 Prozent aller Schäden und Mängel am Bau haben mit Feuchtigkeit zu tun. Das hat sich bei allen am Bau beteiligten Handwerkern herumgesprochen. Trotzdem wird mit dieser Problematik immer wieder sehr leichtfertig umgegangen. Jeder Parkett- und Bodenleger weiß, dass er vor der Ausführung seiner Leistungen die Feuchte des mineralischen Estrichs prüfen muss. Die Prüfung dieser Untergründe muss mittels der CM-Methode erfolgen. Der neueste Stand der Technik zur Feuchtemessung mittels der CM-Methode ist im TKB-Merkblatt 16 „Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung“, Stand März 2016, zusammengefasst. Diese Methode sollte jeder Parkett- und Bodenleger unbedingt kennen.
Bei den CM-Messungen sind folgende Punkte besonders zu beachten:
Jede
CM-Messung
muss in ein Messprotokoll eingetragen werden. Die Angaben in diesem Protokoll sind von einer autorisierten Person auf der Baustelle schriftlich zu bestätigen. Dieses Messprotokoll, der schriftliche Nachweis der Belegereife des mineralischen Untergrundes, hat bei jeder Reklamation, die in irgendeiner Weise mit Feuchtigkeit zu tun hat, den Handwerker aus der Schusslinie der Kritik genommen und ihn von jeglicher Haftung befreit. Leider gehen die Handwerker mit diesem eigentlich sehr einfachen „Hilfsmittel“ sehr fahrlässig und nachlässig um.
Der Verarbeiter muss bei jeder
CM-Messung
auch die Estrichdicke messen und in das Messprotokoll eintragen.
Die erste
CM-Messung
ist vom Parkett- bzw. Bodenleger als Nebenleistung zu erbringen. Alle weiteren
CM-Messungen
sind eine besondere Leistung und somit dem Verarbeiter zu vergüten.
Die
CM-Messungen
müssen unmittelbar vor der Verlegung der Oberbeläge durchgeführt werden.
CM-Messungen
müssen immer an den feuchtesten Stellen durchgeführt werden. Diese Raumbereiche sind beispielsweise fensterlose Raumecken, Bereiche ohne oder zumindest mit wenig Sonneneinstrahlung und geringer Luftbewegungsmöglichkeit. Die feuchtesten Stellen lassen sich beispielsweise mithilfe von elektronischen Messgeräten leicht und zerstörungsfrei aufspüren.
Die Parkett- und Bodenleger haben bei schwimmenden Estrichen den Untergrund nur bis zur abgedeckten Dämmschicht zu prüfen. Bei Estrichen auf Trennschicht muss die Feuchteprüfung bis zur Trennschicht erfolgen. Bei Verbundestrichen ist der mineralische Untergrund bis zur Oberfläche der darunterbefindlichen Tragschicht (Betondecke, Betonbodenplatte) zu prüfen.
Der Feuchtegehalt von Betondecken, Betonbodenplatten, Trockenestrichen sowie Holzwerkstoffplatten muss mittels der Darr-Methode ermittelt und in Masse-% angegeben werden. Die Darr-Prüfung setzt eine Laborausrüstung voraus. Sie ist deshalb keine handwerksübliche Prüfung und braucht von keinem Handwerker durchgeführt zu werden. Sachverständige oder dafür autorisierte Einrichtungen führen Darr-Prüfungen aus. Die Darr-Prüfung ist die genaueste aller Feuchteprüfungen und wird neben der CM-Methode vor Gericht anerkannt. Diese Prüfung kommt vor allem bei Schiedsgutachten, bei Streitigkeiten und bei Unklarheiten sowie dem Wunsch nach genauen Ergebnissen zum Einsatz. Die Holzfeuchtemessung von Dielen erfolgt in der Regel elektronisch.
Die Scheinfugen wurden zu früh verharzt, der Untergrund war noch nicht ausreichend trocken. Es kam zur berühmt berüchtigten Würmchenbildung im elastischen Belag.
Wie prüft man aber beispielsweise den Feuchtegehalt von keramischen Fliesen, Naturwerkstein, Betonwerkstein, Terrazzo, Ziegeln, Kalksandsteinen, Kunstharzbeschichtungen oder die zahlreichen Betonuntergründe wie Leichtbeton, Porenbeton, Schaumbeton, Styroporbeton, Walzbeton, Beton mit Kunststoffzusätzen usw.? Bei welchen Feuchtegehalten sind diese Untergründe belegereif? Dazu gibt es in der gesamten Fachliteratur für Bodenprofis keine Angaben. Man könnte hier wie folgt argumentieren: „Naja, diese Untergründe kommen ja in erster Linie in der Sanierung vor, und da sind sie auf jeden Fall ausreichend trocken.“ Darauf verlassen sich ja auch die meisten Verarbeiter in der Baupraxis, und in den meisten Fällen funktioniert das auch. Trotzdem ist jeder Verarbeiter verpflichtet, auch bei Altuntergründen seiner Prüfpflicht in vollem Umfang nachzukommen. Er kann sich nicht nur darauf verlassen, dass der Untergrund aufgrund der langen Liegezeit ausreichend trocken ist. Falls es zum Feuchteschaden kommt, steht der Verarbeiter voll in der Haftung, wenn er nicht geprüft hat. Deshalb hat sich bei den Verarbeitern erfreulicherweise ein gewisses Sicherheitsdenken durchgesetzt. Das bedeutet, man setzt sogenannte Sicherheits-Reaktionsharzgrundierungen ein und bekommt so die Feuchteproblematik in den Griff – jedenfalls in den meisten Fällen. Beim Einsatz dieser Reaktionsharzgrundierungen müssen allerdings drei Bedingungen erfüllt sein:
Der Untergrund darf nicht feuchtigkeitsempfindlich sein, wie beispielsweise Steinholzestrich und Calciumsulfatestrich,
der Untergrund muss sich im frostfreien Bereich befinden, und
die Reaktionsharzgrundierungen müssen für die Absperrung von Untergrundfeuchte geeignet sein.
Die Verlegewerkstoffhersteller machen dazu die erforderlichen Angaben. Zu Betonuntergründen wird im Kommentar zur DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Stand 2010, Folgendes ausgeführt:
„Bei Betondecken ohne und mit Verbundestrich ist eine aussagefähige Messung des Feuchtegehaltes mit gewerbeüblichen Messgeräten nicht möglich. Die in der oberen Zone des Untergrundes gemessenen Werte lassen keinen Rückschluss auf die Feuchte der Betondecke im restlichen Querschnitt zu. Da bei Betondecken ohne und mit Verbundestrich Trocknungszeiten von einem Jahr und mehr erforderlich werden, sind durch die verbleibende Feuchte in solchen Untergründen Mängel oder Schäden an darauf verlegten Bodenbelägen aller Art nicht auszuschließen. Der Auftraggeber hat deshalb durch geeignete planerische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Feuchte aus dem Untergrund die Verlegewerkstoffe (Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe) und den Bodenbelag nicht beeinträchtigt. Da die Entscheidung über die Art der Ausführung ausschließlich beim Auftraggeber liegt und der Auftragnehmer darauf keinen Einfluss hat, kann dem Auftragnehmer die Verantwortung für Schäden am Bodenbelag durch nachstoßende Feuchtigkeit aus der Rohdecke oder dem Estrich nicht aufgebürdet werden. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden und daraus resultierenden Mängeln an den Bodenbelägen, Sockelleisten, Spachtelmassen u.ä. durch Feuchte aus dem Untergrund sind zwischen den beteiligten Parteien abzustimmen. Die Prüfung der Restfeuchte der Deckenkonstruktion (u.a. der Rohbetondecke) ist keine Prüfpflicht der Bodenbelagsarbeiten.“
Bei den verschiedenen Betonuntergründen hat sich deshalb folgende Vorgehensweise durchgesetzt: Die Untergründe werden kugelgestrahlt, mit einem Industriesauger abgesaugt und anschließend mit einer geeigneten, vom Verlegewerkstoffhersteller empfohlenen Reaktionsharzgrundierung grundiert. In der Regel wird anschließend gespachtelt und der Belag verlegt. Wenn die Betonuntergründe ausreichend planeben sind, kann durchaus mit geeigneten Klebstoffen auf die Reaktionsharzgrundierungen Parkett geklebt werden.
Grundsätzlich muss man zwischen der Untergrundfeuchte unmittelbar vor der Ausführung der Parkett- und Bodenlegerarbeiten und der Dauertrockenheit eines Untergrundes unterscheiden. Für die Prüfung der Untergrundfeuchte ist der Parkett- und Bodenleger verantwortlich. Für die Dauertrockenheit eines Untergrundes ist der Bauherr bzw. sein Planer, Architekt, Bauleiter und im Neubau der Estrichleger verantwortlich. Dazu zwei Beispiele aus der Baupraxis:
Planung und Einbau von Trennlagen auf neu eingebaute Betonuntergründe
Auf die Planung und den Einbau von Trennlagen zur Feuchteabsperrung unmittelbar auf neu eingebaute Betonuntergründe (Stahlbetondecken, Betonbodenplatten) wird häufig verzichtet. Dabei sollte eigentlich jeder Planer und Estrichleger wissen, dass bedingt durch die hohe Restfeuchte der Betonuntergründe ein Dampfdruckgefälle vom Betonuntergrund weg und hin zu den angrenzenden Räumen vorliegt. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, wenn sich beispielsweise unterhalb der neuen Stahlbetondecke Heizleitungen oder andere Wärmeerzeuger befinden. Wer als Planer oder Estrichleger auf den Einbau von zwei Lagen PE-Folie der Dicke 0,2mm oder einer einlagigen PVC-Folie der Dicke 0,5mm