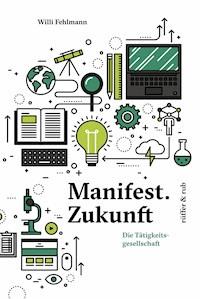
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren fundamental ändern. Unter anderem aufgrund der Digitalisierung werden immer weniger Arbeitskräfte gebraucht und die Sozialsysteme noch mehr unter Druck kommen. Gefordert sind deshalb innovative Entwürfe von Arbeits- und Lebensmodellen, die handlungsleitend für die Gegenwart und die Zukunft werden. Der Autor plädiert für eine neue gesellschaftliche Identität, die Tätigkeitsgesellschaft. Diese Identität muss sich an der Bedarfslogik orientieren und nicht wie bisher an der Leistungslogik der Erwerbsarbeit. Dazu braucht es eine gesellschaftliche Diskussion über den Grundbedarf der Bürgerinnen und Bürger, der durch den Staat sichergestellt werden muss. Grundlagen sind schon viele vorhanden: Share-Ökonomie, Grundeinkommen, Komplementärwährung usw. Fehlmann fügt diese zu einem Gesamtbild zusammen. Sein Ziel: eine Gesellschaft, in der es keine Arbeitslosen, Ausgesteuerten oder andere Empfänger von Sozialleistungen mehr gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsübersicht
Prolog – Wir schreiben das Jahr 2035
Erinnerungen
Lebensentwürfe – 2035
Utopie
Utopie, der Skizzenblock der anderen Geschichte
Das Sein begrenzt die Vorstellungskraft und damit das Wünschen
Privat ist besser – Die Welt des Neoliberalismus
Das Axiom
Der Neoliberalismus ist krisenaffin
Die US-amerikanische Geschichte als eine Wurzel des Neoliberalismus
Die Krise von 1929 – eine verpasste Chance
Der (neoliberale) Zweck heiligt die Mittel: Die Shock Doctrine
Scheingründe für Privatisierungen
Ordnungspolitische Gründe für Privatisierungen
Fiskalpolitische Gründe für Privatisierungen
Die Freizeitgesellschaft – und ihr Ende
Maschinen ersetzen Menschen
Immer weniger Menschen arbeiten weniger – und das Bruttosozialprodukt steigt
Das Ende der Freizeitgesellschaft
Entwicklungsfelder der künstlichen Intelligenz
Gesellschaft am Scheideweg
Der Kapitalismusmotor stottert
Kapitalistisches Abwehrdispositiv
Nochmals: Welche Zukunft wollen wir?
Die solidarische Tätigkeitsgesellschaft
Neue gesellschaftliche Identität durch eine neue Wirtschaftslogik
Grundversorgung
Zentrale Bereiche des neuen Service Public
Laterale Share-Ökonomie als Teil der solidarischen Tätigkeitsgesellschaft
Projekt »Manifest.Zukunft«
Epilog Mai 2018
Anhang
Anmerkungen
Bildnachweis
Dank
Biografie
VORWORT
»Utopie erwächst aus einem das Sein überholenden Bewusstsein«, schrieb der Philosoph Helmuth Plessner. »Out of the Box«-Denken würden wir heute sagen, dies aber radikal. Die »Box«, das ist das reale gesellschaftliche Sein, das sind Probleme wie AHV (Rentenversicherung), Flüchtlinge, Arbeitslosigkeit, die nicht mehr rentierende Energiewirtschaft usw. Die Diskussionen finden allesamt innerhalb der Box statt, das heißt, Politik und Wirtschaft versuchen die Probleme mit denselben Ansätzen zu lösen, mit denen sie geschaffen wurden. Sie wollen das System optimieren, aber die Grenzen des Optimierbaren sind erreicht. Es braucht eine grundsätzliche Neugestaltung, um neue Qualitäten zu entwickeln.
Ich gehöre zu den sogenannten 68ern, was ich als eine Verpflichtung empfinde. Uns waren alle Möglichkeiten offen, aber wir haben es versäumt, eine solidarische Gesellschaft zu entwickeln. Wir haben die Dynamik des neoliberalen Kapitalismus falsch eingeschätzt, und unsere Enkel werden uns dies vorwerfen.
Meine Generation – geboren 1945 – wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den Aufbau Europas hineingeboren und erlebte einen enormen Aufschwung der Wirtschaft und eine rasante Entwicklung neuer Technologien. »Aufbau!« war das Motto unserer Elterngeneration. Zwanzig Jahre später kam die berechtigte Frage, was denn nach dem Aufbau zu tun sei. Es war die 68er-Generation, die Neues suchte, gewohnte Denkmuster störte und Traditionen infrage stellte. Die 1970er- und frühen 1980er-Jahre waren voller neuer Erkenntnisse. Es schien ein Paradigmawechsel absehbar, weg von »immer mehr«, hin zu mehr Lebensqualität und mehr Gerechtigkeit. Themen wie »Waldsterben« oder die »Ölkrise« und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen machten bewusst, dass die natürlichen Ressourcen endlich sind und das Wirtschaftssystem immer anfälliger werden wird. Diese kritischen Aspekte wurden aber sogleich vom wirtschaftlichen Aufschwung, durch den Vietnamkrieg und die sich entwickelnde Globalisierung überdeckt. Die Erfolge der Gewerkschaften und ihre neuen Arbeitsmodelle wurden gefeiert, und das gesellschaftliche System nicht mehr infrage gestellt. »Mehr« war bereits wieder Mainstream. Es galt, die globale Welt als Marktchance zu nutzen. Die nun nicht mehr so junge 68er-Generation hatte diese globale Wirtschaftsentwicklung weder antizipiert noch verhindert. Im Gegenteil, viele von uns waren später in Schlüsselfunktionen und gestalteten diese Entwicklungen mit. Die Folge waren und sind wirtschaftliche Krisen und eine Entsolidarisierung der Gesellschaft.
Heute stehen wir an der Schwelle einer technologischen Entwicklung, wie wir sie seit der industriellen Nutzung der Dampfmaschine und der Erfindung des Verbrennungsmotors nicht mehr erlebt haben. Diese gegenwärtige Entwicklung wird die Gesellschaft in ihren Grundfesten verändern, oder wie Ray Kurzweil meint, dass die nächsten hundert Jahre in ihrer Dynamik den 20 000 vorherigen entsprechen werden. Damals lebten die Menschen noch in Höhlen. Die Optimierungsrituale haben sich überlebt. Es gilt, einen neuen Diskurs zu starten. Wenn dies nicht gelingt, wird die soziale Ungleichheit wachsen und damit der fruchtbare Boden für soziale Unrast geschaffen.
Mein Anliegen ist es aufzuzeigen, dass es Alternativen gibt. Darum entwickle ich in dem Buch eine Realutopie, eine Utopie, die sich verwirklichen lässt. Mir reicht es nicht, Optimierungen heutiger Modelle (etwa der Rentenversicherung AHV) zu diskutieren. Ich entwickle vielmehr einen ganzheitlichen Ansatz in einem wahrscheinlichen Szenario einer künftigen Gesellschaft.
Noch ein Hinweis zur Lektüre: Die verschiedenen Teile sind über einen längeren Zeitraum und aus verschiedenen Anlässen entstanden und nicht immer direkt verbunden. Darum können die Teile auch für sich gelesen werden.
INHALTSÜBERSICHT
I. Utopie
Wir müssen die Zukunft neu denken. Die Sparprogramme und Optimierungen der Sozialsysteme kommen an ihre Grenze, und die soziale Ungleichheit wächst weltweit. Es herrscht generell die Meinung, dass es keine Alternativen gibt. In diesem Teil erinnere ich an die Funktion einer Realutopie und stelle dar, wie sich die Vorstellungskraft und damit das Wünschen in unserer Gesellschaft entwickelt hat. Dabei wird deutlich, dass sich die Inhalte der Wünsche verändert haben, aber das jeweilige Sein, die gesellschaftliche Situation immer den Horizont der Zukunftsentwürfe bestimmt. Waren es früher Religion und Ständeorganisation, so sind es heute der Konsum und die Ökonomisierung der Gesellschaft, die die Vorstellungskraft des Individuums begrenzen.
II. Privat ist besser – Die Welt des Neoliberalismus
In diesem Teil habe ich einige Aspekte meiner Schrift »Privat ist besser« integriert und weiter ausgeführt. Leider hat sich die liberale Utopie einer freiheitlichen Gesellschaft zu einer Doktrin der freien Wirtschaft gewandelt. Es entstand ein ökonomischer Freiheitsbegriff, der alle anderen gesellschaftlichen Systemteile dominiert. Der Staat soll sich aus dem Wirtschaften heraushalten, außer man braucht Steuergelder zur Stützung von Wirtschaftsteilen. Damit ist im Kern ein antidemokratischer Ansatz formuliert. Die heute extremste (oder reinste) Form des Neoliberalismus ist die Uber-Ökonomie, eine Share-Ökonomie, in der es nur noch Selbständige gibt, die sich gegeneinander durchsetzen müssen. Parallel dazu entwickeln sich Monopolisten, die Information, Produktion und Distribution beherrschen wollen.1 Diese Monopolisierungstendenz ist im Prinzip eine antikapitalistische Entwicklung, gegen die sich der Neoliberalismus gewehrt hat.
III. Die Freizeitgesellschaft – und ihr Ende
Es ist gelungen, die Arbeitszeit in den letzten 150 Jahren von 80 auf 35 Stunden zu reduzieren und gleichzeitig das Bruttosozialprodukt zu steigern. Das war die Realutopie der Freizeitgesellschaft: Man arbeitet ganz wenig und kann sich die Freizeit leisten. Als Gesellschaft können wir uns auch ein komfortables Sozialsystem leisten. Ein Sozialsystem, das in Europa Millionen von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern finanziert. Es ist aber auch eine Gesellschaft der sozialen Ungleichheit, der Diskriminierung entstanden. Wer nicht erwerbstätig ist, ist auch kein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Diese Einstellung hält sich hartnäckig. Die technologischen Entwicklungen werden in naher Zukunft die Arbeitswelt, aber auch die Gesellschaft stärker verändern als die Einführung der Dampfmaschine und des Verbrennungsmotors. Das waren vor allem physische Ergänzungen der menschlichen Fähigkeiten, nun werden kognitive Fähigkeiten ergänzt. Die Konsequenzen können wir erst erahnen, es wird aber ein Übergang zu einem neuen Zeitalter sein. Die traditionelle Arbeit wird nicht überflüssig, aber die Menschen werden kaum noch involviert sein. Künstliche Intelligenz wird die Arbeitsplätze ablösen. Das ist das Ende der Freizeitgesellschaft, denn Freizeit gibt es nur, wenn man Erwerbsarbeit hat.
Die meisten Menschen werden sich die Freizeit noch weniger als heute leisten können, und sehr viele werden überhaupt keine Erwerbsarbeit mehr finden. So löst sich der Dualismus von Arbeitszeit mit Beitrag zum Bruttosozialprodukt und Freizeit, finanziert durch Arbeit, auf.
Diese Entwicklung widerspricht allen Erfahrungen der Vergangenheit, und es besteht die Gefahr, dass man Lösungen sucht, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, die aber die Probleme nicht lösen werden.
In diesem Kapitel stelle ich auch dar, wie die Parameter des Kapitalismus ins Wanken geraten. So zum Bespiel: Wenn die Gestehungskosten gegen null sinken, gibt es keinen Preis mehr, und Profit ist kaum mehr möglich. Es ist spannend, die strategischen Abwehrmechanismen der großen Firmen zu diskutieren.
IV. Die solidarische Tätigkeitsgesellschaft
Wir brauchen einen realutopischen Entwurf der Gesellschaft. Die Entwicklung ist disruptiv, es wird eine völlig neue gesellschaftliche Situation entstehen, in der die gewohnten Annahmen zu falschen Lösungen führen. Darum entwerfe ich ein Bild einer Gesellschaft, in der sich die Menschen nicht mehr über Erwerbsarbeit definieren, sondern ihre Identität über sinnvolle Tätigkeiten finden. In diesem Entwurf hat die Erwerbsarbeit mit ihrem Beitrag zum Bruttosozialprodukt (BSP) eine wichtige Funktion, aber nicht mehr die heutige Dominanz. Es ist eine Gesellschaft, in der es keine Arbeitslosen, Ausgesteuerten, Harz-IV-Empfänger oder andere Empfänger von Sozialleistungen mehr gibt. Voraussetzungen dazu sind die Entmystifizierung des BSP, ein neuer Service Public (Grundversorgung) und eine Sozialisation zur Selbstgestaltung.
V. Projekt »Manifest.Zukunft«
In diesem Teil wird das Projekt »Manifest.Zukunft« vorgestellt. Es soll eine Plattform aufgebaut werden, auf der sich die verschiedenen Netzwerke austauschen können.
Epilog Mai 2018
Das Manuskript wurde Ende 2016 fertig geschrieben. Inzwischen hat die disruptive Entwicklung weiter an Fahrt zugenommen. Immer mehr Befugte und Unbefugte sprechen über die Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. In diesem Kapitel wird auf Basis der neusten Informationen nochmals auf die Arbeitsmarktsituation und das Schlagwort »Digitalisierung« eingegangen und in diesem Zusammenhang auch das Thema »Produktivität« aufgegriffen.
Prolog – Wir schreiben das Jahr 2035
Die Zeit läuft, was jetzt noch »Zukunft« ist – ist jetzt »Gegenwart« und jetzt schon »Vergangenheit«.
ERINNERUNGEN
Erinnern Sie sich noch an die bürgerliche Phase ab 2015? Von 2012–2015 legte die Schweizer Nationalbank eine Franken-Obergrenze fest. Das war eigentlich ein kleiner Wirtschaftskrieg, so eine Art Heimatschutzaktion. Die Unternehmen konnten sich von der Finanzkrise 2008 erholen und sich auf die Aufhebung des Frankenschutzes vorbereiten. Es war allen klar, dass diese Maßnahme nicht über viele Jahre durchgehalten werden konnte. Der Schutz wurde 2015 zu teuer und darum aufgehoben. Nun war des Wehklagens kein Ende. Der starke Franken war in der Folge an allem Unbill schuld. Die Unternehmer begründeten damit Verlagerungen von Unternehmensteilen ins Ausland und Stellenabbau. Einige Branchen ersuchten um staatliche Unterstützung in Form von geringeren Mehrwertsteuern oder Subventionen. All dies wurde vom Volksvermögen bezahlt. Das war und ist die Ambivalenz des Neoliberalismus: Man braucht keinen Staat, außer es geht Firmen oder Branchen nicht gut, dann muss der Staat dieses Marktversagen ausgleichen.
Es war auch die Zeit der Entstehung des absoluten Neoliberalismus: jeder gegen jeden. Die Bürgerlichen dominierten alle Gremien im Parlament und Dornröschen SP versuchte mit Päckli-Politik2 zu retten, was zu retten war. Die Gewerkschaften kämpften für einen besseren Kündigungsschutz, und die Wirtschaftsfachleute der SP forderten mehr Ausbildung.
Internationale Experten sagten voraus, dass eine technologische Revolution bevorstünde, die viele Arbeitsplätze vernichten würde. Doch in der Schweiz war man sich einig, dass die Unkenrufe Übertreibungen seien. Aus der Erfahrung wusste man, dass bisher jede technologische Entwicklung positiv genutzt werden konnte. Es waren immer wieder neue, wenn auch andere Arbeitsplätze entstanden.
Die Share-Ökonomie wurde positiv bewertet. Das Versprechen, dass sich alle selbständig machen und sich im freien Markt anbieten können, ging von einem unendlichen Markt für persönliche Dienstleistungen aus. Damals führten der Personenbeförderungsdienst Uber und die Unterkunft-Vermietungsplattform Airbnb zu großen Diskussionen. Der Staat meinte, Uber sei ein Arbeitgeber, der auch Sozialleistungen bezahlen müsste. Uber definierte sich logischerweise als Plattformanbieter. Hier konnte sich jedermann als Fahrer einloggen, wenn er gewisse Kriterien erfüllte. Uber verglich sich mit Ricardo und anderen, damals bekannten Marktplatz-Plattformen, bei denen auch niemand auf die Idee kam, es seien Arbeitgeber. Zu dieser Zeit wurde auch die Idee eines Grundeinkommens an der Urne verworfen. Zwar war sich die Parteien von rechts bis links einig, dass die Sozialsysteme neu überdenkt werden müssen, aber über die Maßnahmen hatten sie unterschiedliche Ansichten. Rechts vertraute auf die Marktkräfte und den Individualismus, links hatte keine bessere Idee, als dagegen zu sein.
In den folgenden Jahren spitzte sich die Situation zu. Es gab immer mehr Erwerbslose. Schon im Januar 2016 verkündete 20 Minuten – damals ein Gratisblatt – »12 000 Industriejobs weg seit Mindestkurs-Aus«. Die Bank Credit Suisse kündigte Stellenabbau an, so auch die Pharmakonzerne Novartis und Roche sowie viele andere Großfirmen.
Es kamen auch Signale vom Arbeitsmarkt in den USA. Dort hatte man die Zahl der Arbeitsplätze gesteigert, aber eigentlich entstanden fast nur noch Teilzeit- und sogenannte Minijobs. Das war ansatzweise bereits in Europa so. Darum konnte 2015 der Autohersteller Volkswagen 700 Leiharbeiter ohne Kostenfolgen entlassen. Die Unkenrufe verdichteten sich. Von der Technologiefront kam die Meldung, dass man 50% der Arbeitsplätze abbauen könnte. Nun war allerdings nicht mehr nur die Industrie betroffen, wo Industrie 4.0 (die Anwendung von intelligenten Algorithmen) voll im Gange war, sondern auch Büroarbeiten. Die Forschung sagte, dass alle Mitarbeitenden überflüssig würden, die irgendeine gut beschreibbare Arbeit ausführen, also etwa Formulare ausfüllen, disponieren, buchen. Man nahm an, dass nicht nur die Industriehallen ohne Menschen auskommen werden, sondern auch die Büros. Man hätte durchaus schon vorhandene Erfahrungen einbeziehen können: Im Einzelhandel diskutierte man um 2010 die Entwicklung des Internetverkaufs und meinte, dass dieser in den nächsten Jahren kaum zunehmen würde. Darum baute man munter weitere Shoppingcenters, die dann allerdings leer standen.
In der Schweiz war die vorherrschende Meinung noch immer, dass alles halb so schlimm werde. Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machten gar nichts, andere optimierten ihre Prozesse. Die Großfirmen bauten da und dort Arbeitsplätze ab, aber alles sozialverträglich. Die Politik senkte die Steuern für Unternehmen. Die Gewerkschaften halfen mit, sich selber aufzulösen, indem sie mehr Arbeitsplatzsicherheit und höhere Löhne forderten und damit Investitionen in neue Technologien rentabel machten. Es gehörte auch zur vorherrschenden Meinung, dass die Digitalisierung nicht die massiven Auswirkungen haben würde, da schon lange immer mehr Computer im Einsatz seien und die Produktivität damit nicht gesteigert wurde.
Zwischen 2020 und 2025 setzte eine exponentielle Entwicklung ein. Die Arbeitslosenzahlen explodierten, und Jugendliche fanden kaum noch Arbeit. Das duale Ausbildungssystem, lange weltweit bewundert, hatte ausgedient. Die Innovationen durch künstliche Intelligenz – neue Roboter und Applikationen – folgten in immer kürzeren Abständen und wurden immer schneller produktiv. Die Firmen verbesserten die Produktivität enorm und steigerten so die Gewinnausschüttungen für die Aktionäre und das Management. Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) hingegen konnten die Leute nicht mehr vermitteln, und die meisten gingen schon gar nicht mehr hin. Diese Institution wurde später abgeschafft. Nun waren alle Arbeitnehmenden im freien Markt auf sich gestellt.
Die bürgerliche Mehrheit im Parlament setzte regelmäßig Steuerreduktionen durch. Dividenden wurden nicht besteuert, der Kapitaltransfer blieb frei, die Erbschaftssteuer wurde reduziert, ebenso die Unternehmenssteuern. Der Staat wurde so systematisch geschwächt.
Da man die Steuergelder nur von der Mittelschicht nahm, verarmte diese ähnlich wie in den USA. Nur noch etwa 10% der Erwerbstätigen konnten ihr Einkommen in der Schweiz steigern und Vermögen bilden. Die Prämien der Krankenkassen stiegen stetig und konnten von 50% der Bevölkerung nicht mehr ohne staatliche Unterstützung bezahlt werden. 50% der RentnerInnen brauchten gleich nach der Pensionierung Ergänzungsleistungen. Das Sozialsystem kollabierte.
Der Staat brauchte Geld, und die liberale Fraktion sah die Lösung in immer mehr Privatisierung. So wurden Spitäler, Schulen, Universitäten privatisiert, gekauft von internationalen Konglomeraten aus Investoren und Unternehmen. Swisscom wurde verkauft und die SBB aufgeteilt. Internationale Stromfirmen übernahmen die maroden Energiefirmen der Schweiz. Aus der Versilberung der Firmen entstand kurzfristig Liquidität, die Gewinnverluste wurden unter den Teppich gewischt.
Nun zeigte sich ein Phänomen, das einzelne Wirtschaftswissenschaftler schon 2015 und früher vorausgesagt hatten. Man hatte hoch produktive Unternehmen generiert, aber es war zu wenig Geld da zum Konsumieren. Es war, als hätte man einen Ferrari, aber könnte sich das Benzin nicht leisten.
Um 2020 aktivierten diese Entwicklungen eine Gruppe von vernünftigen Leuten aus Zivilgesellschaft und Politik. Sie organisierten sich über Plattformen als eine sozialpolitische Bewegung. Da es der ehemals mittelständischen Bevölkerungsschicht wirklich schlecht ging, konnte sich diese Bewegung zu einem Mainstream entwickeln. Man könnte dies mit dem Erfolg der Gewerkschaften im 20. Jahrhundert vergleichen. Damals waren die Arbeitsverhältnisse so schlecht, dass sich die Arbeitenden organisierten und viele Verbesserungen erkämpften.
Diese sozialpolitische Bewegung warnte vor einer Brasilianisierung der Gesellschaft – die ansatzweise schon da war: eine zunehmende soziale Ungleichheit, eine Unübersichtlichkeit und Unsicherheit von Arbeits-, Biografie- und Lebensformen, wie sie in Brasilien schon lange herrschten.3
Das Ziel der Bewegung war, eine solidarische Tätigkeitsgesellschaft zu verwirklichen, in der die Erwerbsarbeit nur noch eine Tätigkeit unter vielen ist, also nicht mehr allein identitätsstiftend ist. Neben einer lateralen Shareökonomie sollte ein Sockel von Grundleistungen, ein neuer Service Public geschaffen werden, der ein würdiges Leben ermöglichen sollte. Man wollte keine »Ausgesteuerten«, »Arbeitslosen«, »Sozialhilfeempfänger« mehr, sondern eine solidarische Gesellschaft, in der alle ihren Platz finden können. Zu Beginn wurden die Themen dieser Bewegung von der neoliberalen Fraktion stark kritisiert. Man warf ihr Sozialismus und Kommunismus vor. Doch die Unternehmen erkannten auch, dass sie wieder Kaufkraft schaffen mussten, damit sie ihre Produkte verkaufen konnten.
Es begann ein Kampf für den freien Zugang zu allen Bildungsinstitutionen, für ein Grundeinkommen, freie Grundversicherung und günstigen Wohnraum. Hatte man 2015 noch für ein isoliertes Grundeinkommen geworben, wurde jetzt ein Paket geschnürt, das alle Forderungen von »Solidarische Schweiz« bündelte. In den folgenden Jahren setzte sich die Erkenntnis immer mehr durch, dass nicht die Finanzierung für die Umsetzung der Ziele ein Problem darstellte, sondern der kulturelle Wandel. Die Neudefinition der bürgerlichen Identität stellte das Haupthindernis dar. Da jetzt Maschinen mit Maschinen die Produktivität schafften, waren die Menschen zunehmend damit überfordert, da sie sich nicht mehr über ihre Arbeit und Jobhierarchien definieren konnten.
Neue Steuermodelle wurden entwickelt, die Einkommens- und Vermögensverteilung so regelten, dass alle BürgerInnen eine existenzielle Grundlage bekamen und der Staat seine Investitionen finanzieren konnte. So fand man Lösungen wie die 2018 noch belächelte Mikrosteuer auf alle digitalen Transaktionen.
Es entwickelte sich eine Art dritter Weg: ein im eigentlichen Sinne liberales Wirtschaftssystem, in dem jede und jeder sich betätigen konnte, sei es im Arbeitsverhältnis, Auftragsverhältnis oder in einem Nicht-Lohn-Bereich. In einem Parallelmarkt außerhalb des Bruttozialprodukts entstanden viele Komplementärwährungen, die das finanzielle System stabilisierten. Spitäler, Bildungsinstitutionen und andere Anbieter von Grundleistungen (Swisscom, SBB, Post) wurden in Not-for-Profit-Organisationen umgewandelt. An den Universitäten schaffte man all die Bologna-Artefakte ab.
Der Staat wurde mehr und mehr zurückgedrängt, da man viele Verwaltungsbereiche nicht mehr brauchte. Die vielen Krankenkassen verschwanden, Versicherungen wurden zu einem Luxusgut, obligatorische Pensionskassen und AHV/Rentenversicherungen wurden überflüssig. So sparte man Milliarden. Das war ja auch gleichzeitig die Idee der neoliberalen Fraktion. Im Prinzip wurde nun wirklich jeder seines Glückes Schmied. Nur, Glück wurde nicht mehr einseitig materiell als Lohneinkommen definiert. Erwerbsarbeit war nicht mehr der Hauptpfeiler der Identität.
LEBENSENTWÜRFE – 2035
Franz, 20-jährig
Franz ist 2015 geboren. Seine Eltern, geb. 1986, haben bei einer Großbank gearbeitet und wurden kurz vor seiner Geburt arbeitslos. Ein Schock, da man das überhaupt nicht erwartet hatte. Sie waren aber gut ausgebildet und bekamen noch eine gute Abfindung. Diese, plus ihre private Altersvorsorge, nutzten sie, um sich selbständig zu machen. Sie wollten nicht den demütigenden Prozess der Arbeitslosenversicherung durchlaufen. Sie machten damit, was 2015 noch 40 829-mal gemacht wurde. So viele Firmengründungen gab es. Sie hofften, dass sie ihre Bankkenntnisse privat anbieten könnten. Leider mussten sie dann aber erleben, dass Private sich schon damals über verschiedene Plattformen informieren konnten, das heißt, sie brauchten kaum noch Finanzberatung. Auch über Steuern konnte man sich im Internet gut informieren, und Firmen hatten ihre eigenen Möglichkeiten. Der Markt war also sehr eng. Die Eltern von Franz wurstelten sich dann mit vielen verschiedenen kleinen Jobs durch, allerdings ohne Alterssicherung oder Arbeitsausfallversicherung. So kamen sie 2020 zur Bewegung »Solidarische Schweiz«. Sie waren desillusioniert über die »freien« Möglichkeiten im alten System und setzten sich für eine andere Zukunft für Franz ein.
Franz, ein guter Schüler, der vor einem Jahr die Matura mit Bravour bestanden hat, wird an der ETH Artificial Intelligence studieren. Wie viele seiner Generation will er aber zuerst mal die Welt bereisen. Das kann er selbstbestimmt tun, denn seit er 18 ist, erhält er den Erwachsenenbetrag des Grundeinkommens. Er bekommt auch noch etwas »Startkapital« dazu, da die Eltern einen Teil seines Kindergrundeinkommens für ihn gespart haben.
Jetzt ist er wieder zurück und hat sich an der ETH immatrikuliert. Die heutige Grundversorgung mit Grundeinkommen und kostenloser Bildung erlaubt ihm ein konzentriertes Studium. Da er sich nicht um die Finanzierung des Alltags kümmern muss, kann er seine Interessen ganz auf die Fachgebiete konzentrieren. Es ist abzusehen, dass er einige Jahre am MIT (Massachusetts Institute of Technology) und anderen für sein Fachgebiet wichtigen Unis arbeiten wird. Für ihn ist es bereits absurd, dass man studiert, um eine hohes Gehalt zu erreichen. Er will einen Beitrag zur Gestaltung der Welt leisten und darum forschen und entwickeln.
Franziska, 30-jährig
Franziska hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und im Bereich Finanzwirtschaft promoviert. Sie hat Praxislabs bei einem Finanzdienstleister gemacht, der sie dann auch eingestellt hat. Heute ist sie bereits als Abteilungsleiterin tätig und verdient über CHF 120 000.
Sie findet die heutige Organisation der Tätigkeitsgesellschaft super. Es gibt keine Nachteile für ihre Karriere. Es könnte auch sein, was jetzt noch weit weg ist, dass sie doch noch Kinder haben wird, und es ist beruhigend zu wissen, dass auch dann durch das Grundeinkommen für sie gesorgt ist. Sie oder ihr Partner könnte dann auf 50% Erwerbsarbeit reduzieren.
Erich, 40-jährig
Erich hat Bauzeichner gelernt und ist 2019 arbeitslos geworden. Er durchlief alle Stadien der Arbeitslosigkeit: RAV, Vermittlungsversuche, Zusatzausbildungen … Später fand er eine Stelle als Logistiker, wurde aber wieder wegrationalisiert, worauf der RAV-Prozess wieder einsetzte. Seit 2025 lebt er als »Ausgesteuerter« vom Sozialamt. Er musste in eine ganz einfache Wohnung umziehen und kann sich kaum etwas leisten. Die Bevormundung durch das Sozialamt ist für ihn eine große Belastung. Zum Glück hat er eine Freundin, die bis 2025 bei der Migros an der Kasse arbeitete, dann aber auch wegrationalisiert wurde. Es braucht niemanden mehr an der Kasse, die Waren werden automatisch gescannt und über das Smartphone abgebucht.
Seit der Einführung der Grundversorgung hat das Elend ein Ende. Erich und seine Freundin können nun selbstbestimmt leben, sie sind nicht mehr stigmatisiert durch Arbeitslosigkeit. Toll ist auch, dass sie in einer Siedlung leben, die eine Alternativwährung eingeführt hat. Er betreibt nun mit seiner Freundin zusammen einen 3D-Druckershop in der Siedlung. Bezahlt wird mit der internen Währung.
Nicole, 50-jährig
Nicole arbeitet als Pflegefachfrau und Stationsleiterin an einem Kantonsspital. Sie hat die ganze Ökonomisierung der Spitäler miterlebt und ist froh über die Veränderungen in den letzten Jahren. Der Leistungsdruck hat nachgelassen, und die Unterstützung durch neue Technologien ist sehr positiv. Nun können sich die Pflegefachleute wieder vermehrt den PatientInnen zuwenden.
Sie selbst spürte, dass ihr der Job als Stationsleiterin zu anstrengend wurde. Da sie aber alleinerziehend ist, hatte sie keine Wahl. Nun, mit der Einführung der Grundversorgung kann sie neu wählen.
Sie entscheidet sich, dass sie noch zu 60% als Pflegefachfrau arbeiten und sich die übrige Zeit in der Politik im Dorf engagieren will. Susanne, eine Freundin von Nicole im selben Alter, entscheidet sich für ihre Hobbys Malen und Fotografieren. Endlich kann sie diese vertiefen. Sie kann mit dem neuen Service Public leben, einfach allerdings, aber ohne Existenzängste. Hilfreich ist auch, dass man im Quartier eine Komplementärwährung entwickelt hat. So kann sie ihre Produkte auch in diesem Kreis anbieten.
Das wurde erreicht
Die heutige Grundversorgung ist ein Fortschritt, der mit den Erfolgen der Gewerkschaften im 20. Jahrhundert vergleichbar ist. Da wurde eine Arbeitszeitreduktion von 80 auf 40 Stunden erreicht, und die Bedingungen am Arbeitsplatz wurden immer wieder verbessert. Das wurde erreicht, obschon die soziale Marktwirtschaft eigentlich gegen alle neoliberalen Prinzipien eingeführt wurde. Die Unternehmen hatten gelernt, wie sie damit umgehen konnten, und die Angestellten profitierten eine lange Phase.
»Solidarische Schweiz« hat erreicht, dass die Sparorgien der Zeit um 2010 beendet wurden, Unternehmen florieren und Bürger-Innen mit selbstbestimmten Perspektiven leben können.
I. Utopie
UTOPIE, DER SKIZZENBLOCK DER ANDEREN GESCHICHTE
Die utopische Funktion ist der Skizzenblock der anderen Geschichte. Skizzen des Guten, des Besseren; Skizzen einer Gesellschaft, in der Menschen ohne Existenzängste leben können. Dem entgegen steht die reale gesellschaftspolitische Situation. Das System, in dem die Menschen konkret leben. Da ist kein Platz für die Utopie des Besseren, da herrscht die Realpolitik, in der es keine Alternativen gibt, wie schon Margaret Thatcher sagte und heute Angela Merkel immer wieder betont.
»Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt«,4 so drückte es Karl Marx 1859 aus. Das gesellschaftliche Sein, das ist die Realität des Alltags. Und doch gibt es immer wieder Menschen und auch geschichtliche Phasen, in denen das andere als möglich aufscheint. So war es in den 1970er-Jahren und, erstaunlicherweise, auch schon im Mittelalter.
Im 13. Jahrhundert erkannten die Mönche, dass das Sein, die tägliche Realität das Bewusstsein prägt. Darum regelten sie alles. Sie wollten im Orden ein bestimmtes Bewusstsein und gestalteten das Sein entsprechend (wir würden heute von Environment Engineering sprechen): Der Tagesablauf, die Bauweise, das Essen, alles war normiert, und alle mussten sich daran halten.
Die Mönche erkannten noch etwas Grundsätzliches: Das Zusammenleben muss auf der Bedarfslogik und nicht auf der Leistungslogik aufbauen. Es ist nicht die Frage, wie viel jemand leistet und welchen Lohn er dafür bekommen soll, sondern, was jemand braucht, um sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können und seine Existenz zu sichern. Es war den Mönchen ein Grundanliegen, die Armut zu überwinden und allen ein bedarfsgerechtes Leben zu ermöglichen.
Das sind ganz frühe, utopische Ansätze, die in den Orden auch gelebt wurden. Diese Konzepte waren allerdings noch in ein religiöses System eingebettet, in dem das Diesseits nur als Vorbereitung auf das Jenseits gedacht wurde. Die Mönche wollten den Grundbedarf decken, das Jenseits wird dem Christen ja geschenkt! Durch Leistung kann man nicht in den Himmel kommen. Umso erstaunlicher ist es, dass gerade das christliche Abendland die extremste Leistungslogik entwickelt hat.
Ich bin kein Kenner des Mittelalters. Die Darstellungen von Ferdinand Seibt finde ich in diesem Zusammenhang aber enorm spannend.5 Seibt zeigt auf, dass es vor und zur Zeit von Thomas Morus (1478–1535), dem Londoner Großbürger und Autor von »Utopia«, verschiedene utopische Entwürfe einer anderen Gesellschaft gab.
Hans Hergot6 (hingerichtet 1527) war einer dieser frühen Utopisten. Er schrieb auf Deutsch und war nicht so gebildet wie Morus, dessen Werk auf Lateinisch erschien. Die von Hergot entwickelte Staatsphilosophie war für das damalige Bewusstsein revolutionär. Er entwarf eine Gesellschaft, in der alle gleich sind (fast, denn wie später auch bei Marx und den Gewerkschaften, war die Frau nicht als politisches Wesen gemeint). Damit löste er utopisch die ständische Gesellschaft auf. Um dies zu erreichen, forderte er Bildung für alle, auch für die Mädchen; sie sollten die Männer unterstützen können – immerhin.
Revolutionär war auch, dass Hergot eine diesseitige Utopie entwarf und so den religiösen Dreischritt überwand: Paradies – Tal der Tränen – Himmelreich. Er postulierte, dass das Hier und Jetzt für sich genommen wichtig sei und nicht nur eine Prüfung für das Jenseits darstelle.
Nur am Rande sei bemerkt, dass er, im Gegensatz zu Marx, keinen Umsturz von unten annahm. Es scheint fast, als hätte er das Wesen des Kapitalismus erfasst, wenn er schreibt: »Es sind drey Tisch inn der Welt | der erst vberflüssig und zuviel darauf | Der ander mittelmessig unnd eyn bequeme notturfft | Der dritte ganz notdürftig.« Er kommt zu einem überraschenden Schluss: Es gibt nicht den Aufstand der Armen, sondern die Reichen greifen an: »Do seyn kommen die von dem vberflussigen tisch vnnd wollten nemen von dem wenigern tische das brodt. Hieraus erhebt sich der kampf.«
Hergot war überzeugt, dass Gott sowohl den überflüssigen wie auch den notdürftigen Tisch umstoßen wird. Anscheinend reichte die Vorstellungskraft noch nicht so weit, dass er den Leuten empfahl, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Das war noch Gottessache.
Erst durch die Aufklärung wurde das utopische Denken sanktionsfrei möglich. Leider haben sich seither immer wieder neue Ideologien oder Religionen etabliert, die diese Funktion des Wünschens, der Vorstellung einer besseren Welt auf das real möglich Scheinende limitierten. So haben die vielen zivilisatorischen Errungenschaften zu immer neuen Herrschaftsformen geführt, und die andere Welt blieb eine erträumte Möglichkeit. Wenn allerdings heute Fans an einer Veranstaltung Beethovens »Ode an die Freude« mitgrölen, dann träumen sie nicht mehr von der besungenen »Tochter aus Elysium«. Sie sind nur in dieser Welt des Jetzt, und ihr Bewusstsein ist leerer als dasjenige eines mittelalterlichen Bauern, der noch eine religiöse Hoffnung hatte. Zum besseren Verständnis dieser kritischen Bemerkung die folgenden Ausführungen.
DAS SEIN BEGRENZT DIE VORSTELLUNGSKRAFT UND DAMIT DAS WÜNSCHEN
»Utopie erwächst aus einem das Sein überholenden Bewusstsein.«7 Helmuth Plessner
Die gesellschaftliche Realität bestimmt das Bewusstsein und begrenzt so die Vorstellungskraft und damit das Wünschen. Darum kann man sich keine andere Gesellschaft vorstellen, und die Wünsche beziehen sich immer auf den gegebenen Spielraum. Um zu einer Utopie zu kommen, braucht es die Fähigkeit, die gesellschaftlichen Systemgrenzen zu überwinden und Vorstellungen zu entwickeln, die diese Grenzen der gegenwärtigen Verhältnisse sprengen. Das meinte Plessner in obigem Zitat.
Im Folgenden stelle ich in groben Zügen dar, wie sich durch die gesellschaftliche Entwicklung die Vorstellungskraft erweitert hat und mehr Wünschen möglich geworden ist; wie aber die realen Verhältnisse immer wieder Grenzen setzen und die Entwürfe für eine andere Zukunft auf das Vorhandene beschränken. Diese Beschränkungen haben immer neue Herrschaftsverhältnisse ermöglicht, und diese haben wiederum die Beschränkungen definiert. Überschreitende Ansätze sind Randphänomene geblieben, von Hergot im Mittelalter bis heute.
Bei uns in Europa lässt sich eine Entwicklung der Gesellschaft zu immer höherer Komplexität verfolgen. Das gesellschaftliche System wird differenzierter und damit komplexer. Diese zunehmende Komplexität verspricht mehr Entscheidungsfreiheit und mehr Freiraum für Wünsche. Die Kehrseite davon ist, dass man sich entscheiden muss, weil kaum etwas gegeben ist. Das ist für viele eine Überforderung. Diese Entwicklung dauert schon seit Jahrhunderten, mit fließenden, überlappenden Übergängen. Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung verläuft gemäß des Soziologen Niklas Luhmann von einer segmentierten über eine stratifizierte hin zu einer offenen, pluralistischen Organisation. Regional finden wir aber die verschiedenen Komplexitätsstufen nebeneinander, was immer wieder zu gesellschaftlichen Konflikten führt.8 Man denke nur an das Frauenbild der verschiedenen Kulturen.
Theoretisch ist die Funktion von Komplexität enorm spannend. Darwins Aussage, dass »the fittest« sich durchsetze, ist Allgemeingut geworden. Es ist aber nicht so bekannt, dass er nie gesagt hat, was denn dieses »Fittere« ausmachen würde. Es waren die Biologen um Ernst von Weizsäcker, die herausfanden, dass Komplexität das Merkmal ist.9 Ein komplexeres System setzt sich gegenüber den anderen durch, »fitter« heißt also »komplexer, ausdifferenzierter«. Dieses Theorem scheint allgemeingültig zu sein. So haben sich komplexere Gesellschaften (systemtheoretisch »differenziertere«) gegenüber den »einfacheren«, weniger komplexen Gesellschaften durchgesetzt. Komplexität ist der Treiber von Entwicklung.
Segmentierte Gesellschaftsform
In nicht komplexen Gesellschaften waren die verschiedenen Großfamilien oder Clans alle gleich organisiert. Wenn wir uns eine Großfamilie im alten Albanien vorstellen, dann waren – und sind oft heute noch – die Rollen von Tochter, Sohn, Vater und Mutter klar definiert. Jede Rolle war die Identität des Individuums und definierte auch richtiges und falsches Verhalten. In der Nachbarschaft waren wiederum Großfamilien, die nach denselben Gesetzen – damals dem Kanun – organisiert waren. Der Kanun regelte die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse.
Die Rolle der Frau etwa war klar beschrieben: Sie ist im Kanun ein Schlauch, in dem eine Ware transportiert wird. Traditionell besteht ihre Aufgabe darin, Knaben zu gebären und so die Nachkommenschaft zu sichern. Sie hat kaum Rechte, aber man darf sie auch nicht in die Blutrache einbeziehen, da ist sie geschützt.
Das Wünschen und die Vorstellungskraft beschränkten sich auf den Wunsch nach einem Knaben, Mädchen nahm man in Kauf, solange Knaben geboren wurden. Gab es nur Mädchen, wurde die Frau verstoßen (dass der Mann das Geschlecht des Kindes definiert, war noch unbekannt – und wäre wohl als Unsinn abgetan worden).
Der Clan als Ganzes träumte wahrscheinlich davon, dass er prosperiere und viele Mitglieder habe. Die Vorkommnisse des Lebens (Tod, Nachfolge, Streit) waren genau geregelt. Die Hoffnungen des Einzelnen waren auf die Erfüllung dieser Regeln ausgerichtet. Man hatte keine weitergehenden Wünsche offen. Theoretisch formuliert, handelte es sich um ein nicht komplexes System mit klaren Systemgrenzen.
Mit dem heutigen Bewusstsein finden wir diese Frauenrolle entwürdigend, damals war das einfach so und wurde nicht infrage gestellt. Reste davon finden wir noch in Kulturen, in denen Frauen es akzeptieren, dass sie von Männern geschlagen werden. Sie gehören dem Mann, also darf er das.
Das Sein, also die durch Gesetze und Moral definierte gesellschaftliche Realität, definierte das Bewusstsein, und nur Abweichler überschritten es und mussten mit Strafen rechnen (Häretiker, Verführer) oder bekamen eine bestimmte Rolle zugeordnet (weiser Mann, Prophet), die gelebt werden durfte, aber keine systemverändernde Wirkung hatte.
Stratifizierte Gesellschaftsform: Die ständische Gesellschaft im Mittelalter
In der ständischen Ordnung der Gesellschaften Europas bestanden nicht mehr gleichartige Segmente nebeneinander, sondern im Prinzip wurden drei Ebenen gebildet: Klerus, Adel und Bauern.10





























