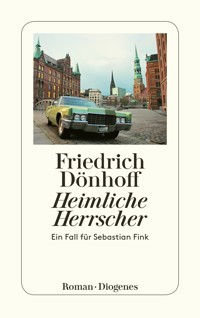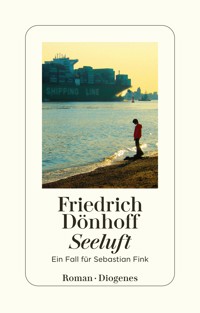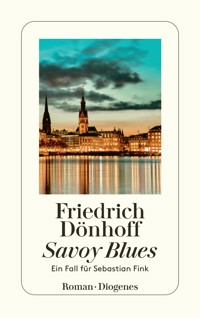21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
›Freiheit‹, ›Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz‹, ›Sexy‹, ›Lass uns leben‹, ›Wieder hier‹ sind Songs, die ganze Generationen geprägt haben. Doch wer verbirgt sich dahinter? In diesem sehr persönlichen und facettenreichen Buch erzählt Marius Müller-Westernhagen, was ihn bewegt und zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. Seine Erinnerungen führen zurück in seine Kindheit, in die junge BRD und zu den ersten Auftritten in der Zeit der Jugendrevolten, als eine neue Art von Musik beginnt, die Welt zu verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Friedrich Dönhoff
Marius Müller-Westernhagen
Ein Portrait
Diogenes
Prolog
KÖLN, MÜNGERSDORFER STADION, 30. JUNI 1995, gegen 22.30 Uhr. Marius Müller-Westernhagen trägt zu Jeans und schwarzem Gehrock ein weißes Rüschenhemd mit weiten Manschetten. Hinter der Bühne steigt er auf ein Kettcar und hält seinen Cowboyhut fest. Vor ihm tritt ein Roadie in die Pedale. Das Fahrzeug bringt den Rockstar durch einen Tunnel unter dem Laufsteg, der von der Hauptbühne weit ins Publikum hineinragt.
Am Ende der Röhre, nach ungefähr hundert Metern, steigt er wieder ab. Über ihm ein Tosen und Brausen, als würde ein Tsunami übers Stadion ziehen. Siebzigtausend Menschen skandieren: »Ma-ri-us! – Ma-ri-us! – Ma-ri-us!«
Nach zwei Stunden und fünfundzwanzig Songs hat die Stimmung ihren Zenit erreicht. Der Roadie übergibt ihm das Mikrofon. Westernhagen überprüft den In-Ear-Monitor in seinem Ohr, steigt die Treppe hinauf, während sich über ihm der Boden zu einer kleinen Bühne am Ende des Laufstegs öffnet. Das Rauschen und die Rufe werden lauter.
Er sieht zuerst die Kante des Bühnenbodens, dann die Köpfe der Menschen, aber sie sehen ihn nicht. Sie erwarten, dass er sich vorne auf der Hauptbühne zeigt, von der er vor ein paar Minuten, vor der Zugabe, verschwunden ist. Die Flutlichter strahlen rot über das Stadion.
Er tritt hinaus, steht jetzt auf dem Podium am Ende des Laufstegs, mitten in der Menge, um ihn herum schauen lauter Gesichter aufgepeitscht und euphorisch zu ihm auf. Die Menschen weinen, schreien und strecken ihm ihre Arme entgegen.
Er hebt das Mikrofon, will etwas sagen, bringt die Worte aber nur mit Mühe heraus: »Danke, danke«, schallt seine Stimme durch das Stadion. »Ich muss euch sagen … wir –«
In diesem Moment spürt er die Energie der Menschen wie Druckwellen gleichzeitig von allen Seiten über ihm zusammenschlagen, es erwischt ihn mit voller Wucht, und er kann kaum fassen, was da gerade passiert.
Plötzlich ist es, als würden sich seine Füße vom Boden lösen und er langsam abheben. Hastig schaut er sich nach etwas um, woran er sich festhalten kann, aber da ist nichts, nicht mal ein Mikrofonständer. Er geht in die Hocke, rührt sich nicht, versucht ruhig zu atmen.
Als er aufschaut und sich traut, wieder hochzukommen, ist er wie benommen. »Okay«, er atmet schwer, »danke«, sagt er mit Tränen in den Augen, und seine Stimme schallt durch das Stadion. »Wir haben –« Er bricht ab, drückt sich zwei Finger an die Nase. »Wir haben vor diesem Konzert zwölf wahnsinnige Konzerte gespielt«, und nun hat er seine Stimme wieder im Griff. »Aber das hier, das ist das Wahnsinnigste, was ich in meiner ganzen Karriere erlebt habe.« Er blickt hinaus. »Danke!«
Er wendet sich seinem Pianisten am Flügel zu und gibt das Zeichen.
Das Intro zum Song Freiheit beginnt, und mit den ersten Tönen flammen kleine Lichter auf, Hunderte, Tausende, ein Lichtermeer unter dem schwarzen Nachthimmel. Dann singt das ganze Stadion:
Die Verträge sind gemacht
Und es wurde viel gelacht
Und was Süßes zum Dessert
Freiheit, Freiheit …
Die Kapelle, rumm ta ta
Und der Papst war auch schon da
Und mein Nachbar vorneweg
Freiheit, Freiheit
Ist die Einzige, die fehlt
Der Mensch ist leider nicht naiv
Der Mensch ist leider primitiv
Freiheit, Freiheit
Wurde wieder abbestellt
Alle die von Freiheit träumen
Sollen ’s Feiern nicht versäumen
Sollen tanzen auch auf Gräbern
Freiheit, Freiheit
Ist das Einzige, was zählt
Freiheit, Freiheit
Ist das Einzige, was zählt.
1
BERLIN, IM JUNI 2020. Der Fahrstuhl hält im vorletzten Stock. Die Türen öffnen sich. Am Ende des Gangs, die Arme vor der Brust verschränkt, lehnt eine schlanke Gestalt in T-Shirt und Jeans in der offenen Wohnungstür. Der Blick von Marius Müller-Westernhagen ist neugierig und prüfend.
»Schön, dass es geklappt hat«, sagt er und gibt mir seine Hand, an deren Fingern mehrere silberne Ringe stecken. »Haben Sie es gleich gefunden?« Seine Stimme ist tief und raumfüllend.
In der Wohnung ist jedes Geräusch leise, als würde irgendetwas alle Töne schlucken. Tageslicht strömt von verschiedenen Seiten herein, an der Wand stehen leere Kartons.
»Wollen Sie umziehen?«, frage ich.
Er schaut sich überrascht um. »Nein. Wir sind gerade eingezogen. In Mitte war mir und meiner Frau zu viel Trubel. In Charlottenburg ist es ruhiger.«
Im offenen Wohnzimmer stehen sich zwei Kanzlersofas von Le Corbusier gegenüber, eins in Grau, eins in dunklem Lila, und so lang, dass auf jedem bequem sechs Leute sitzen könnten. Dazwischen eine freie Fläche mit graublauem Teppich. Der Tisch, sagt Westernhagen, werde noch geliefert.
An den Wänden hängt moderne Kunst, neben der Kommode stehen sechs Akustikgitarren aufgereiht. Gegenüber, auf der anderen Seite des Raums, befindet sich ein Flügel aus dunklem Holz. Neben dem Kamin hängen drei große Schwarz-Weiß-Portraits: der junge John Lennon, George Harrison und Paul McCartney.
»Das sind Originalprints von Astrid Kirchherr«, sagt Westernhagen, »eine sehr enge Freundin von mir, die leider vor Kurzem verstorben ist.«
Hinter den großen Fenstern und der offenen Terrassentür sind der Himmel und ein grünes Meer von Baumkronen im nahen Park zu sehen.
»Wollen wir uns setzen?«, fragt er, und schon sind wir mitten im Gespräch: über Hamburg und Berlin, das neue Stadtschloss, Deutschland und darüber, ob es in diesem Land ein Rassismusproblem gibt. Über das Komponieren von Liedern und das Schreiben von Büchern, ob und wie sich das eine vom anderen unterscheidet und wo in Berlin es eigentlich die besten Burger und Pommes gibt, das beste indische Restaurant.
Nie scheint er davon auszugehen, dass sein Besucher irgendetwas über sein Leben oder seine Karriere wissen müsste. Dass er ein sehr erfolgreicher Schauspieler war. Rockstar auf der Bühne und in Musikvideos, dass er es als erster deutscher Musiker wagte, eine Tournee in Fußballstadien zu spielen, dass sieben seiner vielen Nummer-eins-Alben jeweils mehr als eine Million Mal verkauft wurden – was bis heute niemand anderem in Deutschland gelungen ist –, über das alles verliert er kein Wort. Und auch nicht über die Etiketten, die an ihm kleben: Der Underdog aus dem Kohlerevier und der Armani-Rocker, der erste Deutsche, der zum Megastar gemacht wurde, genial und normal, der Kumpel von nebenan und der Elitäre. Und er thematisiert auch nicht, dass immer mal wieder gefragt wird: Wer ist denn dieser Marius Müller-Westernhagen eigentlich wirklich?
Wir sind längst zum Du übergegangen, als wir auf unser mögliches Buchprojekt zu sprechen kommen. Mein Verleger hatte angeregt, dass wir uns mal treffen. Obwohl oder gerade weil ich von Marius Müller-Westernhagen nicht viel wusste, nur ein paar seiner Songs kannte. Ich würde ihm völlig unvoreingenommen begegnen, bei null anfangen und sehen, wohin es uns trägt. Wie bei einer zufälligen Begegnung mit einem Menschen im Zug. Genau das hat Westernhagen gefallen. Ihn interessierte keine klassische Biografie, sondern ein Projekt, bei dem wir über Themen der heutigen Zeit sprechen, die ihn bewegen, und nebenbei auch über sein Leben.
Wir verabreden uns für die kommende Woche zum nächsten Treffen. Auf dem Weg zur Tür bleibt er vor dem Bücherregal stehen, legt den Kopf in den Nacken und sucht die Reihen ab. Dann entdeckt er ganz oben einen Bildband. Er streckt die Arme aus und versucht, den Wälzer unter einem Stapel herauszuziehen. Einen Moment lang fürchte ich, er werde gleich unter einem Berg von Büchern begraben, aber im nächsten Augenblick hält er das Buch in den Händen. Ein Fotoband über ihn.
Marius Müller-Westernhagen als Kind in den Fünfzigerjahren und als Jugendlicher im Fußballtrikot, als Schauspieler in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern, der Rockstar auf der Bühne im Stadion vor einer riesigen Masse von Menschen. Teils private, teils offizielle Fotos, manche professionell, andere amateurhaft und viele Schnappschüsse. Doch eines fällt auf: Der Blick des Menschen auf den Fotos ist über all die Jahre immer der gleiche. Es ist sein Blick, den er auch jetzt beim Betrachten der Fotos hat: neugierig, vorsichtig, leicht amüsiert.
Er blättert durch das Buch, möchte auf keiner Seite länger verweilen, will es mir eigentlich nur zur Vorbereitung mitgeben. Manchmal wirkt er verwundert, mal lacht er auf. Dann klappt er das Buch entschlossen wieder zu.
»Du hast dich wenig verändert«, sage ich zu ihm. Im Siebenjährigen ist auch der heute über Siebzigjährige gut zu erkennen und umgekehrt.
»Der Junge ist ja auch immer hier«, antwortet er und schlägt sich einmal mit der flachen Hand an die Brust.
2
TIEFENBROICH, NAHE DÜSSELDORF, IM JUNI 1954. Der fünfjährige Marius liegt in seinem Bett, kann nicht schlafen – und will es auch nicht. Es geht auf 22 Uhr zu.
Endlich hört er, wie im Flur der Fußboden knarrt. Die Tür geht auf, sein Vater steckt den Kopf herein und flüstert: »Komm!«
Marius schlägt seine Decke zurück und folgt ihm im Schlafanzug. Sie schleichen auf Zehenspitzen an der Küche und am Bad vorbei. An der Tür zum Elternschlafzimmer bleibt der Vater stehen, schaut Marius an und legt mahnend einen Finger auf seine Lippen. Dann öffnet er vorsichtig, als wäre er im Theater auf der Bühne, die Tür.
Die Mutter schläft und atmet tief. Der Vater nickt Marius zu. Sie schleichen weiter, am Zimmer von Marius’ älterer Schwester Christiane vorbei zum Wohnzimmer.
Der Vater schließt die Tür und schaltet den Fernsehapparat ein. Die Mattscheibe beginnt zu flimmern, und aus dem körnigen Schwarz-Weiß treten allmählich die Konturen zweier Eishockeymannschaften hervor.
Marius’ Vater zündet sich eine Zigarette an, schenkt sich einen Schnaps ein und lehnt sich zurück, wie sich auch Marius zurücklehnt. Er ist glücklich. Es gibt nur ihn und den Vater, das Sofa, den Fernseher und das Eishockeymatch.
Ein paar Wochen später, es ist der 4. Juli 1954, wird am Nachmittag im Fernsehen das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft Deutschland gegen Ungarn live aus dem Berner Wankdorfstadion übertragen. Das Wohnzimmer der Müller-Westernhagens ist proppenvoll. Nachbarn und Kollegen von Hans Müller-Westernhagen aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus sind gekommen, um sich das Spiel anzusehen. Ungarn ist hoher Favorit. Es gibt Bier, Schnaps und Schnittchen, von Marius’ Mutter Liselotte und seiner Schwester geschmiert. Um 16.53 Uhr, sieben Minuten früher als geplant, wird die Partie angepfiffen.
Die Männer verfolgen angespannt die Partie, kommentieren laut, fluchen, trinken, rauchen und besetzen Stühle, Sessel, Sofa und den Platz neben Marius’ Vater.
Zur Halbzeit steht es 2:2. Der Vater geht zum Bierholen in die Küche. Marius läuft ihm hinterher und sagt: »Die Arschlöcher sollen alle verschwinden!«
Das kostet eine Ohrfeige. Sein Vater lässt ihn stehen und kehrt zurück ins Wohnzimmer.
In der 84. Minute schießt Helmut Rahn für die deutsche Mannschaft das Tor zum 3:2. Im Wohnzimmer der Müller-Westernhagens gibt es kein Halten mehr. Als einer der Männer, es ist der Schauspielkollege Hermann Schomberg, sich zurück auf seinen Stuhl fallen lässt, kracht der unter ihm zusammen. Schomberg sitzt verdutzt, mit rotem Kopf, auf dem Boden. Marius lacht, und die anderen Männer lachen auch.
Abpfiff. Um 18.38 Uhr ist Deutschland Weltmeister. Der Jubel im Wohnzimmer ist so laut, dass Marius sich die Ohren zuhält.
Einen Tag später, am 5. Juli 1954, geht Marius mit seinem Vater auf die Königsallee.
»Extra-Ausgabe!«, ruft ein Zeitungsjunge.
Der Vater kauft ein Exemplar und schlägt die Zeitung auf. Sie werden sofort von Passanten umringt, die dem Vater über die Schulter schauen, mitlesen, kommentieren und diskutieren. Alle sind immer noch in Feierstimmung.
Auf dem Nachhauseweg bekommt Marius von seinem Vater einen Gummiball geschenkt. Der Ball ist so klein, dass er in seine Hosentasche passt. Er hat ihn von nun an immer dabei, spielt mit ihm bei jeder Gelegenheit auf der Straße, kickt damit auf dem Schulhof und im Park.
Er will unbedingt im Verein spielen, aber seine vorsichtige Mutter hat Bedenken und will ihn erst von einem Arzt untersuchen lassen. Doch letztendlich hat der Vater das letzte Wort, und Marius wird mit sieben Jahren bei Fortuna Düsseldorf angemeldet.
3
ES SIND ANGENEHME TEMPERATUREN, als ich um Punkt vier Uhr am Tor klingle und der Summer ertönt.
Marius steht in Jeans, Westernhemd und weißen Strümpfen in der Wohnungstür. »Kannst die Schuhe anbehalten oder ausziehen, wie du möchtest«, sagt er und schließt die Tür hinter mir. »Espresso?«
Wir rutschen auf Socken über das Parkett an einer Loggia mit zwei Korbsesseln vorbei zur offenen Küche. Auch hier hängen große Bilder, wie vorne im Wohnzimmer, moderne Malerei, aber auch Fotokunst.
Marius macht sich an der Espressomaschine zu schaffen. »Kann sein, dass zwischendurch mein Gitarrist aus den USA anruft«, sagt er. »Da muss ich dann kurz drangehen. Wegen der Zeitverschiebung geht es nur am Nachmittag.«
Ursprünglich hätte heute Abend die neue Westernhagen-Tournee in München starten sollen. Zweiundzwanzig ausverkaufte Konzerte in Theatern und Opernhäusern in ganz Deutschland mussten, wie alle anderen Veranstaltungen, wegen der Pandemie abgesagt werden.
»Wie geht es dir damit, dass deine Tournee ausfällt?«, frage ich.
»Es ist, wie es ist.« Er zieht einen Hebel fest. »Wir haben alles versucht, uns bleibt nichts übrig, als es zu akzeptieren.«
Er bemerkt meinen Blick auf das Bild an der Wand gegenüber. »Ein südafrikanischer Maler«, sagt er. »Aus den Achtzigerjahren. Schau dich ruhig um, das dauert hier noch einen Moment.«
Ich schlendere ins Wohnzimmer. Auf einem schmalen Regal stehen Romane, Sachbücher, Bildbände, darunter, sauber aufgereiht, abgegriffene Schallplatten. Drüben in der Küche geht eine Schranktür, es riecht nach Kaffee.
Im Regal lehnt ein Porträt von Grace Jones, daneben eines von einer anderen schwarzen Frau, Lindiwe Suttle-Westernhagen, genannt Lindi, Marius’ Ehefrau. Ein Foto von Karl Lagerfeld, wie er mit strengem Blick bei Marius die Krawatte zurechtrückt. Daneben das Foto eines Mädchens, das in die Kamera strahlt und Ähnlichkeit mit Marius Müller-Westernhagen hat.
»Das ist Mimi«, sagt er, als er mit zwei Tassen um die Ecke kommt. »Meine Tochter. Auf dem Bild ist sie vier, inzwischen über dreißig. Unglaublich, wie schnell das ging.«
Seine Tochter lebt in London und ist ebenfalls Singersongwriterin, erzählt er mit hörbarem Stolz in der Stimme.
Mittlerweile steht zwischen den Sofas ein niedriger Tisch mit Fotobüchern. Marius setzt sich auf das Sofa, neben ihm liegt eine Gitarre, ich nehme gegenüber Platz.
»Hast du heute schon gespielt?«, frage ich.
»Geübt.« Er streift das Instrument mit einem Blick und nickt. »Ein bisschen, ja.«
»Übst du regelmäßig?«
»Zu wenig«, sagt er. »Viel zu wenig.« Er lacht kurz, sitzt nach vorn gebeugt, hat die Hände ineinandergefaltet und sagt, er habe immer das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein und dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis alle dahinterkämen.
»Hast du das auch beim Komponieren?«
Ohne zu zögern, schüttelt er den Kopf. »Wenn ich beim Arbeiten an so was denken würde, bekäme ich wahrscheinlich gar nichts zustande. Mir kommt eine Melodie in den Kopf, oder ich klimpere auf dem Klavier herum, und dann denke ich plötzlich: Oh, das könnte was sein! Und ich versuche es weiterzuentwickeln. Ich habe Glück, Komponieren ist für mich ein intuitiver Prozess, der mir leichtfällt.«
»Und das Schreiben der Texte?«
»Viel schwerer! Und es wird mit den Jahren auch immer schwieriger.«
»Warum?«
»Weil die eigenen Ansprüche an Sprache steigen. Man muss sich quälen, sich dahin begeben, wo’s wehtut. Ich glaube nicht, dass man ohne eine gewisse Leidensfähigkeit künstlerische Werke erschaffen kann.«
Während er spricht, zieht er unbewusst seinen Ring ab, dreht ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. »Immer wieder denke ich: Ich schreibe nie wieder einen Text. Aber dann geht es eben doch wieder mit einem weißen Blatt Papier los.«
»Wenn du deine alten Texte liest, wie findest du sie heute?«
»Die lese ich nur, wenn es unbedingt sein muss, zum Beispiel bei Tourneen. Zu einigen meiner frühen Texte habe ich natürlich eine gewisse Distanz. Aber es kommt vor, dass ich mal einen jahrzehntealten Text lese, überrascht bin und denke, verdammt, das ist ja gar nicht so dusselig. Wenn du jung bist, gehst du viel naiver ans Schreiben dran, du denkst weniger nach, bist weniger kritisch mit dir selbst. Das kann auch ein Vorteil sein. Je älter du bist, je mehr du durchlebt und erfahren hast, desto mehr reflektierst und überlegst du.«
»Gibt es Songs, die du rückblickend lieber nicht veröffentlicht hättest?«
Er schüttelt den Kopf. »Bei keinem Stück bin ich entsetzt und denke: Um Gottes willen, dass ich so was geschrieben habe! Ich hab natürlich viele Songs gemacht, die ich heute so nicht mehr schreiben würde, aber vor vierzig Jahren war ich ein anderer Mensch, vor dreißig Jahren auch und genauso vor zehn. Das Entscheidende ist für mich nicht, wie ich heute einen alten Song von mir finde, sondern dass ich weiß, dass ich ihn mit Überzeugung und Ehrlichkeit geschrieben habe.«
Er habe festgestellt, dass seine Songs ein Eigenleben entwickeln, erklärt er. »Immer wenn ich mal wieder auf sie treffe, sehe ich sie in einem anderen Licht – nicht nur, weil ich mich verändere, auch die Welt um uns herum verändert sich. Wenn meine Band und ich bei den Konzerten ältere Songs spielen, versuchen wir sie für uns selbst wieder interessant zu machen, indem wir sie anders arrangieren. Ich ändere auch hier und da mal eine Textzeile. Einige Songs kann ich aus meiner heutigen Sicht nur mit einer gewissen Ironie interpretieren.«
Marius sitzt vollkommen reglos da, und man weiß nicht, ob er gedanklich noch beim Thema oder schon ganz woanders ist. Die Augen wechseln alle paar Sekunden ihren Ausdruck, und der Mundwinkel zuckt.
»Manchmal schafft man es, die Menschen zu berühren«, fährt er dann fort, »weil man etwas artikuliert, das andere genauso fühlen, aber nicht in Worte fassen können. Du triffst einen Nerv – und plötzlich verkaufst du eine Million Platten und hast überhaupt nicht damit gerechnet. Das ist aber reine Glückssache. Jeder Idiot kann eine Million Platten verkaufen. Man ist zufälligerweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort.«
»Das reicht?«
»Okay, du musst dann natürlich noch ein Lebensgefühl treffen oder das Gefühl einer Generation – bewusst oder unbewusst. Damit das Glück sich überhaupt entfalten kann, muss man sich etwas erarbeiten. Aber ich schwöre dir, es gibt so viele fantastische Musiker, die wesentlich talentierter sind als ich, von denen nie jemand etwas gehört hat, die diszipliniert arbeiten, aber«, er klatscht in die Hände, »denen fehlt einfach das Glück.«
Er lehnt sich zurück, schlägt ein Bein über das andere und sagt: »Kommerzieller Erfolg ist zumindest teilweise planbar. Mit massivem Marketing kann man sicherlich einiges steuern. Aber wenn man den Anspruch erhebt, Künstler zu sein, dann kann und darf man sich nicht den Marktanforderungen unterordnen.«
Den Ring hat er inzwischen auf seine Fingerspitze geschoben, wo er ihn weiterdreht, während er über etwas nachdenkt. »Ist es nicht zynisch«, fragt er, »wenn man – egal, ob in der Musik, der bildenden Kunst oder in der Literatur – versucht, seine Arbeit an einen vermeintlichen Publikumsgeschmack anzupassen? Stellt man sich damit nicht über die Leute und denkt, die merken nicht, dass man ihnen was vormacht? Deshalb finde ich es auch so ärgerlich, wenn Musikproduzenten sich schon während der Arbeit überlegen, wie sie ihr Produkt möglichst vielen Menschen andrehen können, und sogar zufrieden sind, wenn Künstler oder Künstlerinnen bewusst unter ihrem Niveau bleiben, weil dann die Verkaufschancen steigen. Du machst etwas mit Absicht schlecht, damit du es dann vielleicht besser verkaufst? Wenn das nicht zynisch und verachtend ist. In der Musikbranche wird oft gesagt: ›Ja, das ist großartig, aber das kann man so im Radio nicht spielen. Das will keiner hören.‹ Und wenn du dann antwortest: ›Wenn ich eine Platte mache, dann interessiert mich nicht, was jemand eventuell hören möchte, sondern was ich spielen will‹, dann wirst du angeguckt, als hättest du nicht alle Tassen im Schrank.«
Sein Vater, festes Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus, damals eine der bedeutendsten Theaterbühnen Europas, habe gesagt, Kunst kann nur entstehen, wenn der Künstler aus sich selbst schöpft. Marius beugt sich wieder nach vorn, die Hände verschränkt, Ellbogen auf die Knie gestützt. »Das ist anstrengend, und manchmal tut es weh«, erklärt er. »Das bewältigst du nur, wenn du bereit bist, einen Seelenstriptease hinzulegen, und dich in der Konsequenz verletzbar machst. Wie wenn du einen Fuß auf ein Drahtseil setzt. Entweder du schaffst es und fängst an zu tanzen, oder du fliegst auf die Fresse. Das Publikum spürt, ob du wahrhaftig bist oder nicht. Das habe ich so oft erlebt. Egal, ob du vor drei Menschen auftrittst oder vor vielen Tausenden. Wenn du bei dir bist und wirklich empfindest, schaffst du eine Verbindung.«
4
DÜSSELDORF-HEERDT, IM OKTOBER 1957, die Familie wohnt inzwischen in der Heesenstraße 2. Marius’ Mutter Liselotte ist nervös. Sie hat picobello aufgeräumt, geputzt, eingekauft und stundenlang gekocht. Marius sitzt gekämmt und gescheitelt im Wohnzimmer.
Im Treppenhaus sind Stimmen zu hören, ein Lachen, ein Schlüssel im Schloss. Seine Mutter nimmt ihre Schürze ab.
Hilde Krahl ist groß, schlank und trägt ein enges Kostüm mit Pelzkragen, seidene Handschuhe und glänzende hochhackige Schuhe. Mit ihr hält eine Wolke von Parfüm Einzug in die Wohnung. Die Frau ist nicht nur berühmt, sondern auch wunderschön. Marius stockt der Atem.
Die Schauspielerin beugt sich zu ihm hinunter, berührt seine Wange und schaut ihn mit ihren großen, schönen Augen an und sagt: »Du bist also Marius. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt.«
Die Erwachsenen sitzen am Esstisch, es wird geraucht, getrunken, erzählt und gelacht. Die Schauspielerin aus Wien, bekannt aus Kino, Fernsehen und großen Theatern, gastiert am Düsseldorfer Schauspielhaus und spielt neben Hans Müller-Westernhagen in einer neuen Produktion. Noch laufen die Proben. Marius’ Vater spricht mit seiner lauten Bühnenstimme, wie so oft, wenn er vom Theater nach Hause kommt. Hilde Krahl ist voller Bewunderung für ihn und seine Schauspielkunst.
Der Junge betrachtet und beobachtet den Gast genau: wie die Hände durch die Luft fliegen, wenn sie etwas erzählt. Wie sie die Finger spreizt und bewegt, wenn sie sich etwas ausmalt. Wie sie sich vorbeugt, wenn sein Vater ihr Feuer gibt, wie sie den Rauch auspustet, die Augen aufreißt, wenn der Vater eine Geschichte erzählt. Und er schaut sich das sorgfältige Make-up auf ihrem makellosen Gesicht an. Er kennt das alles vom Theater, von seinem Vater und dessen Schauspielkollegen, aber bei dieser Frau ist alles perfekt.
Irgendwann kommt es, wie es kommen muss, und Liselotte schaut auf die Uhr. Sie bemerkt sicher, dass der Sohn längst im Bett sein müsste. Aber er hat Glück: Gerade jetzt dreht Hilde Krahl sich zu ihm herum und fragt mit ihrer vollen, warmen Stimme, wie alt er ist und in welche Klasse er geht.
Er läuft rot an und sagt mit klopfendem Herzen, er sei acht Jahre alt und gehe schon in die dritte Klasse. Angespornt von ihrem Lächeln, erzählt er außerdem, dass er bei Fortuna Düsseldorf im Verein in der D-Jugend spielt. Hilde Krahl fragt, ob er das Buch von dem Jungen mit dem roten Luftballon kenne, und erzählt ihm die Geschichte: Ein Junge findet eines Tages einen roten Ballon, verliert ihn, aber er kommt nach Umwegen wieder zu ihm zurück. Marius gefällt die Geschichte, und Hilde Krahl verspricht, ihm das Buch zu schenken.
In dieser Nacht kann er lange Zeit nicht einschlafen. Er denkt an Hilde Krahl, sieht ihre Augen vor sich, riecht ihr Parfüm. Er hört die Erwachsenen im Wohnzimmer und denkt an die Geschichte, die sie ihm erzählt hat. Irgendwann fallen ihm doch die Augen zu.
Auch in den nächsten Tagen geht Marius die Diva nicht aus dem Kopf: Im Unterricht, im Pausenhof, beim Mittagessen zu Hause, auf dem Weg zum Training denkt er an sie. Nur auf dem Fußballplatz, wenn es darum geht, als Kleinster mit dem Ball an den anderen vorbeizudribbeln, Tore vorzubereiten und selbst zu schießen, ist er voll bei der Sache. Von Hilde Krahl hört er nichts, und auch sein Vater verliert kein Wort über das ausstehende Geschenk.
Eines Nachmittags, die Schule ist vorbei, ein Fußballtraining steht nicht an, geht er zum Hotel, in dem Hilde Krahl abgestiegen ist, setzt sich gegenüber vom Eingang auf die Mauer und lässt die Tür nicht aus den Augen.
Taxis fahren vor, Männer mit Hut steigen aus und verschwinden im Hotel, eine Dame in gepunktetem Kleid bleibt auf den Stufen stehen, schaut in die Sonne, setzt sich eine Sonnenbrille auf und geht die Straße hinunter.
Marius sitzt da und wartet. Irgendwann hält eine Limousine. Kurz darauf kommt Hilde Krahl im dunkelblauen Kleid mit weißem Kragen und rotem Gürtel heraus. Sie ist so schön und auch noch so nett, als sie mit dem Mann spricht, der zur Begrüßung aus der Limousine gestiegen ist und den Marius ebenfalls aus dem Theater kennt. Er überlegt, was er jetzt tun soll. Rufen?
Der Mann öffnet den Schlag, Hilde Krahl hält ihren Hut fest – und entdeckt über das Autodach hinweg auf der anderen Straßenseite Marius, der winkt.
»Guten Tag, junger Mann!«, ruft sie überrascht. »Was machst du denn hier?«
Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, kommt herüber und ruft: »Sie haben mir doch ein Geschenk versprochen!«
Hilde Krahl lacht. »Da hast du recht.« Sie lässt die Limousine warten, nimmt ihn bei der Hand, und er folgt ihr ins Hotel. Sie durchqueren das Foyer, die Diva wird bewundernd gegrüßt, sie lächelt, lässt sich aber nicht aufhalten. Mit dem Lift fahren sie ins obere Stockwerk.
Die Suite ist riesig, so groß wie bei den Müller-Westernhagens Küche und Wohnzimmer zusammen, wenn nicht größer. Sie verschwindet, kommt mit einem Buch zurück, setzt sich, zieht einen Füller hervor, schlägt die erste Seite auf und schreibt etwas hinein, bevor sie Marius das Buch überreicht.
Vorne drauf sind ein Junge und ein roter Ballon zu sehen. Er klappt das Buch auf und liest: »Für den lieben Marius von Deiner Freundin Hilde«.
Marius geht auf die Volksschule, gilt als intelligent und begabt, macht unter dem sanften Druck seiner Mutter seine Hausaufgaben und spielt weiter begeistert Fußball.
Alle zwei Wochen sonntags darf er zu den Heimspielen seines Vereins ins Rheinstadion gehen. An diesen Festtagen zieht er mit der großen, selbst genähten Vereinsfahne los, die größer ist als Marius selbst. Mit seinen Sportsfreunden feuert er die Mannschaft auf dem Spielfeld an. Er kann, wenn er will, ungewöhnlich laut rufen und schreien – eine Fähigkeit, mit seiner Stimme umzugehen, die er vielleicht von seinem Vater geerbt hat und die er durch das regelmäßige Anfeuern im Stadion noch ausbaut und perfektioniert. Noch kann sich niemand vorstellen, dass Marius in ferner Zukunft hier, im Düsseldorfer Rheinstadion, seine eigenen Lieder singen wird, vor Zehntausenden Fans, die jedes Wort mitsingen. Der Junge hat zu diesem Zeitpunkt auch nicht die geringste Ahnung davon, welch große Rolle die Musik in seinem Leben einmal spielen wird.
Aber eines Tages passiert ihm ausgerechnet nach einem Fußballspiel etwas, das er sein Leben lang nicht vergessen wird. Das Spiel ist vorbei, die Zuschauer strömen zu den Ausgängen des Stadions. Es ist voll, es ist eng, es ist heiß. Seine beiden Freunde hat Marius in der Menge der Schlachtenbummler verloren. Der Junge wird inmitten der riesigen grölenden Männer an eines der hohen Eisentore gedrückt. Die Leute können nicht weiter, andere drücken von hinten. Marius merkt, wie klein er neben all den Männern ist. Er kann den Himmel nicht mehr sehen. Am Boden liegen Glassplitter in der Bierpfütze, es stinkt nach Urin. Die Menge drückt ihn gegen das Gitter. Marius versucht sich irgendwie herauszuwinden, er ist eigentlich wendig, geschickt und sportlich, er kennt es vom Fußball, aber jetzt kann er nichts mehr tun. Er wird von fremden Körpern an das große Eisentor gedrückt, bekommt keine Luft, versucht zu schreien, aber niemand hört oder achtet auf ihn. Sein Gesicht am Tor, er bekommt keine Luft, im Kopf stechende Schmerzen. Man hatte das große Tor nicht geöffnet, sondern nur eine kleine Tür.
Die Situation löst sich im letzten Moment auf, als endlich das große Tor geöffnet wird und die Masse zügig herausströmen kann, Platz entsteht, der Junge bekommt wieder Luft.
Das Erlebnis trübt seine Begeisterung für das Fußballspiel nicht. Nur bei Massen wird er in Zukunft vorsichtig bleiben.
Außer Fußball liebt er Eishockey und besonders die Mannschaft und Spiele der Düsseldorfer Eishockey Gemeinschaft. Die DEG ist Kult, nicht nur wegen des Sports, sondern vor allem wegen der fantastischen Stimmung im Eissportstadion an der Brehmstraße, dem größten Stadion Deutschlands, wo bei jedem Heimspiel Tausende Düsseldorfer ihre Mannschaft anfeuern, nach jedem Tor Feuerwerk zünden, Lieder singen und Kuhglocken läuten. Das Spektakel sucht seinesgleichen und findet regelmäßig statt, obwohl die Mannschaft immer wieder den Aufstieg in die Eishockey-Bundesliga verpasst. (Als die DEG es Mitte der Sechzigerjahre endlich schafft, wird Düsseldorf alle zwei Wochen, bei jedem Heimspiel, von einer regelrechten Hysterie erfasst, und auch Marius lässt sich jedes Mal mitreißen.)
Weil die Spiele meistens abends stattfinden, ist seine Mutter dagegen, dass Marius loszieht und ins Stadion geht. Sie hat, wie immer, Angst um ihn. Aber sein Vater gibt ihm die Erlaubnis, und noch hat im Hause Müller-Westernhagen, wie in den allermeisten deutschen Haushalten, der Mann das letzte Wort.
Viel lieber sieht die Mutter ihren Sohn im heimischen Düsseldorf-Heerdt Gitarre bei der Lerngruppe spielen, bei der sie ihn angemeldet hat. Dort sitzt er nun einmal die Woche im Kreis mit zwanzig anderen Schülern und muss über die Saiten der Lerngitarre streichen. Er hat zu dem Instrument ein ambivalentes Verhältnis. Er wollte Gitarre spielen lernen, aber die Lerngruppe langweilt, ja ekelt ihn geradezu an. Er bricht die Sache ab und will mit der Gitarre einstweilen nichts mehr zu tun haben.
Musik – das sind für den angehenden Jugendlichen die Lieder aus dem Theater, die er aus seiner Kindheit kennt und liebt, Lieder von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Lieder aus dem Faust,Es war einmal ein König, von Gustaf Gründgens intoniert. Tief berührt ihn Goodbye Johnny, gesungen von Hans Albers. Bisher kennt er nur, was seine zwei Jahre ältere Schwester Christiane hört: nicht Elvis Presley, wie die meisten Mädchen ihres Alters, sondern Bobby Darin, Eddie Fisher oder Perry Como. Eigene Schallplatten, oder gar einen Plattenspieler, besitzt er noch längst nicht.
Zu Hause hängt die Stimmung stark vom gesundheitlichen Zustand des Vaters ab. Alkohol, Nikotin und Stress, vermutlich auch eine nicht diagnostizierte Depression belasten Hans Müller-Westernhagen wie so viele andere Menschen in dieser Zeit auch. Es sind die Nachwehen des Krieges. Hans Müller-Westernhagen wurde als hoch talentierter und sensibler junger Schauspieler, der schon zum festen Ensemble des Düsseldorfer Staatstheaters gehörte, mit Anfang zwanzig von der Kriegsmaschine einkassiert, geschluckt und ein paar Jahre später schwer verletzt, mit Granatsplittern in den Beinen, wieder ausgespuckt. Bei Kriegsende war er 26 Jahre alt, und anfangs gelang es ihm, sich mithilfe von Alkohol, Nikotin und Medikamenten durchzuschleppen, aber auch mit immer neuen Theaterrollen, in die er sich hineinflüchtete und in denen er Inseln des inneren Friedens fand.
Seit dem Ende der Fünfzigerjahre spielt er zunehmend in TV