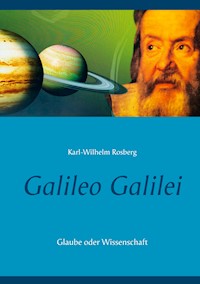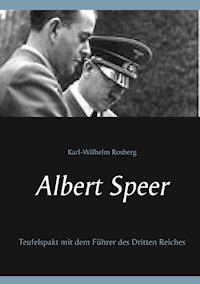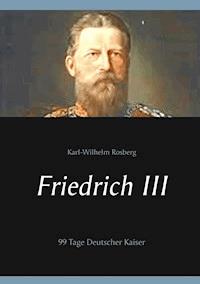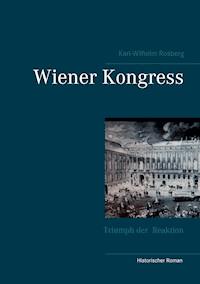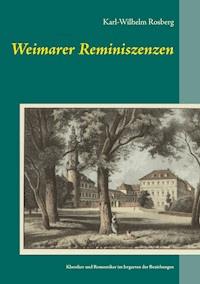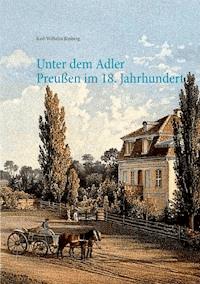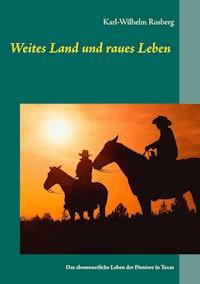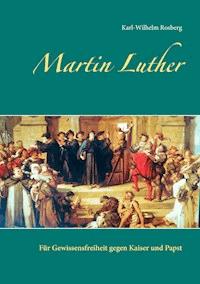
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Historische Roman führt uns in das Jahr 1507 und in die Zeit der Reformation zurück. Der junge Augustinermönch Martin Luther, treuer und gläubiger Diener seiner Kirche, wird nach Wittenberg entsandt, um dort an der neu gegründeten Universität zu lehren und zu studieren. Rasch steigt er in der Kirchenhierarchie auf und unternimmt einen unglaublich langen Fußmarsch nach Rom und zurück. In Rom sieht er zu seinem Erstaunen, wie der Klerus lebt und was sich im päpstlichen Palast abspielt. Der Papst führt gerade Krieg. Ihm kommen Zweifel. Zurück in Wittenberg studiert Luther intensiv die Bibel im Urtext und erkennt, dass die römisch-katholische Lehre damit nicht übereinstimmt. Insbesondere der Römerbrief von Paulus öffnet ihm eine völlig andere christliche Lehre. Er meldet das seinen Vorgesetzten und schreibt, nachdem auch der Ablasshandel seinen Widerstand weckt, Briefe an den Erzbischof von Mainz, auch an den Papst. Die Kirche reagiert ablehnend, schließlich wird gegen ihn der Bann ausgesprochen und der Kaiser verhängt die Reichsacht. Der Roman schildert den Kirchenkampf und das Leben Martin Luthers im Kampf für Gewissensfreiheit gegen Kaiser und Papst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Personen
Wittenberg am Rande der Zivilisation
Kompliziertes religiöses Gemeindewesen in Wittenberg
Zurück in den Bürgerkrieg
Kaum zurück in Wittenberg geht es schon wieder fort
Von Wittenberg nach Nürnberg
Von Nürnberg nach Lindau
Nach Chur
Durch die Via Mala
Durch die Lombardei nach Bologna
Über den Appenin nach Florenz
Sei gegrüßt, du heiliges Rom
Der Rückweg
Doktor der Theologie
Prediger und Rebell
Das Turmerlebnis
Theologie in deutscher Sprache und der Fall Reuchlin
Der Ablass
Brief an den Erzbischof und die 95 Thesen
Die Antwort aus Rom kommt prompt
Verhör in Augsburg
Ein Sonderbotschafter aus Rom
Das Vorgefecht zu einer Disputation
Die Disputation in Leipzig
Der Fels auf dem ich stehe
Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche
Von der Freiheit eines Christenmenschen
An den christlichen Adel deutscher Nation
Die Bannandrohungsbulle wird verbrannt
Vor dem Reichstag in Worms
Ketzereien in einer stinkenden Pfütze
Auf der Wartburg
Zurück nach Wittenberg
Gegen falsche Propheten, Schwärmer und Rottengeister
Freunde kommen und gehen
Zeitenwende
Es wäre besser, dass alle Bischöfe ermordet würden..die Ritter befolgen es
Will Frau nicht, so kommt die Magd
Im Zwiespalt zwischen Bauern und Fürsten
Vielleicht hat er auch Feuer gefangen?
Luthers Kloster ein Taubenschlag
Der Marburger Abendmahlsstreit
Auf Schloss Ehrenburg in Coburg und die Augsburger Konfession
Zwischen Religion und Politik
Die letzten Jahre
Vorwort
Im Jahr 1507 lebt in Erfurt der Ordensbruder der Augustiner Bettelmönche Martin Luther. Er ist nach seinem Magisterstudium der Rechte völlig unerwartet in das Kloster eingetreten und hat sich für das Leben als Mönch entschieden. Schon bald erkennen seine Ordensbrüder, allen voran der Vikar Staupitz, was in diesem Mönch für eine theologische Kraft steckt.
Martin absolviert in Wittenberg ein Theologiestudium, promoviert und wird Professor an der Universität Wittenberg, die sich im Aufbau befindet. Luther hat viel Zulauf, da er sich sehr deutlich über Zustände in der Kirche und Gesellschaft äußert und Reformen fordert.
Die Augustinerklöster haben ein Problem in der Auslegung der Pflichten, die vom Ordensgründer Augustinus vorgegeben sind. Es gibt die Bewahrer und die Reformer. Staupitz, mittlerweile Generalvikar für die Klöster im deutschsprachigen Raum und Dekan der Universität Wittenberg, beauftragt Martin Luther, sich nach Rom zum General der Augustiner zu begeben, um dessen Entscheidung einzuholen.
Ein junger, kräftiger Ordensbruder aus Nürnberg, begleitet Martin auf der monatelangen Wanderung nach Rom, deren Strapazen man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Er durchwandert ganz Deutschland, die Schweiz, wäre in der berüchtigten Schlucht Via Mala beinahe abgestürzt, sieht in Bologna zum ersten Mal den Papst von Ferne, der dort gerade einen persönlich motivierten Krieg führt. Schließlich kommt er nach Rom, spricht bei seinem Generalvikar vor, absolviert einen Pilgerrundgang durch die heiligen Stätten und beobachtet das Treiben des Klerus im Vatikan.
Auf seinem Rückweg über Österreich muss er wieder unglaubliche Strapazen auf sich nehmen, hat aber viel Zeit, sich über das Erlebte Gedanken zu machen. Nach Erfurt zurückgekehrt, ist er immer noch Bruder Martin, im Herzen aber beseelt von dem Gedanken, seine römisch katholische Kirche müsse reformiert werden.
Der Ablasshandel, den er zutiefst ablehnt, gibt den Ausschlag. Damit beginnt sein Widerstand gegen seinen Erzbischof, gegen Rom und den Papst, schließlich auch gegen den Kaiser. Damit beginnt der Kirchenkampf Luthers, den er noch lange für einen Reformationskampf hält. Mit seinen Thesen gegen den Ablasshandel und seinen Schriften gerät er in einen Kulturstreit und einen politischen Kampf gegen die Vorherrschaft der römisch katholischen Kirche.
Dieser Glaubenskrieg hat seinen Höhepunkt in der Vorladung vor den Reichstag in Worms, wo er den Forderungen Roms und des Kaisers widersteht, seine Schriften zu widerrufen. Luther wird von Rom gebannt und über ihn wird vom Kaiser die Reichsacht verhängt. Da sich eine Reihe von Fürsten mit Luther solidarisiert, ist die Kirchenspaltung da. Kurfürst Friedrich der Weise schützt Luther vor dem Zugriff, indem er ihn auf der Wartburg versteckt.
Dort in der Einsamkeit übersetzt Luther die Bibel ins Deutsche und entwickelt die Grundlagen für eine neue, evangelische Kirche. Durch die Bauernaufstände und Kirchenschändungen gerät er in Konflikt mit Bauern und Eiferern, einige Schriften über das Judentum machen ihn angreifbar.
Luther erlebt noch ein persönliches, familiäres Glück durch seine Heirat mit Katharina von Bora, einer ehemaligen Nonne. Seine letzten Lebensjahre widmet er dem Aufbau und der Organisation der evangelischen Kirche. Im Kern ist Luthers Wirken ein Kampf für die Gewissens- und Glaubensfreiheit. Die Nebenwirkungen von Mord und Totschlag hat er nie gewollt. Er hat aber darunter gelitten.
Der Autor will zu den vielen historischen Analysen über Luther nicht noch eine weitere hinzufügen, sondern das Leben dieses großen Mannes, seine Ängste und Zweifel, seinen Glauben und seinen unglaublichen Mut in Form eines Romans beschreiben und den Leser mitnehmen in eine längst vergangene Zeit, die aber bis heute nachwirkt.
Trotz der dazu notwendigen Fantasie, sich in die Zeit hinein zu versetzen, versucht der Autor aber immer, treu an den Fakten zu bleiben und auch den Unterstützern und Gegenspielern Luthers aus dem Zeitverständnis heraus nach Möglichkeit gerecht zu werden, wobei die damalige Sprache der heutigen etwas angepasst werden muss.
Für vertiefende Studien stehen ganze Bibliotheken und Datenbänke zur Verfügung. Beispielhaft seien genannt: Richard Friedenthal – Luther. Sein Leben und seine Zeit; ein hervorragendes Werk über das Leben Luthers und ein tiefer Blick in die Zeitgeschichte. Hellmut Diwald. Luther. Eine Biografie. E:A:W.Krauß. Das Gotteswerk der Kirchenreformation durch Martin Luther, zu finden unter: www.lutherische-bekenntnisgemeinde.de. Martin Luther und die Reformation. GEO EPOCHE Nr. 39. Ganz aktuell: Hundert Jahre Aufruhr in Europa. Das Zeitalter der Reformation. DER SPIEGEL. Edition Geschichte. Ausgabe 2/2017. Ebenfalls zu empfehlen: Tilmann Bedikowski. Der Deutsche Glaubenskrieg. Martin Luther, der Papst und die Folgen.
Personen
Martin Luther, geb. 10.11.1483 in Eisleben als erster Sohn von Margarethe und Hans Luder. Ab 1501 Jurastudium an der Universität Erfurt. Abschluss 1504 als Magister und Eintritt am 14.07.1504 in das Erfurter Kloster der Augustiner- Eremiten. 1507 Priesterweihe und Theologiestudium an der Universität Wittenberg, ab 1508 Lektor, später Dozent der Philosophie und nach seiner Promotion auch Professor für Theologie. Heiratet 1525 Katharina von Bora und lebt bis kurz vor seinem Tod in Wittenberg. Er stirbt am 18.02. 1546 in Eisleben.
Katharina von Bora, 1499 – 1552. Sächsische Adelige und Ordensschwester. Heiratet 1525 Martin Luther.
Johann von Staupitz, 1468 – 1542. Generalvikar der sächsischen Reformkongregation des Augustinerordens, Mitbegründer der Universität Wittenberg, Professor der Theologischen Fakultät und erster Dekan der Universität. 1520 Domprediger in Salzburg und Abt des Salzburger Benediktinerordens.
Kurfrist Friedrich III (der Weise) von Sachsen (Kursachsen), aus der ernestinischen Linie der Wettiner nach der 1485 vorgenommenen Leipziger Teilung. 1463 – 1525. Förderer und Beschützer Martin Luthers. Zeitweise Generalstadthalter des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation unter Maximilian I.
Konrad Helt, Prior des Schwarzen Klosters zu Wittenberg und Vorgesetzter Martin Luthers während seines Aufenthalts in Wittenberg
Georg Burkhardt, genannt Spalatin, 1884 – 1545. Humanist, Theologe und Reformator. Erzieher und späterer Sekretär des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen.
Konrad Lange, Augustinermönch und Theologe, lebenslanger Freund Martin Luthers
Leo X., geb. Giovanni de Medici, 1475 – 1521. Seit 1513 Papst als Nachfolger Papst Julius II. Sehr umstrittener Papst wegen seiner verschwenderischen Lebensführung, Förderer der Kunst, Führte einen Kirchenkampf gegen Luther.
Thomas Cajetan, 1469 – 1534. Ordensgeneral der Dominikaner und Kardinal. Hörte Luther 1518 in Augsburg an.
Andreas Rudolf Bodenstein, genannt Karlstadt, 1486 – 1541. Professor der Theologie an der Universität Wittenberg, Doktorvater Luthers, anfänglich Unterstützer der Reformation geriet er später in Widerstand zu Luther.
Philipp Melanchthon, 1497 – 1560, Altphilologe, Philosoph, Humanist, Theologe. Seit 1518 Professor an der Wittenberger Universität und lebenslanger Freund und Unterstützer Luthers.
Justus Jonas, 1493 – 1555. Jurist, Humanist, Kirchenliederdichter, Theologe, Prediger und Reformator.
Johannes Bugenhagen, 1485 – 1558. Pfarrer an der Stadtkirche Wittenberg, Lehrer an der Universität Wittenberg, Generalsuperintendant und Reformator. Lebenslanger Freund Martin Luthers.
Sowie:
eine Vielzahl von Zeitgenossen: Professoren, Theologen, Studenten, Fürsten, die im Roman vorkommen, aber nicht im Personenverzeichnis aufgenommen werden können.
Wittenberg am Rande der Zivilisation
Martin Luther ist fünfundzwanzig Jahre alt, hat sich seit drei Jahren mit seinen Zweifeln und Gewissensfragen im Augustinerkloster Erfurt herumgeschlagen - erfolglos, wie er immer noch meint - da entscheidet sein Abt und Vorgesetzter, er müsse etwas zu tun bekommen.
Dem Kurfürsten Friedrich hat Johann von Staupitz - Generalvikar der Augustiner - zugesagt, das Kloster Erfurt werde eine Dozentenstelle für Moralphilosophie an der neu gegründeten Universität Wittenberg besetzen. Das kostet den Hof außer Unterkunft und Verpflegung nichts. Außerdem soll Luther nebenbei die Möglichkeit erhalten, zusätzlich zum erfolgreichen Studium der Rechte, ein Theologiestudium zu absolvieren, um auch für diesen Lehrstuhl dann zur Verfügung zu stehen. Staupitz selber ist Professor für diesen Lehrstuhl.
So macht sich Martin Luther mit leichtem Bündel wenig begeistert auf den Weg von Erfurt über Weimar, Naumburg, Halle und Delitzsch nach Wittenberg. Zu Fuß braucht er für die fast zweihundert Kilometer eine Woche. Es geht über ausgefahrene Land- und Forstwege, häufig erkundigt er sich nach dem nächsten Ort und für einen Alleinreisenden ist der Fußmarsch nicht ganz ungefährlich, da sich auf den Landstraßen allerhand Gesindel herumtreibt.
Was ihn aber schützt, ist die Kutte des Bettelmönchs. Der Ordensregel entsprechend, hat er mit niedergeschlagenen Augen, die Hände in den Ärmeln der Kutte verstaut, zu pilgern. Sein Blick soll nicht schweifen, geschweige denn an einem Weibe haften bleiben. Er hat auch nicht zu sprechen, Gedanken sind erlaubt. Nicht einmal der dümmste Landstreicher bildet sich ein, dass von dieser traurigen Erscheinung irgend etwas zu holen ist.
Alles, was ihm auf dem Wege begegnet, nicht hinzuschauen, ist sicher nicht ganz einfach. Auf den Wegen und Feldern, in den Wäldern und in den Orten, spielt sich ein wildes und ungezügeltes Leben ab. Landstreicher, Diebe, Dirnen, Kaufleute und Raubritter sind unterwegs. In manchem Ort herrscht Gerichtstag. Leichen baumeln an den Galgen oder Bäumen. Überfälle und Händel sind kaum zu übersehen. Man ist auch gut beraten, sich um am Wegrand liegende Leichen nicht zu kümmern. Zu viel Neugier kann nur Schwierigkeiten bringen.
So kommt er unversehrt am fünften Tag vor die Tore Wittenbergs. Seit Leipzig hat ihn ein Student begleitet. Nach den Ordensregeln hat ihm Luther aber bedeutet, nur das Notwendigste zu sprechen. Was er vor Wittenberg zu sehen bekommt, versetzt ihn schon in Erstaunen. Über eine wackelige Holzbrücke gelangt er über die Elbe und steht dann vor den Stadtmauern Wittenbergs. Er kann kaum glauben, was er sieht. Ein kleines Städtchen, ganz umfasst von einer Stadtmauer, an der an verschiedenen Stellen noch gebaut wird.. Einige wenige Türme überragen das insgesamt niedrige Stadtbild und überall herrscht rege Bautätigkeit.
Er durchwandert ganz langsam die Gassen, nachdem er zuvor ohne Probleme das Stadttor passieren durfte; Augustiner sind auch hier bekannt. Das größte Gebäude – eine Schlossanlage - muss wohl die kurfürstliche Residenz sein - ebenfalls eine Baustelle. Fast angelehnt an die Residenz steht eine Kirche, deren Turm auch noch nicht ganz fertig ist, die Schlosskirche. Ansonsten sieht er einige Steinhäuser, überwiegend Lehmhütten, die mit Stroh gedeckt sind. „Die Wittenberger leben am Rande der Zivilisation“, wird er später einmal sagen. Aber das wird sich ja ändern, nicht zuletzt seinetwegen. Das kann Martin Luther zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen.
Er begibt sich in das Augustinerkloster, seiner neuen Heimat, und meldet sich beim Torwächter, der ihn durch ein kleines Fenster mustert, dann aber erkennt, dass es sich wohl um den schon erwarteten Bruder Martin handeln muss. Rasch wird das Tor geöffnet und ihm wird bedeutet, er werde schon seit gestern erwartet. Der Vater Prior ist schon etwas ungeduldig, bedeutet ihm der Torwächter.
Martin bedankt sich, legt dem Bruder die Hand auf die Schulter und lässt sich den Weg erklären. Wenig später steht er vor Konrad Helt, dem Prior des Schwarzen Klosters, wie man es ein wenig spöttisch nennt. Helt macht Anstalten sich zu erheben, doch Martin erkennt, dass ihm dies schwer fallen dürfte, angesichts seiner doch beachtlichen Leibesfülle. So geht er rasch zu dem noch sitzenden, künftigen Vorgesetzten, beugt sich zu ihm nieder und umfasst beide Hände. „Da bin ich, Vater Prior, ich war so schnell unterwegs, wie es mir möglich war.“ Der Prior lächelt Martin an: „Schon gut, hat dir der Bruder Torwächter erzählt, ich sei schon ungeduldig? Das ist eine meiner unschönen Eigenschaften, die ich noch überwinden muss. Wie geht es dir, vor allem gibt es Neues aus Erfurt?“
Luther nimm auf einem Schemel Platz und schaut Vater Konrad freundlich an, er mag ihn vom ersten Augenblick an. „Man hat mich aufgefordert nach Wittenberg zu kommen“, beginnt Luther seinen Bericht, „man möchte, dass ich hier unterrichte, gleichzeitig aber auch die Theologie studiere, was beim Generalvikar Staupitz ja gut möglich ist.“ „Bevor ich es vergesse, der Vikar erwartet dich auch schon, du musst dich rasch bei ihm melden.“ Luther nickt und fährt mit seinem Bericht fort. Er erzählt, wie aufregend er Erfurt findet, was im Kloster mit großem Ernst diskutiert wird und warum er es noch zu früh findet, schon jetzt an der Universität in Wittenberg zu lehren. „Du machst die zu viele Gedanken, Martin. Staupitz und dein Prior halten es für richtig, dass du aus deiner Klosterzelle herauskommst und dein Wissen und deine Überzeugungen an andere weitergibst. Dass du nebenbei auch noch Theologie studieren kannst, betrachte es als Privileg. Mir wird schwindlig, wenn ich daran denke, wie gelehrt du am Ende sein wirst.“
Luther wirkt betroffen und nickt stumm. „Noch etwas“, fährt der Prior fort: „erwarte nicht, dass man dich hier mit offenen Armen aufnimmt. Man fragt sich, womit du soviel Fürsorge verdient hast? Vor allem ist man sich nicht darüber im Klaren, was du hier eigentlich lehren kannst. Du solltest das von Anfang an wissen und dich darauf einstellen. Ich sage dir das, weil ich nicht möchte, dass du unnötige Fehler machst. Sei also demütig und freundlich. Man wird dich dann schnell in den Kreis der Lehrenden aufnehmen.“ Luther nickt und kniet nieder: „Vater Prior, ich danke ihnen sehr. Seien sie überzeugt, dass ich ein gehorsamer Klosterbruder sein werde. Mein Orden steht an erster Stelle, da gehöre ich hin.“
Kompliziertes religiöses Gemeindewesen in Wittenberg
Luther begibt sich gleich am nächsten Tag zum Dekan der Universität Johann von Staupitz, den er schon gut aus Erfurt kennt und bei dem er das Gefühl hat, unter besonderer Beobachtung zu stehen. Staupitz geht mit Luther, der die Kutte trägt, zum Fenster und weist in den Hof der Universität: „Wir sind froh, jetzt in diesem Gebäude zu sein. In den Räumen des Klosters war es doch ziemlich eng. Die Universität ist noch im Aufbau und zwar in jeder Hinsicht. Ich freue mich, dass du, Bruder Martinus, jetzt bei uns bist und unseren Lehrkörper verstärken wirst. Daher ein herzliches Willkommen.“ Luther nimmt beide Hände von Staupitz zur Begrüßung und verbeugt sich leicht. Staupitz führt ihn an einen schweren Eichentisch mit ebenso schweren Stühlen und nimmt Platz. „Was gibt es Neues in Erfurt?“
„Unruhen machen sich breit“, berichtet Luther, „es geht um Geld und Steuern und um das Handwerk. Die Bürger begehren gegen den Rat auf und der Erzbischof hat Truppen geschickt.“ „Das war zu erwarten“, brummt Staupitz, „Schuld trägt vor allem der Hochmut des Oberviermeisters Kellner, der einfach nicht einsehen kann, dass die Stadtkasse nicht ihm gehört. Aber was soll's, hier in Wittenberg sind die Dinge auch schwierig. ..
Das liegt aber an anderen Problemen, die schon weit in die Vergangenheit zurückreichen. Das Wittenberger Domkapitel ist nach Verträgen des Kurfürsten mit der Kurie in Rom im Prinzip unabhängig von der klerikalen Hierarchie. Wir nennen das Exemtionsprivilegien. Mit anderen Worten, der zuständige Bischof von Brandenburg hat hier im Prinzip nichts zu sagen, ebenso der von Magdeburg, sogar der Erzbischof von Mainz ist ausgeschaltet.“ „Das war mir nicht bekannt“, sagt Luther.
„Woher auch, das ist das Werk unseres sehr schlauen Kurfürsten Friedrich, der den Einfluss der Kirche begrenzen möchte und das auch geschafft hat, sicher für viel Geld an den Papst. Dafür hat er sich aber einen Dauerstreit mit dem Bischof von Brandenburg, einem Ausländer aus seiner Sicht, eingehandelt.“ „Was tut der?“ fragt Luther nach. „Der hat ein anderes Schwert, dass man ihm nicht nehmen kann. Mittels lokaler Interdikte kann er Strafen über die Kirchen in Wittenberg verhängen und dagegen kann der Kurfürst gar nichts machen.“ „Was bedeutet das?“ „Ganz einfach. Es gibt immer einen Grund dafür. Da genügt es schon, wenn Schulbuben den Kirchhof entweihen, also dort spielen. Schon verhängt der Bischof ein Interdikt, mit dem er die Weihe der Kirche aufhebt und damit verbietet er jede kirchliche Tätigkeit. Erst wenn der Kurfürst zu Kreuze kriecht und Geld gibt, hebt er das Interdikt wieder auf und weiht die Kirche aufs Neue.“ „Ist das schon passiert?“ Staupitz lacht laut auf: „Ja, regelmäßig. Der geringste Anlass genügt. Aber lassen wir das. Du solltest das nur wissen.“
Staupitz wechselt das Thema: „Martin, trag bitte als Lehrer einen dunklen Talar, so wie ich. Ich lass dir einen anpassen. Du wirst zunächst einmal das lehren, was du kannst, nämlich die Philosophie des Aristoteles, dessen Physik und Ethik. Das soll für den Anfang genügen.“ Luther schaut verdutzt: Davon verstehe ich kaum etwas, das muss ich mir aufs Neue aneignen.“ Staupitz schmunzelt: „Professoren lernen bei ihren Vorlesungen am meisten. Du wirst bei mir auch Theologie hören. Ich halte das für ganz wichtig, da wir noch viel mit dir in der Zukunft vorhaben. Du musst in Theologie promovieren. Halte dich also ran, vergiss nur nicht deinen regelmäßigen Schlaf, Martin. Niemandem ist gedient, wenn du es übertreibst und am Ende nicht durchhältst. Morgen werde ich dir die Kollegen vorstellen, Koch ist auf dem Sprung nach Brandenburg, aber Trutfetter kennst du schon. Bei den Vorlesungen genügt es, wenn du vor deinen Studenten alles gelesen und verstanden hast und insofern einen Vorsprung hast. Bei der Theologie halte dich an mich. Wenn die Professoren etwas merkwürdig am Anfang sind, kümmere dich nicht darum. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie dich akzeptieren.“
Luther stürzt sich in die Arbeit, was ihm nicht schwerfällt. Er studiert Tag und Nacht, liest Vorlesungen, hört selber Theologie bei Staupitz, wird gefördert, schreibt Briefe nach Erfurt und ist erstaunt, als Staupitz ihn eines Tages rufen lässt. Luther hat noch nicht ganz Platz am Eichentisch genommen, als dieser ihm eröffnet: „Martinus, du musst zurück nach Erfurt. Frag mich jetzt nicht warum. Mit dir und deiner Arbeit hier hat das überhaupt nichts zu tun. Ich habe schon mit Spalatin gesprochen, du weißt wohl, dem Sekretär des Kurfürsten. Bei Hof weiß man auch von nichts, aber man wird sich darum kümmern. Ich kann mir nur erklären, dass man dich an der Erfurter Universität einsetzen möchte und die haben mehr Einfluss als ich. Bis das geklärt ist, mach dich schon morgen auf den Weg nach Erfurt und schreibe mir. Ich kümmere mich hier darum, um was es geht. Ich möchte dich so bald, wie möglich wieder hier haben.“
Zurück in den Bürgerkrieg
Luther meldet sich bei seinem Prior Konrad Helt ab. Der tröstet Luther: „Mach dir nichts draus, Martin, die Welt ist voller Rätsel. Ein kleiner Prior kann da wenig machen. Du hast aber starke Verbündete mit Staupitz und Spalatin. Warte geduldig ab. Die werden schon alles richten. Ich hoffe, dich bald wieder zu sehen. Du erhältst das nächste Mal eine Studierstube im Turm. Die halte ich dir frei. Alles Gute, mein Sohn.“
Luther macht sich auf den Weg zurück nach Erfurt. Unterwegs hat er bei schon bekanntem Treiben auf den Straßen und in den Orten viel Zeit über alles nachzudenken. Auf den Rückruf nach Erfurt kann er sich beim besten Willen keinen Reim machen. So kommt er nach einigen Tagen wieder in Erfurt an, betritt sein ihm vertrautes Kloster und möchte sich beim Prior melden. Der ist abwesend und an seiner statt begrüßen ihn Dr. Usinger, den Luther schon als Lehrer hatte und sein Freund Johannes Lang. Usinger ahnt wohl, welche Gedanken Luther bewegen und beginnt sofort mit einer Erklärung: „Martin, wir können uns gut vorstellen, dass dich der Rückruf nach Jena in Verwirrung gesetzt hat.“ „Gewiss“, sagt Luther, „vielleicht könnt ihr mir das erklären, wenn der Prior schon nicht da ist.“
Lang legt Luther freundschaftlich die Hand auf die Schulter: „Nimm es nicht tragisch, Martin. Es geht gar nicht um dich, es geht um Geld. Das Kloster soll die Kosten für dein Theologiestudium, vielleicht sogar noch für deine Promotion übernehmen und das will hier niemand. Daher der Rückruf.“ „Das kann ich nicht glauben. Dafür lässt man mich den weiten Weg zurück laufen?“ „Bewegung ist gut, Martin. Sieh es als Ertüchtigung an. Man wird dich bald wieder nach Wittenberg holen, das sollen wir dir vom Vater Prior ausrichten. Der ist nämlich jetzt in Wittenberg bei Hof und klärt die Dinge. In der Zwischenzeit musst du dich vorsehen. Hier herrscht so etwas, wie Bürgerkrieg. Ich werde dir das alles noch im einzelnen erklären. Richte dich aber zunächst in deiner Zelle wieder ein. Wenn du willst, kannst du schon morgen die Messe abhalten. Fühle dich wieder ganz als Priester. Wenn du hier in Erfurt an der Universität lehren würdest, wäre das kein Problem. Wittenberg ist aber Ausland und wenn der Kurfürst dich dort haben möchte, dann muss er auch das Geld für dein Studium und für die Promotion geben. Darum geht es.“
„Und was ist mit dem Bürgerkrieg?“ möchte Luther wissen. „Komm, Martin“, sagt Lang, „wir setzen uns in den Garten und dann kann ich dir alles in Ruhe erklären.“
Beide begeben sich in den Klosterpark, schlendern ein wenig über den Kiesweg und nehmen dann im Schatten einer Buche auf einer Bank Platz. Lang beginnt in seiner ruhigen Art über die neuesten Ereignisse in Erfurt zu berichten. „Es geht wieder um Geld, Martin. Wir bekommen das im Kloster nicht so zu spüren, zahlen ja keine Steuern, die Bürger aber schon. Da haben sich einige Handwerker aufgeregt, dass das Stadtregiment Kredite aufgenommen hat und sich das Geld angeblich in die Taschen gesteckt hat, jedenfalls wird das behauptet. Und wenn etwas behauptet wird, dann kommt es schon gar nicht mehr auf die Wahrheit an. Die Menschen wollen sich einfach ärgern. Die Stadtoberen sind auch selber Schuld, so arrogant sie sich verhalten. Stell dir vor, der Oberviermeister Kellner hat sich sogar geleistet, seinem Schreiber zu sagen, wenn er nicht mehr wüsste, an die hundert Gulden zu belegen, dann solle er doch einfach schreiben: ausgegeben für das Hurenhaus.“
Luther muss schmunzeln. „Das war doch wohl ein Spaß?“ „Sicher, Martin, aber das haben die Leute anders gesehen. Man ging vors Rathaus mit Waffen und hat damit gedroht, das Rathaus zu besetzen und den Oberviermeister zu vierteilen. Der hat natürlich erst einmal das Weite gesucht, die Gesellen gaben aber keine Ruhe mehr. Da hat der Erzbischof seine Landsknechte geschickt, damit sie für Ruhe sorgen sollten. Die ist aber nicht eingetreten. Statt dessen gab es Straßenschlachten und die Studenten der Universität haben auch mitgemacht. Das Hauptgebäude der Universität wurde angezündet und die Bücher auf dem Marktplatz verbrannt.“
„Wie ging das aus?“ „Man hat Gericht gehalten, den Oberviermeister verurteilt und dann unter dem Gejohle der Leute aufgehängt.“ „Das ist ja schrecklich. In Wittenberg ist es dagegen ganz friedlich.“ „Da gibt es aber auch einen klugen Kurfürsten, der es gar nicht so weit kommen lässt.“ „Trotzdem“, bemerkt Luther, „dazu hat das Volk kein Recht. Ich glaube ja, dass die Menschen innerlich frei sind, äußerlich müssen sie sich aber fügen, sonst ist kein Zusammenleben möglich. Ordnung muss sein.“ Beide verharren jetzt schweigsam, wie es eigentlich Ordensregel ist. „Unser Gespräch muss ich beichten“, meint Luther kurz, erhebt sich und begibt sich in seine Zelle. Schon bald wird er sich wieder auf den Weg nach Wittenberg machen, nachdem sein Prior ihm erklärt hat, die Dinge seien jetzt im besten Einvernehmen geregelt.
Kaum zurück in Wittenberg geht es schon wieder fort
Staupitz und Spalatin haben Kurfürst Friedrich davon überzeugt, die Kosten für Luthers Promotion in Wittenberg zu übernehmen. Der hat das eingesehen und ganz klar gemacht, dass es ihm vor allem darauf ankommt, Luther an der Wittenberger Universität zu haben. „Der Luther ist für uns so wichtig, wie ich“, meint Kurfürst Friedrich, „der sorgt dafür, dass immer mehr Gelehrte und Studenten nach Wittenberg kommen. Die kommen ganz bestimmt nicht meinetwegen. Eher schon wegen der Reliquiensammlung. Geben sie das Geld, Spalatin, es ist gut angelegt. Sie werden sehen.“
Staupitz kann Luther daher sofort nach dessen Rückkehr die gute Nachricht von seiner Zukunft in Wittenberg berichten. „Ich freue mich sehr darüber, Martin“, sagt er, „fürs Erste brauchst du dich aber noch nicht wieder hier niederzulassen. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Du musst mit einem Ordensbruder aus Nürnberg sofort nach Rom zum Generalvikar. Wir brauchen dessen Entscheidung in unserem Ordensstreit.“ Luther verschlägt es die Sprache.
Nachdem er auch nach einigen Minuten nicht antwortet, fährt Staupitz fort: „Du bist überrascht, Martin, und das wundert mich auch nicht. In Rom kannst du gleich deine Pilgerpflichten erledigen und dir einen ordentlichen Ablass verdienen. Sieh das doch einfach so. Du verbindest das Gute mit dem Nützlichen. Vielleicht solltest du aber erst einmal eine Nacht darüber schlafen, dann erkläre ich dir genau deinen Auftrag. Der ist für uns Augustiner sehr wichtig. Wir müssen wieder einheitliche Ordensregeln haben und dazu musst du nach Rom.“
Martin Luther begibt sich sichtlich verwirrt in seine ihm neu zugewiesene Klosterzelle, diesmal wesentlich geräumiger und heller. Sie befindet sich im Turm des Klosters. Er überlegt, ob er diesen Auftrag überhaupt durchführen kann. Schließlich will er ja Theologie studieren und soll jetzt vorher auf eine so große Reise gehen. Ist er den Strapazen einer solchen Reise, die er ja fast ausschließlich zu Fuß machen wird, überhaupt gewachsen? Und kann er den Auftrag seines Vorgesetzten, der vor einem Monat zum Ordensprovinzial von Sachsen und Thüringen ernannt worden ist, überhaupt ablehnen? Er ist bei Strafe verpflichtet, die Anordnungen des Provinzials zu befolgen, der ein überzeugter Verfechter der Observanz und der Union der Augustinerklöster ist. Eine unruhige Nacht liegt vor ihm, immer wieder unterbrochen von schweren Gedanken, Zweifeln und Gebeten. Am Morgen ist Luther klar, er muss den Auftrag ausführen und nach Rom gehen.
Staupitz sucht ihn schon früh am Morgen in seiner Zelle auf. „Du hast schlecht geschlafen, Martin. Vor der Reise musst du das noch nachholen. Also hör zu, was ich dir sage. Du begibst dich zuerst über Erfurt nach Nürnberg. Der dortige Prior Kress erwartet dich schon. Kress ist ein Oppositioneller und wollte ursprünglich selber nach Rom gehen, kann dies aber wegen seines Gesundheitszustandes nicht mehr. Er wird dir seinen Standpunkt erklären und dir eine weitere Denkschrift mitgeben, meine händige ich dir noch aus, zusammen mit einem Beglaubigungsschreiben für die Reise und die Einkehr in den Augustinerklöstern, die du regelmäßig aufzusuchen hast. Kress wird dir auch einen Begleiter mitgeben, denn es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Beide Denkschriften sollen in Rom dem Ordensgeneral Ägidius Canisio von Viterbo vorgelegt werden. Der General wird dir dann seine Entscheidung in dem Ordensstreit mitteilen und schriftlich in einem Dekret aushändigen. Versäume keine Zeit unterwegs, die Angelegenheit ist zu wichtig. Nach deiner Rückkehr begleitest du mich sann noch nach Köln, wo wir auf einem Ordenskongress alle Fragen abschließend klären und bekanntgeben wollen. Du siehst, welche Bedeutung deine Reise hat. Sie ist für dich besonders wichtig, da du ursprünglich nur als Begleiter vorgesehen warst. Jetzt hast du den Auftrag unmittelbar von mir. Ich hoffe, dass du meinen Standpunkt aus Überzeugung teilst und dass ich mich auf dich verlassen kann.“
Martin Luther hat aufmerksam zugehört. Er erwidert nichts in der Angelegenheit, sondern nickt nur. Nach einer kurzen Pause sagt er ganz leise: „Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich bitte um euren Segen.“
Von Wittenberg nach Nürnberg
Wieder auf der Wanderung. Martin Luther trägt ein leichtes Bündel auf der Schulter, darin die wichtigen Dokumente, etwas Brot und Wasser und eine handschriftliche Wegbeschreibung. Wieder geht es zunächst nach Erfurt, wo er sich kurz ausruht, mit dem Prior und seinen Freunden spricht, sich aber unter keinen Umständen über seinen Auftrag befragen lässt. Er nimmt noch einmal am gemeinsamen Mahl mit seinen Ordensbrüdern teil, besucht die Messe in der Klosterkapelle und macht sich dann ohne Umschweife auf den weiten Weg nach Nürnberg. Er weiß, dass jetzt über zweihundert Kilometer vor ihm liegen und hofft, dass Gott ihm die Kraft geben möge, diese lange Strecke gut zu überstehen. Die Regeln besagen, dass er sich keinesfalls mitnehmen lassen soll, er hat den Weg zu Fuß zurückzulegen.