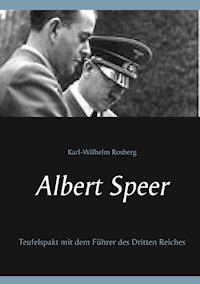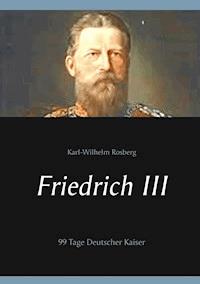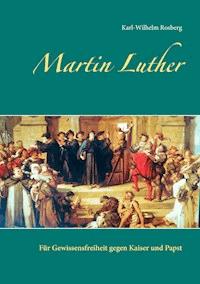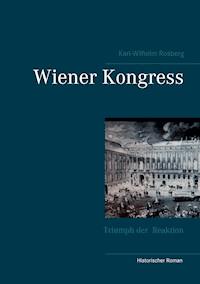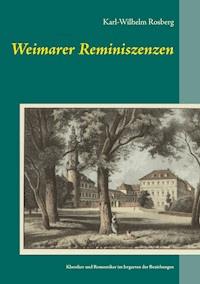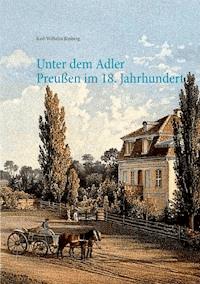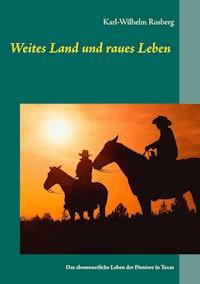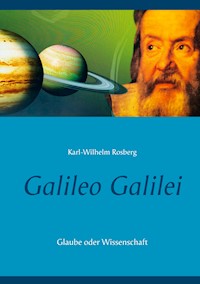
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Galileo Galilei geriet 1616 in einen Konflikt mit der Inquisition, da er sich dem Weltbild des Kopernikus anschloss und behauptete, nicht die Erde sei das Zentrum der Welt, sondern sie bewege sich wie alle Planeten in einer Umlaufbahn um die Sonne und drehe sich einmal täglich um sich selbst. In einem entwürdigenden Prozess zwang man ihn 1631 unter Androhung von Folter und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, diesem zutreffenden Weltbild abzuschwören, was er tat. Wie steht die Katholische Kirche heute zu Galilei und diesem fragwürdigen Prozess? Was hat sich an dem Glaubensanspruch der Katholischen Kirche seither verändert? Ein Blick in den Weltkatechismus gibt die Antwort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Personen
Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Herkunft und Lehrjahre. Aller Anfang ist schwer
Thronwechsel in Florenz schafft Beziehungen
Als Professor in Pisa und Padua.„Moderne Wissenschaft muss forschen.“
Astronomische Entdeckungen und schwerwiegende Folgerungen
Kopernikus und Kepler. Vordenker eines modernen Weltbildes
Jesuiten und Dominikaner. Der Widerstand sammelt sich
Das Verfahren von 1616, eine ernste Warnung
Die Inquisition. Schwert der katholischen Kirche in der Gegenreformation
Schwer getroffen, aber nicht gebrochen
Stein des Anstoßes: „Der Dialog“, genehmigt aber intellektuell wohl nicht verstanden
Vorladung nach Rom. Der Vatikan entfaltet seine Macht
Der Prozess. Fälschung,Erpressung, Demütigung, Würdelosigkeit
Das Urteil. Eine ewige Schande für den Papst und die katholische Kirche
Hausarrest bis zum Tode
Hass über den Tod hinaus. Nicht einmal ein würdiges Begräbnis
Forschung und Rehabilitation 1992 durch Papst Johannes Paul II.Eingeständnis durch Einsicht?
Glaubenskongregation heute. Nur der Name und die Methoden haben sich geändert
Der Fall Hans Küng. Vernichtung ohne Rechtsmittel, zum Glück auch ohne Scheiterhaufen
Katholische Kirche heute. Weltkatechismus
Nachbetrachtung
Bildnachweis
Vorwort
Der „Große Galileo Galilei“ hat es verdient, dass er nie in Vergessenheit geraten möge. Geboren am 15. Februar 1564, gestorben am 8. Januar 1642, war er de facto der Begründer der „neuen Naturwissenschaften“. Zugleich war er ein überzeugter Christ und gehorsamer Angehöriger der römisch katholischen Kirche. Er glaubte fest daran, dass Gott den Menschen ihren Verstand gegeben hat, damit sie ihn zum Ruhm seiner Schöpfung gebrauchen sollten. Soweit es um das Studium der Bibel ging, insbesondere der Schöpfungsgeschichte, war er davon überzeugt, dass man die uralten Texte im Lichte des Fortschritts der Wissenschaft immer wieder neu interpretieren musste und dass wissenschaftliche Erkenntnisse so nie in Widerspruch zur Heiligen Schrift kommen könnten. Damit begab er sich auf einen damals für jedermann gefährlichen Weg. Die römisch katholische Kirche, insbesondere die sogenannte „Heilige Inquisition“, beanspruchte jedwede theologische Auslegung der Bibel ausschließlich für die Kirche und ihren geweihten Klerus, schlussendlich durch den Papst, der auch alle weltliche Hoheit für sich in Anspruch nahm. So geriet Galilei schließlich in hohem Alter in die Fänge der Inquisition, die ihm einen brutalen Prozess machte, der ihn an die Grenzen der Würdelosigkeit und Selbstachtung brachte, indem man ihn unter Androhung von Folter und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen dazu brachte, alles zu leugnen, wovon er als Wissenschaftler überzeugt war.
Wäre Galileo zum Zeitpunkt des Prozesses nicht bereits europaweit berühmt gewesen, so hätte man ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit umgebracht, so wie es vielen anderen vor ihm auch ergangen war.
Das Buch beschreibt diesen historisch einschneidenden Vorgang und seine Vorgeschichte anhand von Szenen, die – wo immer möglich – in anschaulicher Form das ganze Geschehen schildern, um die Leser so in die Gegenwart der damaligen Zeit zurückzuführen. Auf die Form einer umfassenden Biografie wird bewusst verzichtet, da es Darstellungen über Galileo bereits in großer Zahl und hoher Qualität gibt. Genannt seien beispielhaft: Rudolf Krämer-Badoni: Galileo Galilei. Wissenschaftler und Revolutionär; Johannes Hemleben: Galileo Galilei; Atle Naess: Als die Welt still stand. Galileo Galilei – verraten, verkannt, verehrt; S. Fischer – Fabian: Die Macht des Gewissens; WIKIPEDIA: Galileo Galilei; www.geo.de: Weltveränderer Galileo Galilei; Fritz Krafft: Die bedeutendsten Astronomen; Martin Carrier: Nikolaus Kopernikus; Gerhard Wehr: Giordano Bruno; Hermann Schreiber: Geschichte der Päpste; Karl- Wilhelm Rosberg: Martin Luther. Für Gewissensfreiheit gegen Kaiser und Papst; Hans Küng: Umstrittene Wahrheit; Hans Küng: Erkämpfte Freiheit; Volker Spierling: Kleine Geschichte der Philosophie; Peter Michel: Der Anti – Weltkatechismus. Christ sein in Liebe und Freiheit; DER SPIEGEL Geschichte: Die Menschen im Mittelalter. Herrscher, Ketzer, Minnesänger; DIE ZEIT Geschichte: Die Kirche und ihre Ketzer. In Gottes Namen: Der Kampf um den rechten Glauben vom Mittelalter bis heute; P.M. Magazin: Die Geheimarchive der Inquisition.
Dies ist nur eine Auswahl hervorragender Darstellungen und Aufarbeitungen der Geschichte und des Falles Galileo. Zur besseren Lesbarkeit verzichtet der Verfasser auf Anmerkungen und detaillierte Quellennachweise. Da wo wörtlich zitiert wird, werden die Quellen selbstverständlich genannt. Ein Nachweis der Bilderquellen befindet sich im Anhang.
Personen
Galileo Galilei, * 15. Februar 1564 in Pisa, + 8. Januar 1642 in Arcetri Philosoph, Physiker, Mathematiker, Astronom, Professor, Schriftsteller.
Vincenzo Galilei (1520 - 1591) und Giulia Ammanati (1538 - 1620), Eltern von Galileo Galilei.
Christopher Clavius, Jesuitenpater am Collegio Romano (1538 - 1612)
Ostilio Ricci, Militäringenieur und Mathematiker (1540 – 1603)
Johannes Kepler (1571 – 1630) Theologe, Mathematiker, Astrologe und wissenschaftlicher Vertrauter Galileis
Nicolaus Kopernikus (1473 – 1543) Domherr, Administrator, befasst mit Astronomie. Schaffte ein heliozentrisches Weltbild und wurde von der katholischen Kirche mit seinen Werken auf den Index gesetzt.
Maffeo Barberini (1631 -1685) Bewunderer und Förderer Galileis, Kardinal und als Papst Urban VIII ein gnadenloser Gegner Galileis.
Roberto Bellarmin ( 1542 – 1621 ) Jesuit, Kardinal und Skeptiker gegenüber Galileis Wissenschaft. Großinquisitor gegen Giordano Bruno.
Dies ist eine Auswahl der wichtigsten Personen. Es können nicht alle genannt werden.
Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Italien befindet sich seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts in einem sozialökonomischen Umbruch. Die Renaissance, als Wiedergeburt antiker Traditionen verstanden, ist aber viel mehr. Die Epoche bringt mit erstaunlicher Kraft große Architektur hervor und geniale Kunstwerke. Sie beeinflusst auch die Gelehrsamkeit an den Universitäten. Letztere allerdings nicht ohne retardierende Kräfte, die nach wie vor auf die großen humanistischen Philosophen bauen: Aristoteles und Platon zum Beispiel, die nur mit der Kraft ihrer Vernunft die Welt erklärten, aus Sicht damaliger Gelehrter, wohl für alle Zeiten.
Italien nach heutigem Geografieverständnis gibt es noch nicht oder nach dem Fall des Römischen Reiches über tausend Jahre zuvor, nicht mehr. Das Land ist politisch stark zergliedert. An die Stelle des untergegangenen römischen Zentralstaates sind kleine Stadtstaaten, Herzogtümer und Königreiche getreten, beherrscht von einflussreichen Familien, die in ständigen Rivalitäten ihre Macht - vor allem ihre wirtschaftliche Macht – austarieren und häufig auch auskämpfen. Venedig, Mailand, Florenz und Genua sind beispielhaft zu nennen.
Dann gibt es noch den Kirchenstaat um Rom und den Vatikan herum. Der Papst beansprucht die Oberherrschaft über alle andere Herrschaft, sogar weltweit und beruft sich dabei auf ein nachweislich gefälschtes Dokument, die „Konstantinische Schenkung“. In der Basilika in Santi Quattro Coronati Rom kann man diesen angeblichen Schenkungsakt auf einem Fresko von 1246 in der Silvesterkapelle noch heute betrachten. Die sogenannte „Konstantinische Schenkung“ ist einer der größten historischen und folgenschwersten Schwindel der Geschichte, zu verantworten durch die römisch- katholische Kirche.
Herkunft und Lehrjahre. Aller Anfang ist schwer
In dieser Zeit wird am 15. Februar 1564 Galileo Galilei in Pisa geboren. Sein Vater, Vincenzo Galilei, stammt aus einer verarmten Florentiner Patrizierfamilie, ist verheiratet mit Giulia Ammanati aus Pisa und versucht zeitweise als Tuchhändler, überwiegend aber als komponierender Musiker seine Familie mehr schlecht, als recht, zu ernähren. Der Vater hat studiert, ist auch Musiktheoretiker und an der Mathematik interessiert. Das wird auch auf den ältesten Sohn Galileo nicht ohne Einfluss bleiben. Es folgen noch sechs weitere Kinder. Nur drei überleben, ein Bruder und zwei Schwestern.
Pisa ist, wie viele Städte seiner Zeit, wehrhaft umfasst und von einer Stadtmauer umgeben. Den schiefen Turm gibt es schon, möglicherweise noch nicht ganz so schief, wie heute.
(1) Pisa in einem alten Stich
In diesem Universitätsstädtchen verbringt Galileo seine Kindheit. Er wird später zum Studium und auch als Professor nach Pisa zurückkehren.
1574 - Galileo ist zehn Jahre alt – wechselt die Familie den Wohnsitz und begibt sich nach Florenz. Der Vater findet in Florenz bessere Möglichkeiten für seine Musik am Hof des Großherzogs Cosimo. Dort gibt es häufiger Feierlichkeiten, bei denen er sich einen Namen als Musiker machen kann. Für Galileo wird Florenz die Heimatstadt, in die er immer wieder zurück kommen wird.
Florenz ist unbestritten das Zentrum der Kunst, der Paläste und Bauwerke. Da kommt Pisa, das von Florenz regiert wird, nicht mit. Hier, auf den Plätzen und in den Gassen von Florenz, wird der zehnjährige Galileo geprägt. Er wird diese herrliche Stadt für immer als seine Heimatstadt ansehen. Diese Heimatliebe wird später, wenn er im hohen Alter in die Fänge der Inquisition geraten wird, tragische Folgen für ihn haben.
(2) Florenz, die Perle der Toskana
1575 meldet der Vater Galileo in das Kloster von Santa Maria di Vallombrosa bei Valdarno an, einem malerisch gelegenen Ort auf tausend Metern Höhe, 30 Kilometer von Florenz entfernt. Hier im Benediktiner Kloster wird er Novize und erhält von den Ordensbrüdern als gelehriger Schüler Unterricht in Griechisch, Latein und Logik. Galileo kann sich vorstellen, auf Dauer dem Orden beizutreten. Das möchte der Vater aber nicht. Schon 1579 nimmt er ihn wieder aus dem Kloster, da er andere Pläne mit seinem Ältesten hat.
Galileo ist vielseitig begabt und kann sich auch ein Leben als Künstler vorstellen. Er ist musikalisch, kann malen und schließt Freundschaft mit dem jungen Maler Lodovico Cigoli, der umfangreiche Anatomiestudien mit Leichenöffnungen betreibt und sich dabei lebensgefährlich infiziert. Dem Vater gefällt auch das nicht. Er denkt mehr an einen einträglicheren Beruf und entscheidet, dass Galileo Medizin studieren soll.
1581 erfolgt die Immatrikulation als Student in seiner Geburtsstadt Pisa. Man sollte sich das Medizinstudium aber nicht annähernd vergleichbar mit den heutigen Studieninhalten vorstellen. Fachdisziplinen gibt es noch nicht. Naturphilosophie, Mathematik und Logik gehören zu den medizinischen Fächern, ebenso Astronomie - das ist eigentlich Astrologie – und das Erstellen vermeintlich präziser Horoskope. Viel mehr hat die Medizin gegen ernsthafte Krankheiten nicht aufzubieten. Die Universität Pisa hat keine internationale Bedeutung und Galileo fällt auf, dass im wesentlichen die Lehren alter Meister wiedergekäut werden. Das sind vor allem die Lehren des berühmten Philosophen Aristoteles, des Platon und der Kirchenväter Augustinus und Thomas von Aquin. Deren Weltanschauungen und Lehren gelten noch nach zum Teil fast 2.000 Jahren als ewig gültig.