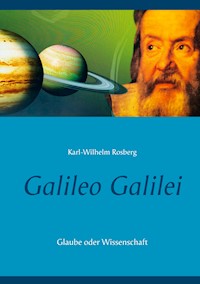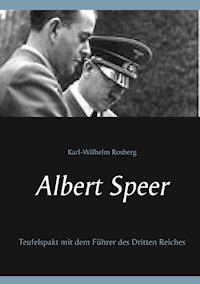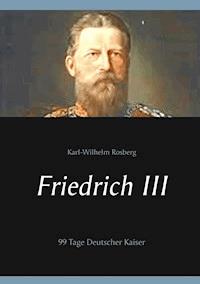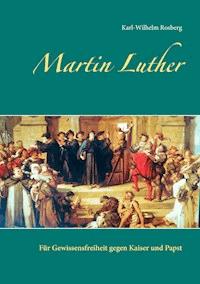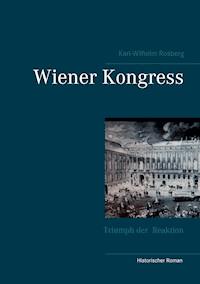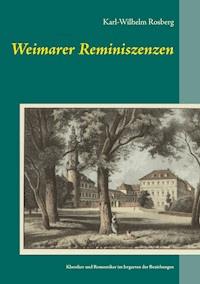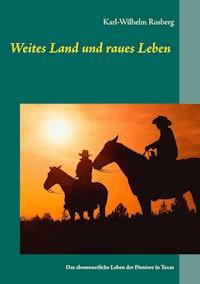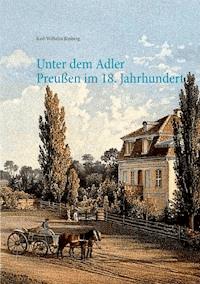
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Abenteuer Erde
- Sprache: Deutsch
Eine Adelsfamilie besitzt ein Rittergut in Ostpreußen. Es geht dem Adel gut, während das Leben der unfreien Bauern schwer ist. Dann geschieht ein Unglück. Der Sohn des Barons gerät in Verdacht, im Streit einen Bauersohn erschlagen zu haben. Schleunigst wird er in eine preußische Kadettenanstalt verbracht. Er wird Offizier in der Preußischen Armee, lernt den Kronprinzen kennen, der später Preußischer König wird und macht eine außerordentliche Karriere im Staatsdienst. Ein historischer Gesellschaftsroman, der das Leben des Adels und der Bauern im Feudalstaat Preußen beschreibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Eine
Dienstreise
Bauernunruhen
Treffen der Landstände
Das Unglück
In der Kadettenanstalt
Sommer in Kolberg
Ein strenger Winter
Die Stunde der Landräte
Leutnant bei der Garde
Hochzeit auf Bernsdorf , Urlaub auf der Nehrung
Eine Reise nach Ravensberg
Waffen braucht das Land
Der König ist tot, es lebe der König
Elend des Krieges
Trauer bei den Bernsdorfs
Abschied von der Armee
Eine Einladung nach Potsdam, Erhebung in den Grafenstand
Der Krieg geht weiter
Preußischer Landtag in Berlin
Reformen in der Mark und auf Bernsdorf
Spätes Glück
Vorwort
Der Roman führt uns in die Provinz Preußen und in das 18. Jahrhundert. Preußen war eine von vielen sehr unterschiedlichen Provinzen des Kurfürstentums Brandenburg, begründete aber wegen seiner Nichtzugehörigkeit zum Heiligen Römischen Reich die Einrichtung der Königswürde des regierenden Kurfürsten Friedrich I, der sich nach der Selbstkrönung König in Preußen und weiterhin Kurfürst von Brandenburg nannte.
Staatstragende Elemente dieser Zeit waren der nahezu flächendeckende Grundbesitz durch adelige Rittergutsbesitzer, die dem Staat unmittelbar zugeordneten Domänenverwaltungen, Kirchenbesitz und die Städte. Das Rittergut der Familie von Bernsdorf spiegelt die Lebensverhältnisse der Masse ländlicher Bewohner in Preußen wider, mit den Grundprinzipien der Bodenhörigkeit und der Leibeigenschaft unfreier Bauernfamilien.
Der Gutsherr, Baron von Bernsdorf, bestimmte über seine Bauern und ihren Aufenthalt, verwaltete das Amt für den Staat und übte die Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt auf seinem Rittergut aus. Die Bauern, nicht der Adel, zahlten an den Staat Steuern, lieferten an den Grundherrn Abgaben und waren zu Frondiensten verpflichtet. Die Lebensverhältnisse in dieser Zeit sollen möglichst authentisch und ohne jede Verklärung dargestellt werden. Die Natur ist davon ausgenommen. Sie hat die Jahrhunderte überdauert und die Menschen zu allen Zeiten tief in ihren Seelen und in ihrem Heimatgefühl geprägt.
Es ist aus heutiger Sicht schwer, sich in das Leben dieser Menschen hineinzuversetzen. Wir können die Geduld der Menschen und die Akzeptanz in die damalige Ordnung kaum mehr verstehen. Zwischen diesen Menschen und uns liegen allerdings auch lange, geschichtliche Abschnitte, die mit Aufklärung, Industrialisierung und Demokratisierung gewaltige Veränderungen brachten. Noch weniger würden wir ihre Sprache verstehen, die in diesem Roman deshalb an unser heutiges Sprachverständnis angepasst werden musste.
Der guten Ordnung halber soll erwähnt werden, dass alle Handlungen und die Personen frei erfunden sind und Ähnlichkeiten mit ehemaligen oder lebenden Personen rein zufällig und nicht beabsichtigt sind. Davon ausgenommen sind die großen Personen der Zeitgeschichte, deren Namen nicht verfälscht werden sollten und deren Erwähnung dem Leser die Möglichkeit geben soll, das romanhafte Geschehen in den geschichtlichen Zusammenhang einzuordnen. Sie sind aber nicht die Hauptpersonen dieses Romans. Die Hauptpersonen sind die gesellschaftlichen Gruppen dieser Zeit: Adelige, Beamte, Bürgerliche, Fabrikbesitzer, Domänenverwalter, Offiziere und Soldaten und die Bauern und ihre Familien.
Eine Dienstreise
Der Geheime Rat Eckard von Köslin, ist mit seinem Sekretär, dem Assessor Friedrich von Korff, jetzt schon vier Tage unterwegs. Unentwegt schaukelt die Kutsche auf den ausgefahrenen und mit Schlamm überzogenen Wegen des Königreichs Polen, übernachtet wurde in schmutzigen Herbergen, gegessen in mäßigen Schänken und morgen wird man endlich am Ziel sein. Der Kutscher auf dem Bock gibt den vier Pferden jetzt die Peitsche. Auch er freut sich schon auf das Ende der langen Reise und auf ein paar ruhige Tage auf dem Rittergut Bernsdorf in Osterode.
Von Köslin schaut aus dem Fenster und beobachtet die Bauern auf den Ländereien, die an ihm vorbeiziehen. Hin und wieder winkt eine der Arbeiterinnen den Vorbeifahrenden, bevor sie sich wieder bückt und ihrer schweren Arbeit nachgeht. Es ist wohl Kartoffelernte in Polen und die auf den Feldern abgestellten Fuhrwerke sind schon gut gefüllt. „Kartoffeln", denkt von Köslin, „auch in Polen hat man wohl verstanden, was es damit auf sich hat. Die Mengen sind gut und für die Ernährung der Bevölkerung wichtig. Der König hat das auch verstanden, nur die Bauern in Brandenburg noch nicht. Wichtig ist die Zubereitung, dann schmecken Kartoffeln gar nicht mal so übel."
Der Assessor von Korff hat sich ganz in die Fensterecke zurückgezogen und schläft schon seit dem letzten Halt den Schlaf der Gerechten. „Beneidenswert", denkt von Köslin, „kann ich leider nicht. Der junge Mann kann es noch weit bringen, hat Ehrgeiz. Ich kenne seinen Vater aus dem Fürstentum Minden. Auch der hat es weit gebracht, war zuletzt Landrat." Von Korff wird jetzt wach, nachdem die Kutsche durch ein tiefes Loch kräftig durchgeschüttelt wurde. Er setzt sich auf und schaut seinen Vorgesetzten etwas schuldbewusst an. „Ich muss wohl eingeschlafen sein", bemerkt er. „Schlafen während der Dienstzeit", brummt von Köslin, „das gefällt euch jungen Leuten wohl?" „Verzeihung", murmelt von Korff, „aber ich habe letzte Nacht ganz schlecht geschlafen. Für das Bett hätte der Wirt eigentlich Strafe zahlen müssen." „Ist ja bald vorbei, von Korff, morgen werden sie in einem angenehmeren Bett schlafen. Ich kenne den Baron und sein Haus und da werden sie sich sicher ganz wohl fühlen."
Die Kutsche liegt jetzt auf einem etwas besseren Weg ruhiger und folgt dem mächtigen Strom der Weichsel auf der östlichen Seite. Man nähert sich dem Städtchen Grudziadz, dem heutigen Ziel, das in einer Stunde erreicht werden dürfte. Der Kutscher hat sich heruntergebeugt und ruft: „Noch ein Stündchen Herr Rat, dann ist Schluss für heute." Von Köslin brummt so etwas, wie „danke", was der Kutscher aber nicht hören kann.
Von Korff ist jetzt wieder ganz unter den Lebenden und wendet sich an seinen Vorgesetzten: „Herr Rat, ich wollte einmal fragen, was es mit der Schulpflicht auf sich haben soll?" Von Köslin schaut den jungen Mann etwas belustigt an: „In welcher Schule waren sie?" Der Assessor schaut verwundert: „Das war ein Internat in Ravensberg, Herr Rat. Streng ging es da zu. Aber wir haben eine Menge dort gelernt." „Und danach?" „Danach wollte ich in die Offizierslaufbahn, Herr Rat. Hat aber nicht geklappt. Vater war dagegen. Er hat mich in den Magistrat von Minden geschickt als Volontär." „Recht so", brummt von Köslin, „wir brauchen auch fähige Staatsdiener, Korff, Offiziere stellt der Adel, Beamte auch, aber viele kommen auch von den gehobenen Beamten, wie ihr Vater. Der hat das ganz richtig gesehen, glauben sie mir. Oder wollen sie sich vielleicht auf einem Schlachtfeld totschießen lassen?" „Wenn aber der König ruft, muss man doch folgen, Herr Rat." „Quatsch, sie folgen doch ihrem König und stellen ihm ihre ganze Kraft in der Verwaltung zur Verfügung. Soldaten hat der König genug, die Kriegs- und Domänenkammern sind viel wichtiger." Es entsteht eine Pause.
Dann fährt von Köslin fort: „Das mit der Schulpflicht auf dem Lande hat der König schon erklärt. Im Sommer sind die Kinder draußen auf den Feldern und helfen ihren Eltern. Im Winter gehen sie zur Schule und lernen dort, was sie brauchen, etwas Schreiben und Lesen und den Katechismus. Die Jungs werden später Knechte oder Soldaten, die Mädchen werden Mägde oder Bedienstete im Haus des Grundherrn, vielleicht später Bäuerin. Und jetzt frage ich sie, was braucht man dazu? Die praktischen Dinge im Haus lernen die Mädchen von ihren Müttern und das Gewehr erklärt den Jungen das Militär. Nichts davon kann man in einer Schule lernen."
„Ja, Herr Rat, so ist das wohl. Die Schule richtet sich danach, was das Land braucht." „Sehn sie", brummt von Köslin, „das ist doch ganz einfach. Wozu muss man da noch komplizierte Dekrete machen. Wichtig ist immer, was das Land braucht. Und das weiß vor allem Seine Majestät, basta."
Unterdessen war der Ortsrand von Grudziadz erreicht und die Kutsche fährt jetzt langsamer. Die Pferdehufe klappern und das Echo wird von den Hauswänden vielfach zurück geworfen. Die Menschen schauen interessiert auf das mächtige Gespann und auf die elegante Kutsche, deren Glanz auch noch durch den Straßenschmutz gut zu erkennen ist. Der Kutscher wird gleich, wie jeden Tag, auch den wieder beseitigen.
Die Herberge wirkt dieses Mal etwas eleganter. Der Wirt steht vor dem Eingang und hat die Mütze in der Hand. Er begrüßt seine hohen Gäste in gebrochenem Deutsch, vermischt mit polnischen Wörtern, aber man versteht sich. Ein Essen ist vorbereitet und die Gäste werden in einen gesonderten Raum geführt, wo schon alles gedeckt ist. Das Gepäck tragen Bedienstete derweil auf die Zimmer. Es gibt Gänsebraten und vorweg eine polnische Kartoffelsuppe, dazu Rotwein und zum Nachtisch Schnaps. „Na, Korff", sagt von Köslin, „die Polen können kochen, was?" „Kann man wohl sagen, Herr Rat. Ich wundere mich über die Kartoffelsuppe, die war wirklich lecker. Die sollten unsere Brandenburger Bauern einmal probieren." „Vielleicht gibt uns der Wirt ja das Rezept, Korff. Sprechen sie ihn doch nachher einmal im Vertrauen an. Was mich angeht, so werde ich jetzt wohl ein kleines Schläfchen machen und danach einen Spaziergang durch den Ort. Sie haben freies Manöver Korff, aber lassen sie mir die polnischen Mädchen zufrieden, wir können keine diplomatischen Verwicklungen gebrauchen. Wir sehen uns beim Abendessen." Sprach es, erhebt sich und verlässt den Raum.
Von Köslin begibt sich auf sein Zimmer, das einen ordentlichen Eindruck machte. „Kann man empfehlen für künftige Dienstreisen", sagte er mehr zu sich selbst und wirft einen Blick aus dem Fenster. Sein Blick streift über die Stadt, über den Schlossberg und die wie Befestigungen wirkenden Speicher, die sich im mächtigen Strom der Weichsel spiegeln. Die Müdigkeit ist verflogen und von Köslin entschließt sich, den Spaziergang vorzuziehen. Er wirft einen Umhang um, nimmt den Stock in die Hand und steigt die Treppe hinunter, wo er dem Wirt begegnet. „Das ist Recht, Herr Rat", sagt dieser, „Grudziadz ist eine schöne Stadt. Sie wird ihnen gefallen."
Von Köslin staunt über das Panorama, eine wirklich schöne Stadt bietet sich seinem Auge, die sich an den mächtigen Weichselbogen anschmiegt. Zentral liegt der Schlossberg mit einer imposanten Kathedrale, die er zunächst ansteuert. Hin und wieder begegnen ihm Menschen, die ihn freundlich grüßen. Sie erkennen in ihm wohl den Ausländer und seine gehobene Position ist nicht zu übersehen. Immer wieder erwidert er die ihm gebotenen Grüße und ein bisschen wundert er sich schon, wie freundlich die Menschen sind. Dann steigt er den Weg hinab, durch ein Stadttor verlässt er die innere Stadt hinab zur Weichsel. Jetzt befindet sich die Festung über ihm, gleich dahinter eine Barockkirche und er staunt über das rote Mauerwerk und die eingearbeiteten Stützmauerwerke, die dem Ganzen den Eindruck einer großen Festigkeit geben, wie für die Ewigkeit gebaut. Von Köslin weiß, dass es sich um ehemaliges Ordensland handelt, das jetzt zum Königreich Polen gehört, ebenso wie andere Teile Preußens, zum Beispiel das Ermland, dass er noch besuchen wird. Er wandert ohne Eile am Ufer der Weichsel entlang und erreicht die Stadt wieder durch ein südlich gelegenes Stadttor. Dann setzt er seinen Rundgang fort und betritt nach einer guten Stunde wieder die Herberge, wo er vom Wirt erneut freundlich gegrüßt wird. Jetzt wird er wohl sein Schläfchen nachholen, es ist ja noch reichlich Zeit bis zum Abendessen. Lange wird er heute auch nicht aufbleiben, denn morgen früh werden sie zeitig starten, um am nächsten Tag sicher nach Osterode zu gelangen.
***
Das Rittergut Bernsdorf ist mit fünfhundert Morgen eigenbewirtschaftetes Land, fünftausend Hektar Wald und fünfundachtzig eigenbehörigen Bauernhöfen das größte Rittergut im Osteroder Land. Es zu durchqueren, bedeutet fast eine Tagesreise. Es ist in seinem Aussehen und in seiner Struktur ein typisches Stück Ostpreußens: leichtgewelltes Ackerland, fast unübersehbar tiefe Wälder, kleine und größere Seen, die zum Teil zusammenhängen und darin eingebettet, die zugehörigen Bauerhöfe, die nicht immer einsam liegen, sondern auch mit mehreren Höfen zu Bauernschaften zusammengeschlossen sind. Quer durch das Gebiet des Bernsdorfschen Rittergutes schlängelt sich der kleine Fluss Drewenz, der in den großen Drewenzsee mündet. Nach Norden hin wird das Gebiet vom Pauzensee begrenzt.
Vom Drewenzsee aus Osterode kommend führt eine lange Allee aus Eichen direkt zum Gutshaus, das von Baumgruppen umgeben stolz zum See hin seine eindrucksvolle Fassade zeigt. Rechts und links befinden sich weitere Gebäude, eines davon ist der runde aus roten Backsteinen gemauerte Wasserturm, auf dessen Spitze heute die preußische Flagge weht. Ein großzügiger kreisrunder Vorplatz lässt dem Anreisenden genügend Zeit, die Größe des Bauwerks zu bewundern. Die Mitte des Platzes wird von einem ebenfalls kreisrunden Teich beherrscht, der mit allerlei Grün und Blumenstauden umfasst ist. Selten zeigt sich ein Besucher beim ersten Anblick unbeeindruckt.
Friedrich Baron von Bernsdorf ist mit seinem Gutsverwalter Heinrich von Waldersee vor das Gebäude getreten und beide erwarten die schon gemeldete Ankunft der preußischen Staatskarosse mit den beiden bedeutenden Regierungsbeamten aus Berlin, die in Kürze in die Baumallee einfahren wird. Es ist ein schöner Sommertag und Baron von Bernsdorf nutzt die kurze Wartezeit, um mit seinem Verwalter noch rasch ein paar Dinge zu besprechen. „Herr von Waldersee, sie nehmen bitte heute Abend am Abendessen teil, das wir für die Gäste aus Berlin geben werden. Die geladenen Gäste haben alle zugesagt, der übliche Bekanntenkreis, sie wissen schon." „Gerne, Herr Baron, solche Gäste hat man nicht jeden Tag. Ich bin gespannt, was die Herren aus Berlin über die allgemeine Lage zu berichten haben. Man munkelt allerorts, dass es Krieg geben könnte. Die Schweden stellen immer neue Ansprüche und da liegt es nahe, denen einmal die Rechnung aufzumachen." „Aber ob Preußen da mitmachen sollte Waldersee, ich weiß nicht. Was hätte Preußen dabei zu gewinnen?" „Vielleicht Usedom, Gebiete am Haff und in Pommern? Die Teilung von Brandenburg und Preußen ist doch kein Zustand, Herr Baron."
Beide drehen sich nun um und sehen die Kutsche rasch durch die Allee kommen. Der Vorplatz wird umfahren, dann kommt das Gefährt unmittelbar vor dem Portal zum Stehen. Der Kutscher springt vom Bock und öffnet die Wagentür. Etwas umständlich klettert Eckardt von Köslin aus der Kutsche, beugt einmal kräftig den Rücken zurück und steht dann kerzengerade vor dem Baron, der von ihm sofort herzlich begrüßt wird. „Herzlich willkommen auf Bernsdorf, Herr von Köslin, " sagt der Baron, „ich freue mich, dass sie heil angekommen sind, ich hoffe bei guter Gesundheit." „Danke, Herr Baron", antwortet von Köslin, „das ist schon eine verdammt lange Reise. Man kann seine Knochen zählen auf den holprigen Wegen, aber nun ist es ja überstanden. Ich möchte ihnen Grüße ausrichten vom Minister Karl- Friedrich von Falkenstein, der mir einiges für diesen Besuch aufgetragen hat." Inzwischen war auch sein Begleiter, Assessor Friedrich von Korff, aus der Kutsche geklettert. Auch ihm schüttelt der Baron freundlich die Hand und stellt dabei ganz nebenbei beiden Herren seinen Verwalter vor.
„Schön", sagt Baron von Bernsdorf, „das besprechen wir später, jetzt kommen sie erst einmal herein und stärken sich etwas, bitte hier entlang." Der Baron weist höflich mit einer Armbewegung den Weg zum Eingang und bemerkt: „Aber bitte vorsichtig auf den Stufen, Herr von Köslin, die sind etwas ausgetreten." „Lassen sie die doch wenden, Herr Baron", meint von Köslin. Der Baron schmunzelt. „Geht nicht mehr", meint der Baron, „das hat mein Großvater schon einmal getan. Die müssen wohl als nächstes erneuert werden. Aber wir sind sparsam hier in Ostpreußen und da müssen die Dinge lange halten." Man betritt das Gutsgebäude durch die geräumige Vorhalle und es geht direkt in die Bibliothek, die heute als Empfangsraum dient. Der große Saal wird schon für den Abendempfang vorbereitet und steht daher nicht zur Verfügung.
In der Bibliothek warten schon Amalie Baronin von Bernsdorf, der sechzehnjährige Sohn Friedrich Wilhelm von Bernsdorf und die vierzehnjährige Tochter Marie von Bernsdorf. Die Baronin ist eine stattliche Frau, fast eine Schönheit und von Köslin tritt sofort auf sie zu, nachdem der Baron ihn seiner Frau vorgestellt hat. Er beugt sich zum Handkuss und schaut die Baronin lächelnd an: „Sie sollten unbedingt nach Berlin kommen, gnädige Frau", sagt er freundlich, „sie wären eine Attraktion bei Hofe." „Sehr freundlich", bemerkt die Baronin lächelnd, „sind alle so galant in Berlin, Herr von Köslin?" „Ich hoffe, gnädige Frau, aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich fürchte, es gibt auch ungeschliffene Zeitgenossen in Berlin." „Die gibt es überall", meint die Baronin, „hatten sie eine gute Reise?" „Den Umständen entsprechend, gnädige Frau. Da geht schon eine gute Woche drauf, bei einer solchen Reise, aber kleiner ist Brandenburg-Preußen ja nun mal nicht. Außerdem geht es ja ein gutes Stück auch durch Polen und da sind die Wege etwas holprig."
Baron von Bernsdorf ist in die Mitte des Raumes getreten und nachdem alle sich mit den angebotenen Getränken bedient haben, begrüßt er noch einmal die Gäste ganz offiziell. „Herr Geheimer Rat, Herr Assessor", beginnt er „es ist für uns eine große Ehre, Regierungsbeamte hier zu haben, gibt es uns doch das Gefühl, dass wir hier nicht am Ende der Welt leben, sondern unsere Regierung auch ein Auge auf uns hat." Er hebt das Glas, prostet den Anwesenden zu und fährt fort: „Die Provinz Preußen ist eine ganz andere Welt als das Kurfürstentum Brandenburg, Herr von Köslin, das werden sie schon bald spüren. Hier gehen die Uhren etwas anders als in Berlin. Wir leben hier in enger Beziehung zur Natur, lieben die Distanz zu einander und damit unsere Ruhe und unsere Freiheit, ohne unsere Nachbarn zu vergessen. Wir wissen, dass sie da sind und dass sie sofort kommen, wenn wir einander brauchen. Alles ist größer und ausgedehnter hier, die Wälder, die Höfe und Anwesen, alles eben. Das macht uns auch ein wenig stolz und selbstbewusst und natürlich begründen wir durch unsere vom Reich unabhängige Lage das Königreich Preußen. Wir könnten uns gut vorstellen, dass seine Majestät nicht in Berlin, sondern in Königsberg residieren sollte, aber das ist hohe Politik und ganz sicher nicht ihr Anliegen. Fürs Erste möchte ich mich kurz fassen, wir haben ja noch viel Zeit für Gespräche. Sie werden gleich ihre Zimmer zugewiesen bekommen, wo sie sich nach der langen Reise sicher gerne etwas ausruhen wollen, sozusagen während der Dienstzeit, Herr Assessor", sagt der Baron schmunzelnd, „am Abend haben wir zu einem Empfang geladen, wo sie all die Damen und Herren schon einmal kennen lernen, die ihnen in den nächsten Tagen begegnen werden. Ich stelle sie ihnen dann heute Abend vor. Noch einmal, herzlich Willkommen und einen guten Aufenthalt."
***
Es wird Abend auf dem Gutshof. Die Sonne versinkt gerade über dem See und die Diener haben entlang der Allee Fackeln gesteckt, die das Gut malerisch und stimmungsvoll beleuchten. Eine Kutsche nach der anderen fährt vor. Am Portal, wo die Kutschen halten, steht ein Diener, der die Wagenschläge öffnet und die heraussteigenden Gäste mit einer Verneigung, aber schweigend begrüßt, die sich dann über die Treppe in das Haus begeben und dort von der Baronin und vom Baron freundlich empfangen werden. Man kennt sich seit vielen Jahren.
Pastor Sigismund Lüder ist der erste. „Guten Abend gnädige Frau, guten Abend Herr Baron", sagt Pastor Lüder, „vielen Dank für die Einladung. Es gefällt unserem Herrn immer, wenn Menschen sich fröhlich begegnen." „Ich werde ihm die Rechnung schicken", bemerkt Baron von Bernsdorf lachend. „Herr Baron", sagt Pastor Lüder, „damit spaßt man aber nicht. Unser Herr versorgt uns jeden Tag mit allem, was wir brauchen." „Schon in Ordnung", schmunzelt der Baron, „war nur ein kleiner Scherz, Herr Pastor." Pastor Lüder ist zugleich Superintendent der Kirchspiele Osterode und Bergfriede und ist mit seinen grauen Haaren und seiner geraden Haltung eine Augenweide und eine bedeutende Persönlichkeit. Er schreitet in den Saal, wählt ein Glas Rotwein aus und schaut sich interessiert um. Die anderen Gäste werden wohl gleich erscheinen.
Walter von Hirschberg, der Domänenverwalter der Osteroder Forstverwaltung fährt mit seiner Frau Amalie als nächster vor. Von Hirschberg trägt würdevoll seine Forstuniform, die Jacke spannt etwas wegen der Leibesfülle. Das Aussteigen fällt ihm schon etwas schwer und der Diener schaut respektvoll solange zur Seite. Die von Hirschbergs betreten die Vorhalle. „Schön, dass sie es einrichten konnten", sagt der Baron, drückt beiden die Hand und nimmt von Hirschberg etwas zur Seite, währen die Damen sich gesondert unterhalten. „Klappt das mit der Jagd?" fragt der Baron. „Klappt, Herr Baron. Alles ist schon vorbereitet. Wir können auf Hirsche ansitzen, das ist für die Herren aus Berlin sicher ein besonderes Erlebnis." „Großartig", sagt der Baron, „und hinterher gibt es Hirschbraten. Dann kann ich das ja gleich ankündigen. Für sie habe ich heute einen hervorragenden Kräuterschnaps bereitstellen lassen, den können sie ganz unauffällig nebenbei ordern, ist schon alles abgesprochen, der Diener weiß Bescheid". „Wunderbar", brummt von Hirschberg, „der Abend ist gerettet."
Adalbert Recke, der Schulmeister, ist zu Fuß gekommen. Er hat es nicht weit. Das Schulhaus befindet sich neben der Allee auf halber Höhe zum Gutshof. Recke ist überzeugter Junggeselle, wie er immer betont. Er kann nicht wegen einer Frau, alle anderen auslassen, meint er gelegentlich schmunzelnd. Man belächelt diese Koketterie, denn Adalbert Recke ist alles andere als ein Schürzenjäger. Er grüßt den Diener am Eingang freundlich im Vorbeigehen. Der kennt ihn noch als seinen Lehrer und der Diener grüßt ihn devot. Recke betritt die Vorhalle und verbeugt sich artig vor der Baronin und vor dem Baron. „Schön wie immer", flüstert er der Baronin zu, die sofort antwortet: „Ich muss wohl auf der Hut sein, Herr Recke. Sie sind außer dem Superintendenten und unserem Gast, dem Assessor aus Berlin, schon der dritte Junggeselle heute." „Sie stehen unter meinem Schutz, gnädige Frau", sagt Recke und schaut den Baron schelmisch an, der es vorzieht, zu all dem lächelnd zu schweigen. Adalbert Recke verbeugt sich noch einmal und begibt sich dann in den Saal.
Als nächster fährt der benachbarte Gutsbesitzer Otto Freiherr von Schomburg mit seiner Frau Hildegard vor. Die Kutsche wird von vier Pferden gezogen, das macht schon Eindruck. Der Besitz der Schomburgs grenzt im Norden an den der Bernsdorfs an. Die Schomburgs führen ebenfalls ein gastfreundliches Haus. Freiherr von Schomburg ist eine stark gebaute, stattliche Erscheinung und mit einer ebenso sonoren Stimme ausgestattet. Man hört ihn sicher auch im Saal, als er die Vorhalle betritt und seine Nachbarn dröhnend begrüßt: „Endlich einmal wieder ein kostenloses Abendessen und hoffentlich viel zu trinken, lieber Fritz." Und Schomburg lacht laut los, gibt der Baronin artig einen Handkuss und schlägt dem Baron dann kräftig auf die Schulter. „Es geht doch nichts über eine gute Nachbarschaft", fährt er fort, „man würde ja vor Langeweile sterben, wenn wir nicht hin und wieder einen Anlass zum Feiern hätten. Ich nehme an, die Herren aus Berlin sind schon da und sicher ganz gespannt, ob hier in Preußen auch einigermaßen anständige Menschen wohnen oder nur Hinterwäldler, Ha, Ha, Ha." „Die Herren aus Berlin sind schon da, Otto", sagt Baron von Bernsdorf, „aber du darfst sie nicht gleich erschrecken. Sie sind einen vornehmen Ton bei Hofe gewöhnt und können sich gar nicht vorstellen, dass wir hier wegen der großen Entfernungen etwas lauter sprechen müssen." „Großartig", lacht von Schomburg, „sehr gut erklärt. Du, Fritz, ich müsste mal ganz kurz etwas mit dir besprechen, geht das wohl?" „Klar", sagt der Baron, „unsere Frauen sind ja auch noch nicht fertig mit ihren Neuigkeiten."
Beide gehen etwas in den hinteren Teil der Vorhalle und Bernsdorf fragt: „Wo brennt es denn, Otto?" „Brennen ist treffend ausgedrückt", sagt von Schomburg und wird plötzlich ganz ernst, „Fritz, was ist mit unseren Bauern los. Die sind ja ganz außer Rand und Band. Irgendjemand muss ihnen Flöhe in den Kopf gesetzt haben und ich weiß auch schon wer. Moritz, der Sohn von deinem Bauern Franz Rohr scheint mir dahinter zu stecken. Der treibt sich in letzter Zeit auffallend oft auf meinem Gebiet herum und macht mir meine Bauern wild." „Was sagt er?" fragt der Baron. „Der redet von Ungerechtigkeit und Ausbeutung und fordert allen Ernstes die Abschaffung der Bodenhörigkeit und Leibeigenschaft. Wenn es nach dem ginge, würden die Bauern auch keine Spanndienste mehr leisten und keine Kontributionen mehr zahlen. Das ist das Chaos. Wo soll das hinführen, Fritz?" Der Baron streicht über sein Kinn und sagt: „Ich habe das auch schon gehört, Otto. Bei uns ist es allerdings noch ziemlich ruhig. Kann sein, dass sie sich dein Gebiet ausgesucht haben, um Unruhe zu stiften. Also, ich glaube nicht, dass diese Hetze zum Erfolg führt. Das Recht ist ganz klar auf unserer Seite und einen Staatsstreich werden sie bestimmt nicht wagen. Aber es gibt einige Wirrköpfe aus Berlin, die schon eine Partei gegründet haben und den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen. Ich glaube, wir sollten in den nächsten Tagen mit von Köslin darüber sprechen. Vielleicht weiß der mehr über die politischen Zustände in Berlin."
Als letzter der geladenen Gäste erscheinen Heinrich Griese und Frau Theodora, Fabrikbesitzer der Eisen- und Gerätemanufaktur in Osterode. Er hat sich durch Fleiß und Cleverness eine Fabrik aufgebaut und seine Frau war Kammerzofe bei einer Gräfin in Brandenburg ist von niederem Adel. Beide sind äußerst standesbewusst und versuchen, ihre gesellschaftliche Bedeutung in der Provinz wo immer es möglich ist zu verbessern und zu festigen. Dabei hilft ihnen natürlich ihr Geld, das sie als Unternehmer verdienen und das ihnen einen entsprechenden Auftritt ermöglicht, so auch jetzt. Die Kutsche ist ganz auffallend, trägt ein Wappen an beiden Türen und ist ein Vierspänner mit zwei Kutschern auf dem Bock. Messinglaternen beleuchten die Kutsche an beiden Seiten und innen ist sie ganz elegant ausstaffiert mit Seide und Leder und prachtvollem Teppichboden. Sie genießen ihren Auftritt und erscheinen regelmäßig als Letzte bei solchen Veranstaltungen. Die Diener sind beeindruckt. Heinrich Griese schlägt im Körperumfang den Freiherrn bei weitem. Seine Gattin hingegen ist extrem schlank und gut zwanzig Jahre jünger als ihr Mann. Er trägt einen Frack und sie ein auffallend schönes und aufwendig verziertes Kostüm, dazu einen Hut, der gerade noch in die Kutsche hineinpasst. So ersteigen sie die Treppe und betreten die Vorhalle. „Ich hoffe, wir sind noch nicht zu spät", sagt Heinrich Griese, küsst der Baronin umständlich die Hand und begrüßt dann den Baron. „Alles in Ordnung, Griese", schmunzelt der Baron. „Es sind ja immer die Geschäfte, die einen in Anspruch nehmen. Wir verstehen das schon. Bitte kommen sie herein, dann können wir beginnen." Zusammen mit ihnen betreten der Baron und die Baronin jetzt den Saal, wo man sich schon angeregt unterhält.
Man nimmt Platz und der Geräuschpegel sinkt. Baron von Bernsdorf hat sich erhoben und lässt seinen Blick freundlich um den Tisch kreisen. Dann beginnt er seine Ansprache: „Herr Geheimer Rat von Köslin, Herr Assessor von Korff, meine lieben Freunde. Meine Frau und ich haben sie heute zu diesem Abendempfang geladen, da wir hohen Besuch aus Berlin haben. Ich möchte sie, Herr von Köslin und ihren jungen Begleiter, ganz herzlich in unserem Kreise begrüßen. Wir freuen uns, dass die Regierung Notiz von uns nimmt und mit uns über wichtige Entscheidungen sprechen möchte." Beifälliges Gemurmel, Klopfen auf dem Tisch. Der Baron fährt fort. „Gemach, meine Freunde, das dicke Ende kommt vielleicht noch. Wenn die Regierung etwas von uns will, kostet das meistens etwas." Verdecktes Lachen und Gemurmel. „Nun ja, wir werden sehen. Herr von Köslin wird gleich Gelegenheit haben, seine Anliegen vorzutragen. Ich kann mich daher noch mit meiner Meinung etwas zurück halten. Nur so viel schon jetzt, die Zeiten sind nicht rosig. Die Ernten waren in diesem Jahr mäßig und ein vermutlich schwerer Winter steht uns bevor. Das muss man berücksichtigen und, Herr von Köslin, unsere Bauern sind unzufrieden. Wir werden ihnen das noch im Einzelnen darlegen und sie bitten, das mit nach Berlin zu nehmen. Ich weiß nicht, wie man die Probleme lösen kann, für die Kontributionszahlungen der Bauern an die Regierung sind wir ja nicht zuständig. Vielleicht sollten sie in den nächsten Tagen auch mit denen einmal sprechen. Es ist immer gut wenn man Dampf ablassen kann, das entspannt. Ich fasse mich daher kurz, möchte sie noch einmal begrüßen und ihnen erfolgreiche Gespräche wünschen. Bevor das Essen aufgetragen wird, möchte ich sie daher bitten, einige Worte an uns zu richten. Danach wollen wir den Abend entspannt genießen und möglichst keine Reden mehr halten." Beifall und Klopfen auf den Tisch.
Eckardt von Köslin hat sich erhoben und schaut freundlich in die Runde. „Sehr verehrte gnädige Frau, Herr Baron von Bernsdorf, Herr Freiherr von Schomburg, verehrte Damen, meine Herren. Wir möchten zunächst einmal ganz herzlich Dank sagen für die freundliche Aufnahme hier und wir genießen schon jede Stunde, die wir in dieser wunderbaren Umgebung erleben dürfen. Wenn man sich der Provinz Preußen nähert, wird man sofort von der einzigartigen Natur gefangen, von der Landschaft, den Seen, den Wäldern und von den Menschen, die hier so ganz anders sind als in der Großstadt Berlin. Herr Baron, sie haben natürlich Recht, dass wir auch mit einigen Anliegen an sie herantreten wollen und sind daher dankbar, dass wir gleich am Anfang alle wichtigen Vertreter dieser beiden Gutsbezirke zusammen haben und sie gleich kennen lernen können. Ja, ich möchte sagen, dass an diesem Tisch das Fundament versammelt ist, auf das sich seine Majestät, der König in Preußen und Kurfürst von Brandenburg, abstützen muss und kann. Sie repräsentieren allein die Staatsgewalt und sind die Werkzeuge seiner Majestät, Friedrich Wilhelm, der sich unermüdlich, ich möchte sagen, bis zur Aufopferung, um das Wohl Preußens sorgt." Beifall und Klopfen. „Damit komme ich zu einem Thema, das seiner Majestät besonders am Herzen liegt und auf das ich sie unbedingt ansprechen soll. Im ganzen Lande, besonders aber in Berlin, wütet die Pest. Wir verlieren täglich Menschen, die von der furchtbaren Epidemie dahin gerafft werden, und die Krankheit schafft Kummer und Sorgen und was am schlimmsten ist, sie schafft Witwen und Waisen in unvorstellbar großer Zahl. Seine Majestät hat daher entschieden, am Rande Berlins ein Hospital einzurichten, um der Krankheit besser begegnen zu können. Wir müssen die Menschen isolieren und besser medizinisch betreuen und, meine Herren bedenken sie bitte, jeder verstorbene Mann ist ein fehlender Soldat. Wie lange kann Preußen das noch ertragen? Kurzum, seine Majestät erwartet daher von jedem aufrechten Preußen, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten hilft und unterstützt. Ich möchte sie daher im Namen seiner Majestät um Unterstützung bitten und das bedeutet Geld, Nahrungsmittel und Pflegepersonal. Wir können das mit jedem Einzelnen von Ihnen noch besprechen, wie viel sie leisten können. Das brauchen wir hier nicht zu vertiefen. Ich wollte nur ihr Verständnis dafür wecken und möchte daher auch keine weiteren Worte finden. Die anderen Themen, Schulwesen und Holzdiebstähle können wir in den nächsten Tagen besprechen. Ich möchte den Gastgebern noch einmal herzlich danken und dem Abend einen vergnüglichen Verlauf wünschen."
Jetzt wird das Essen aufgetragen und die Stimmung steigt. Freiherr von Schomburg neigt sich zu seiner Frau Hildegard. „Hast du gehört, Geld will er. Habe ich mir schon gedacht, dass dies ein teures Essen wird. Na ja, warten wir es ab. Sagen kann man viel und Berlin ist weit. Zum Wohl meine Liebe, der Wein ist immerhin in Ordnung." „Otto", sagt seine Frau, „beim Personal können wir helfen. Da können einige noch das Arbeiten lernen." „Am besten schicken wir gleich den Moritz Rohr nach Berlin, da kann er sich sozial austoben und wir haben hier unsere Ruhe vor dem. Aber das muss der Fritz regeln".
Obwohl es gar nicht so vorgesehen war, nimmt jetzt doch der Eine oder Andere die Gelegenheit wahr, ein kurzes Grußwort an die Runde zu sprechen. Pastor Sigismund Lüder klopft an sein Glas und macht den Anfang. „Entschuldigen sie bitte, Herr Baron, wenn ich doch etwas sage, aber so eine Gelegenheit kommt ja nicht alle Tage." Der Baron nickt schmunzelnd und Pastor Lüder fährt fort. „Seine Majestät von Gottes Gnaden ist ein fürsorglicher Landesherr, wie wir alle wissen. Man sagt, dass er bereits dabei ist, Schlösser zu verkaufen, um das nötige Geld für die Staatsaufgaben aufzubringen. Das wird unserem Herrn ganz sicher gefallen. Herr von Köslin, unsere Kirchengemeinde ist arm, sehr arm. Was wir aber tun können und wollen ist, dass wir für die armen Kranken beten werden, solange es nötig ist. Bitte nehmen sie das als unseren Beitrag mit nach Berlin." Leises Gelächter. „Wie viel Taler sind das, Herr Pastor, " ruft von Köslin jetzt mehr im Scherz dem Pastor über die Tafel zu. „Aber Herr von Köslin", antwortet der Pastor, „damit macht man aber keine Scherze."
Heinrich Griese hat sich erhoben und es wird ruhig im Raum. „Liebe gnädige Frau, Herr Baron, Herr Rat, meine Freunde", sagt er, „wir haben ihre Botschaft natürlich verstanden und als der größte Fabrikbesitzer in dieser Gegend hier, kann ich natürlich den Ruf seiner Majestät nicht überhören." Von Köslin nickt, Freiherr von Schomburg hebt die Augenbrauen und der Baron schaut freundlich auf seinen Gast. „Ich möchte mich jetzt hier und heute Abend noch nicht auf Einzelheiten festlegen, aber ich habe natürlich einige Vorschläge zu machen, das ist doch selbstverständlich. Wie sie wissen, stellen wir Eisenwaren und Geräte her. Bei den Eisenwaren handelt es sich vor allem um landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge, die wir allerdings in abgewandelter Form auch an die Armee liefern. Was nun den Krankenhausbedarf angeht, so könnte ich mir vorstellen, dass wir auch medizinische Geräte und Einrichtungsgegenstände für das Krankenhaus herstellen können und dazu ein Zweigwerk in Berlin eröffnen. Wir können dann natürlich besonders günstige Preise machen, wenn wir einen Exklusivvertrag mit dem Hof bekommen und wenn wir schon eine weitere Verwaltung in Berlin einrichten, könnten wir die Krankenhausverwaltung gleich mitmachen und uns insbesondere um die Geldangelegenheiten des Hospitals kümmern. Dazu würde ich dann eine Bank gründen und der Regierung auf diese Weise viel Verwaltungskram abnehmen." Von Köslin ist jetzt sprachlos, der Baron lächelt verschmitzt und Freiherr von Schomburg sagt zu seiner Frau: „So ein Gauner, der macht mit Wohltaten noch Geschäfte. Da können wir noch etwas lernen, meine Liebe". „Solltest du nicht auch etwas sagen?" fragt seine Frau Hildegard. „Den Teufel werde ich tun. Das kann die teuerste Rede meines Lebens werden. Fritz hält sich auch bedeckt und seinem Gastgeber soll man nicht vorgreifen."
Dann wird es ruhiger an der Tafel und man speist und trinkt ausgiebig. Die Diener schaffen immer neue Speisen herein, reichen zu, decken ab, schenken ein und sind sehr beschäftigt. Es gibt alles, was das Land zu bieten hat und die Küche der Bernsdorfs wird geschätzt. Dann nimmt noch einmal Walter von Hirschberg das Wort: „Liebe, gnädige Frau, Herr Baron, Herr Freiherr, meine Freunde. Ich möchte die gute Stimmung nur kurz unterbrechen und ihnen, Herr von Köslin, ein Angebot machen. Wenn sie schon in Ostpreußen sind, dann müssen sie unbedingt unsere Wälder kennen lernen. Wir haben für sie eine Jagd vorbereitet, Damwild vor allem, prächtige Tiere. Sie werden sehen. Und, Herr von Köslin, wenn jemand bei der Jagd angeschossen wird, bringen wir den in das Hospital nach Berlin, denn normale Patienten brauchen die ja auch, Ha, Ha, Ha. War nur ein Scherz. Ich trinke auf das Wohl der Gastgeber und insbesondere auf unsere charmante Gastgeberin. So etwas Schönes werden sie in Berlin nicht finden. Prost gnädige Frau. Aber unsere Hirsche sind auch schön, sie werden sehen." Von Hirschberg nimmt wieder Platz und langt noch einmal kräftig zu.
Erst kurz vor Mitternacht löst sich die Tafel langsam auf und eine Kutsche nach der anderen setzt sich in Bewegung. Freiherr von Schomburg und seine Frau Hildegard bleiben über Nacht und nachdem allgemeine Ruhe eingekehrt ist, ziehen sich der Baron und der Freiherr noch an den Kamin in der Bibliothek zurück und lassen den Abend noch mit einer Zigarre und dem einen oder anderen Glas Cognac ausklingen.
***
Der Geheime Rat Eckardt von Köslin und Assessor von Korff stehen vor dem Schulhaus, das etwa in der Mitte der Chaussee etwas abseits von Bäumen umgeben liegt. Es war nur ein kurzer Fußweg für die beiden. Sie wollen sich mit dem Schulmeister Adalbert Recke unterhalten. Recke hat die beiden wohl schon kommen sehen und ist vor die Eingangstür getreten. „Willkommen in meiner bescheidenen Hütte, Herr Rat", ruft er. „Sehr idyllisch gelegen Herr Recke", meint von Köslin, „gerade die richtige Ruhe, um zu lernen." „Ja", sagt der Schulmeister, „ruhig ist es hier, manchmal schon zu ruhig. Aber kommen sie doch herein und schauen sie sich um."
Das Schulgebäude ist klein und hat zwei Ebenen. Unten befindet sich ein Klassenraum, eingerichtet mit doppelsitzigen Holzbänken, einem Pult, einem Schrank und einem gusseisernen Ofen mit langem Ofenrohr. Der Schulmeister wohnt oben unter dem Dach in einer kleinen Wohnung. „Wo sind die Kinder?" möchte von Köslin wissen. „Die Kinder kommen in zwei Wochen wieder. Wir sind eine Winterschule. Nach der Ernte beginnt wieder die Schule und geht dann bis Ende April, drei Stunden jeden Tag, außer Sonntag." „Und was machen sie in der schulfreien Zeit im Sommer?" möchte der Rat wissen. „Dann unterrichte ich die Kinder des Barons, des Domänenverwalters und die Kinder von dem Fabrikbesitzer Griese. Dazu gehe ich aber zu ihnen, dann braucht das Schulgebäude nicht geheizt zu werden. Alles tüchtige Kinder, die gut lernen." „Was unterrichten sie bei denen?" fragt von Köslin. „Na ja, was die Eltern vorgeben: Deutsch, Mathematik, Naturkunde, Literatur, Kunst, Musik und Französisch. Das brauchen die Kinder später, wenn sie ins Studium gehen."
Jetzt schaltet sich der Assessor von Korff ein. „Und was lernen die anderen Kinder während der Winterschulzeit?" „Was sie brauchen", sagt Recke, „Lesen, etwas schreiben und rechnen. Der Pastor unterrichtet den Katechismus. Den Rest lernen die Kinder zu Hause auf den Höfen." „Reicht das denn?" möchte von Korff wissen. „Ich denke schon, Herr Assessor",, antwortet Recke, „schauen sie mal, was brauchen die Kinder später im Leben wirklich? Sie werden auf den Bauerhöfen bleiben oder sie gehen in die Fabrik oder in die Armee." „Aber die Kinder werden in ihre Umgebung hinein geboren und können da dann auch nicht mehr heraus", meint der Assessor. „Wollen sie die Welt verändern?" schaltet sich jetzt von Köslin ein, „Korff ich verstehe sie nicht. Wir sprechen doch hier über eine Ordnung, die über Jahrhunderte Bestand hat und sich bewährt hat. Es können doch nicht alle Gutsbesitzer, höhere Beamte oder Offiziere werden. Wie stellen sie sich das denn vor?" Der Assessor nickt stumm und zieht es offensichtlich vor, zu schweigen.
„Und wie ist der Schulbesuch?" möchte von Köslin jetzt noch wissen. „Die Kinder kommen unregelmäßig, Herr Rat, manche auch durchaus regelmäßig. Wir überlassen das den Eltern, die haben schließlich darüber zu entscheiden." „Was ist mit dem Schulgeld?" „Das ist wenig, nur einen Taler im Monat, Herr Rat." „Und können das die Leute bezahlen?" „Nicht immer, manche schicken auch etwas für die Küche und dann ist das auch in Ordnung. Die Leute sind arm und da muss man Verständnis haben."
„Vielen Dank, Herr Recke", sagte jetzt von Köslin, „das reicht mir." Man verabschiedet sich und von Köslin und der Assessor machen sich auf den Weg zurück zum Gutshaus. Sie lassen sich Zeit für den Rückweg und hängen ihren Gedanken nach. „Na", sagte von Köslin, „was denken sie, Korff?" „Ich weiße nicht, Herr Rat, ob das auf Dauer gut gehen wird mit den bestehenden Zuständen. Wer keine vernünftige Schulbildung hat, wird versuchen, in die Stadt zu gehen, in die Fabriken oder ins Ausland." „Das kann er nicht", antwortet von Köslin, „dazu braucht er die Zustimmung des Gutsherrn." „Ich weiß", sagt der Assessor, „aber wenn die Menschen nicht mehr weiter wissen, verschwinden sie einfach und nehmen in Kauf, dass sie irgendwann zur Verantwortung gezogen werden. Sie desertieren ja auch bei den Zuständen in der Armee." „Sind sie Sozialist?" will von Köslin jetzt wissen. „Keineswegs, Herr Rat, ich sorge mich nur um die Zukunft. Wenn Menschen nichts mehr zu verlieren haben, mucken sie auf." „Das wäre aber Revolution, Herr Korff." „Ganz richtig, Herr Rat, das wäre Revolution."
***
Herr von Köslin und Assessor von Korff sitzen in der Kutsche und befinden sich auf dem Weg zur Eisen- und Gerätemanufaktur, wo sie den Fabrikbesitzer Heinrich Griese treffen wollen. „Gefällt ihnen die Baronesse, Herr von Korff?" Der Assessor ist von der Frage sichtlich überrascht und zeigt sich etwas verwirrt. „Die Baronesse ist ein bemerkenswertes Mädchen, Herr Rat", sagt von Korff. „Na, man könnte schon fast von einer Frau sprechen. Sie ist schon eine wirklich eindrucksvolle Persönlichkeit." „Ja, Herr Rat, das kann man sagen." Beide verfallen wieder in Schweigen und lassen die vorbeiziehende Landschaft auf sich einwirken.
Die Fabrik liegt etwa drei Kilometer östlich von Osterode und ist über eine feste und befahrene Straße von Osterode aus zu erreichen. Am Fabriktor wartet ein Pförtner, der die ankommenden Herren freundlich begrüßt. „Willkommen, Herr Rat", sagt er durch das geöffnete Fenster der Kutsche, „der Herr Direktor erwartet sie schon." Dem Kutscher zeigt er den Weg zum Verwaltungsgebäude. Dort angekommen, klettern von Köslin und von Korff aus der Kutsche und sehen sich interessiert auf dem Fabrikgelände um. Es besteht aus mehreren Fabrikgebäuden, aus einer Lagerhalle mit einer Rampe, von der aus gerade ein Wagen beladen wird. Das Verwaltungsgebäude macht einen guten Eindruck, alles ist sehr ordentlich. Im Eingang erscheint der Direktor Heinrich Griese.
„Willkommen, meine Herren. Es ist mir eine Ehre, sie bei uns zu haben. Ich darf wohl vorangehen. Auf dem Korridor bleibt Griese stehen und zeigt auf ein Bild an der Wand. „Das ist mein seliger Vater, Herr Rat", sagt Griese, „er hat das hier alles aufgebaut und ist leider vor drei Jahren gestorben. Bitte hier hinein." Man durchquert ein Vorzimmer, in dem zwei Frauen und ein jüngerer Mann an Schreibtischen sitzen und die Gäste freundlich grüßen. Dann begibt man sich in das Büro von Herrn Griese, das gut und gerne hundert Quadratmeter groß sein muss. Auf einem niedrigen Tisch sind Getränke und mehrere Teller mit Häppchen aufgestellt. Herr Griese zeigt auf ein Sofa, wo von Köslin und von Korff Platz nehmen. Er selber lässt sich in einen schweren Sessel fallen, sein Stammplatz vermutlich. Man spricht über das Wetter und über den Empfang von vorgestern, bis von Köslin das Thema wechselt.
„Herr Griese", beginnt er, „ich bin ihnen natürlich für ihre Vorschläge von neulich beim Abendessen sehr dankbar, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass Seine Majestät auch an Geld für sein Vorhaben gedacht hat. Sehen sie einmal in welchen Schwierigkeiten Seine Majestät sich derzeit befindet. Er hat von seinem Vater, Friedrich, eine schwere Last übernommen. Der Vater hat einen hochherrschaftlichen Hof geführt, alles musste vom Feinsten sein, um den anderen Herrscherhäusern zu imponieren. Schließlich hat er ja erst das Kurfürstentum zu einer Monarchie gemacht und da werden andere Erwartungen gestellt. Empfänge, viele Diener, eine Musikkappelle, viele Hofbedienstete und eine große Armee. Das alles kann Preußen sich heute nicht mehr leisten und Seine Majestät, Friedrich Wilhelm hat alle Hände voll zu tun, all den Luxus wieder auf ein normales Maß zu bringen. Er hat schon viele Leute entlassen und alle überflüssigen Schlösser verkauft, aber die Armee ist ihm wichtig. Die muss noch vergrößert werden und damit befindet er sich dann schon wieder in einem Dilemma."
Heinrich Griese hat aufmerksam zugehört und erwidert jetzt: „Herr Rat, das alles ist uns hier auch bekannt und wir bewundern Seine Majestät für die Weitsicht und den Mut, all diese Korrekturen durchzuführen. Ja, er hat es nicht leicht, aber wir fragen uns natürlich, wie groß die Armee noch werden soll? All die Soldaten müssen ja irgendwoher kommen. Das sind doch unsere Bauernsöhne, die dann auf den Feldern fehlen und die mit unglaublichen Methoden überall zur Armee eingetrieben werden." „Na ja, Herr Griese, wissen sie, freiwillig kommen die jungen Männer ja nicht in die Armee, da muss man schon ein wenig nachhelfen, wenn sie wissen, was ich meine." „Herr von Köslin, die Armee hat überall einen denkbar schlechten Ruf. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass da keiner freiwillig dienen will. Man hört von übelsten Schleifereien und blödsinnigem Drill und man hört von brutalsten Methoden, wenn jemand es wagt, zu desertieren. Wieso sollte ein so schlecht behandelter Soldat eigentlich den Wunsch haben, sein Vaterland zu verteidigen, seine Schleifer vielleicht?"
Von Köslin ist sprachlos und von Korff schmunzelt in sich hinein. Er schaut Herrn Griese bewundernd an und zieht es vor, zu schweigen. Von Köslin hat sich etwas von seiner Überraschung erholt und versucht es noch einmal. „Herr Griese, Preußen braucht eine starke Armee und dafür muss seine Majestät unter allen Umständen sorgen. Wir sind umgeben von Ländern, die es nicht gut meinen mit Preußen. Die Schweden, die Dänen, die Österreicher, die Franzosen, die Sachsen, die Polen und die Russen natürlich auch noch. Die würden Preußen am liebsten von der Landkarte verschwinden sehen. Da muss Seine Majestät schon Vorsorge treffen und eine starke Armee ist immer das beste Argument gegen äußere Begehrlichkeiten."
Heinrich Griese schaut skeptisch. „Wenn Preußen friedlich ist, Herr Rat, dann wird uns auch niemand angreifen. Die Armee ist jetzt schon eine der Stärksten auf dem Kontinent und allein durch ihre Existenz ein totaler Schutz für Preußen. Aber ich frage sie, wie groß soll sie denn noch werden? Soll jeder Preuße am Ende Soldat sein? Wer soll dann auf den Feldern oder in den Fabriken arbeiten? Es muss doch alles in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Es muss doch auch etwas zu verteidigen geben, ein wirtschaftlich gesundes Land und eine Gesellschaft, in der es sich zu leben lohnt."
Von Köslin ist erschüttert und von Korff kann seine Sympathie für Herrn Griese kaum noch verbergen. „Na ja, " sagt von Köslin jetzt, „lassen wir das. Das ist ja ohnehin höhere Politik und nicht jedermanns Sache. Seine Majestät weiß schon, was für das Land gut ist und da kann er erwarten, dass ihn vor allem der Adel und die Industriellen unterstützen." „Kann er auch", sagt Griese jetzt versöhnlich, „ich werde Seine Majestät für das Hospital eine anständige Summe zur Verfügung stellen, würde mich aber freuen, wenn sie, Herr von Köslin, auch die Vorschläge unterstützen würden, die ich neulich abends gemacht habe. Ich werde dazu schon bald nach Berlin kommen und würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen könnten. Darf ich ihnen jetzt die Fabrik zeigen?"
Von Köslin bedankt sich. Man erhebt sich und beginnt mit dem Rundgang durch die Fabrik. Griese zeigt seinen Gästen alle Hallen, stellt die Produkte vor, die hier hergestellt werden und kennt seine Fabrik in allen Einzelheiten und in allen Details. Auffällig ist, dass er seine Mitarbeiter freundlich anspricht und ganz offensichtlich ein gutes Verhältnis zu ihnen hat. Er scheint sie alle zu kennen, spricht viele mit dem Vornamen an, drückt im Vorbeigehen manchem die Hand und klopft auch schon mal jemandem auf die Schulter. Einem Älteren flüsterte er im Vorbeigehen etwas ins Ohr, so dass dieser laut auflacht und die Arbeiter und Arbeiterinnen schauen freundlich auf ihren Chef, wenn er vorbei kommt. Von Köslin ist sprachlos und von Korff schaut ihn bewundernd an. Am Ausgang wartet schon die Kutsche und man verabschiedet sich. Von Köslin hat noch eine Frage: „Darf ich fragen, warum ihr Arbeiter vorhin so gelacht hat?" „Na ja", sagt Griese, „das war eigentlich vertraulich. Der Mann hatte mich neulich gefragt, ob er wohl auch noch zur Armee muss. Und da haben ich ihm eben gesagt, dass er bei seiner Größe nichts zu befürchten hat. Seine Majestät braucht vor allem lange Kerle." Von Köslin schmunzelt, bedankt sich und besteigt mit von Korff die Kutsche. Dann geht es in flotter Fahrt wieder zurück zum Gut.
Unterwegs fragt von Köslin: „Na, Korff, was sagen sie zu diesem Fabrikbesitzer?" Von Korff lächelt und sagt etwas verhalten: „Wollen sie meine ehrliche Meinung hören, Herr Rat?" „Ich bitte darum." „Herr Griese ist ein ganz außergewöhnlicher Unternehmer. Er hat einen bemerkenswerten, politischen Verstand und führt seine Fabrik meiner Ansicht nach vorbildlich. Von dieser Sorte Unternehmer habe wir nicht viele." „Meinen sie?" brummt von Köslin, „wir werden ja an der Summe sehen, die er stiftet, wie es um seine vaterländische Gesinnung steht. Ihr jungen Leute seht sowieso alles anders, als wir Alten. Na ja, das muss wohl so sein. Wo sollte sonst wohl der Fortschritt herkommen."
***
Das Jagdhaus der Forstdomäne Osterode liegt im großen Mischwald nicht weit neben dem Waldweg nach Liebemühl. Oberforstrat von Hirschberg benutzt es zu Zwecken der Forstverwaltung, aber auch als Ausgangs- und Endpunkt für Jagdveranstaltungen. Entsprechend eindrucksvoll ist die Sammlung der Jagdtrophäen in der Forststube, in der auch schon manches Treffen mit Gleichgesinnten stattgefunden hat.
Heute haben sich am späten Nachmittag die Teilnehmer der Jagd versammelt, nachdem alle schon früh am Morgen angesessen haben und den ganzen Tag über ihrem Jagdvergnügen nachgegangen sind. Die Strecke der erlegten Tiere ist eindrucksvoll, schön dekoriert mit Tannengrün. Das größte Tier ist ein prachtvoller Sechzehnender, dessen Gehörn dem Geheimen Rat von Köslin überreicht werden soll. Die Jagd ist abgeblasen, ein Lagerfeuer knistert und den Teilnehmern wird die eine oder andere Rund Bärentöter, Wodka oder Danziger Goldwasser gereicht. Man langt dankbar zu. Die Glieder sind doch etwas steif geworden und der Schnaps wärmt das Innere.
„Liebe Freunde", hat jetzt der Oberforstrat von Hirschberg das Wort ergriffen, „was kann schöner sein, als nach erfolgreicher Jagd die Trophäen zu bewundern und sich zu einem schönen Wildbraten zusammenzusetzen. Meine Leute haben drinnen schon alles vorbreitet, sie haben gut eingeheizt und das Essen ist fertig, wurde mir gesagt. Ich möchte aber in euer aller Namen, liebe Freunde, unsere Gäste aus Berlin, Herrn von Köslin und Herrn von Korff noch einmal ansprechen, die diese Jagd hoffentlich so genossen haben, wie wir alle. Ich möchte ihnen das Prachtexemplar eines Sechzehnenders überreichen, das in Berlin sicher einen ehrenvollen Platz in seinem Haus finden wird. Herr von Köslin, man kann nie genau sagen, welche Kugel am Ende getroffen hat. Heute war es ganz sicher ihre." Allgemeines Gelächter. „Wir müssen hier immer auch ein waches Auge auf Wilderer haben und hin und wieder wird auch einmal einer erwischt, aber das kennen sie ja, Herr von Köslin. Eine ordentliche Gesetzgebung hilft uns natürlich auch diesen Problemen Herr zu werden. Da vertrauen wir ganz auf unsere Regierung in Berlin. Nach dem letzten Hörnersignal möchte ich sie alle in unsere Jagdstube bitten. Alles ist angerichtet, essen und trinken sie dem Ereignis angemessen. Wer es später nicht mehr nach Hause schafft, kann auch eine Stube im Jagdhaus nehmen, wir sind auch darauf vorbereitet. Die Kutschenfahrer bitte ich, später vorsichtig zu fahren, damit die Kutschen nicht umkippen. Ich wünsche euch allen ein gutes Mahl und gute Gespräche. Weidmannsheil!" „Weidmannsdank", klingt es zurück und man begibt sich in die gemütlich hergerichtete Jagdstube. Auch für die Jagdhelfer und Kutscher ist gesorgt. Es gibt einen kleinen Anbau, das Jagdstübchen, in dem die Männer ebenfalls gut versorgt werden. Die Regel besagt, dass dort nur so viel getrunken werden soll, dass man die eigene Kutsche und die Pferde später noch erkennen kann. Das funktioniert schon deshalb, weil die Männer einiges gewohnt sind und den Pferden es später ohnehin egal ist, ob der Kutscher nüchtern oder betrunken ist. Die Pferde kennen ihren Weg. Man sieht in Ostpreußen häufig vermeintlich herrenlose Gespanne fahren. Der Kutscher schläft dann meistens hinten im Wagen.
In der Jagdstube wird es langsam immer lauter. Der Teufelskreis ist eingeläutet, dass man lauter wird, weil man vor Lärm sonst nichts mehr sagen oder hören kann. Wenn ein Teilnehmer der Runde etwas zu sagen wünscht, dann gibt er dem Oberforstrat ein Zeichen und der drischt mit einem Ehrfurcht gebietenden Holzhammer auf den Tisch bis Ruhe einkehrt. Das Verfahren ist eingeübt.
Den Anfang macht Freiherr von Schomburg. „Liebe Freunde, das mit den Jagdnachfeiern ist manchmal schwierig. Mein Freund, der Freiherr von Gollwitz in Allenstein hat mir von einem Gelage erzählt, nach dem keiner seiner Gäste mehr imstande war, ohne Hilfe den Wagen zu besteigen. Das soll vorkommen. Gollwitz hat also die verschiedenen Gäste, vier Männer, in eine Kutsche verfrachtet und dem Kutscher genau erklärt, wer wer ist und wohin er gebracht werden muss. Er hat auch empfohlen, die Herrschaften besser zu Hause am Eingang abzulegen, um sich den Ärger mit den Frauen zu ersparen. Was soll ich euch sagen, nach einer halben Stunde war die Kutsche wieder zurück und Gollwitz fragte den Kutscher verwundert, was los sei. Der war ganz verlegen und sagte ihm, er hätte im Hohlweg einen Unfall gehabt. Die Kutsche sei umgefallen. Ob denn den Herrschaften was passiert sei, wollte Gollwitz wissen. „Nein", sagte der Kutscher, „das nicht gnädiger Herr, aber die sind mir alle durcheinander gekullert und sie müssen mir helfen, die neu zu sortieren. Prost!" Lautes Gelächter und man schlägt sich auf die Schenkel. „Alle durcheinander geraten, das ist köstlich", brüllt Heinrich Griese, „vielleicht hätte ihr Freund allen ein Namensschild um den Hals hängen sollen." „Prima Idee", kommt es zur Antwort.
„Und worüber lacht man in Berlin, Herr von Köslin?" will jetzt von Hirschberg wissen. Eckardt von Köslin erhebt sich mit dem Bierkrug in der Hand und schaut genüsslich in die Runde. „Ja, meine Herren, worüber lacht man in Berlin?" wiederholt er die Frage und die Spannung steigt. „Ich sage ihnen zunächst einmal, worüber man nicht lacht oder lachen sollte. Da ist vor allem das Königshaus und die königliche Familie. Über die lachen wir nicht." Zustimmendes Gemurmel. „Wir lachen auch nicht über die sozialen Zustände in der Großstadt. Die sind wirklich nicht zum Lachen, auch wenn es Künstler, vor allem Maler gibt, die das etwas ins Lächerliche ziehen. Wenn zum Beispiel eine Malerin zwei kleine Jungen und einen Würstchenverkäufer mit einem Bauchladen darstellt, der die Jungen auffordert doch weg zu gehen, weil sie ihm sonst mit ihren Nasen den Duft wegnehmen. Das ist sicher nett gezeichnet, aber alles andere als komisch. Von dieser Art Kunst gibt es im Moment sehr viel in Berlin. Auch einige Zeitungen machen da mit. Lachen können wir allerdings ganz herzlich über das Militär und einige Typen aus dem Adel. Die zurzeit beliebteste Witzfigur ist ein etwas degenerierter Oberst der Kavallerie, Oberst Zitzewitz, Jahrhunderte alter Adel und sein Leben lang beim Militär. Oberst Zitzewitz sitzt also hoch zu Ross auf seinem Pferd ganz oben auf dem Feldherrnhügel und beobachtet die Schlacht. Da kommt in wildem Galopp ein Meldereiter angeritten und ruft schon von Ferne: „Wichtige Meldung, Herr Oberst!" Der Oberst grüßt und nickt und der Meldereiter, schon etwas näher, brüllt: „Wichtige Meldung, Herr Oberst!" Der Oberst bleibt ganz ruhig und nickt erneut. Der Meldereiter pariert sein Pferd, springt herunter, baut sich vor Oberst Zitzewitz auf und ruft erneut: „Wichtige Meldung!" Der Oberst wird jetzt etwas ungeduldig und herrscht den Melder an: „Na, nun rede schon!" Der Melder steht wie angewurzelt, überlegt und stammelt ganz leise: „Wichtige Meldung." Der Oberst versteht die Situation und spricht auf den Melder ganz ruhig ein: „Na, mein Lieber, bleiben sie mal ganz ruhig jetzt. Überlegen sie mal, was der Rittmeister gesagt hat, bevor sie losgeritten sind?" Der Melder überlegt und überlegt und dann schießt es spontan und freudig aus ihm heraus: „Reit los, Arschloch, vergisst ja doch!" Brüllendes Gelächter im Raum, man schlägt sich auf die Schenkel und man hört: „Wichtige Meldung. Wichtige Meldung. Das ist köstlich. Den muss man sich merken."
Im Anbau, wo die Kutscher zusammen sind, ist es unterdessen auch laut geworden. Man singt: „Fuchs du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Scheißgewehr. Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Scheißgewehr!" Dann hört man lautes Gebrüll und irgendetwas muss umgefallen sein, so laut kracht es nebenan.
Walter von Hirschberg hat sich jetzt erhoben und sagt: „Na, unseren Kutschern scheint es ja auch ganz gut zu gehen. Vielen Dank Herr von Köslin für den köstlichen Witz. Wir haben jetzt aber einen Anschlag auf sie vor. Wenn wir einen Gast zum ersten Mal hier haben, dann bitten wir ihn, an unserem Reitturnier teilzunehmen. Das ist ganz einfach. Wir reiten zunächst rücklings auf den Stühlen erst einmal um den Tisch, schön hinter einander, wie bei der Kavallerie. Danach bitten wir sie, kurz den Raum zu verlassen, damit wir den Parcours für den Ehrenritt vorbereiten können. Das geht ganz schnell und dann bitten wir sie, einmal im Kreis über den Tisch zu reiten. Das ist schon alles und ganz einfach, sie werden sehen. Danach sind sie in unserem Reitverein als Ehrenmitglied aufgenommen. Machen sie mit?" „Klar", sagt von Köslin, „ist doch Ehrensache. Reiten tu ich gerne, auch in Berlin."
Dann geht es los. Die Stühle werden umgedreht und vor dem Ausritt wird zunächst noch einmal angestoßen und es wird auf den Stühlen mit einem Höllenspektakel bei brüllendem Gelächter mehrmals um den Tisch geritten. Dann wird die Tür geöffnet und von Köslin reitet mit seinem Stuhl hinaus. Jetzt geht alles ganz blitzschnell. Das große Rund besteht aus vielen einzelnen Tischen und es werden jetzt an zwei Stellen die Tische entfernt. Die Tischtücher werden ordentlich gespannt und die Tafel erscheint wieder ganz komplett. Von Köslin wird wieder herein gerufen und reitet auf seinem Stuhl wieder in die Jagdstube. Der Stuhl wird jetzt auf die Tafel gestellt und die Teilnehmer stellen sich im Kreis um die Tafel auf. Von Köslin hat oben auf der Tafel auf seinem Stuhl, natürlich auf seinem Pferd, wieder Platz genommen und die Ehrenrunde kann beginnen. Er lächelt nach allen Seiten, winkt freundlich und der Ritt beginnt, bis zum ersten fehlenden Tisch. Dort endet die Ehrenrunde. Krachend fliegt von Köslin mit seinem Stuhl in die Lücke und es herrscht allgemeines Gebrüll. „Der Gaul muss getränkt werden!" wird gerufen und alle Bierkrüge ergießen sich über den armen von Köslin, der sich von der Überraschung noch nicht erholt hat, aber schon wieder lachen kann. Mühsam rappelt er sich auf, freundliche Hände helfen ihm und er sagt: „Na, das war ja eine Überraschung. Auf dem Schlachtfeld muss es so ähnlich sein." Unter allgemeinem Gelächter holt jetzt von Hirschberg sein Gewehr und schießt auf den zerbrochenen Stuhl. Schrotkugeln schwirren durch den Raum. „Gnadenschuss", sagt von Hirschberg, „das Bein war gebrochen. Anzünden!" Der Stuhl wird angezündet und verbreitet einen unangenehmen Rauch im Raum, was niemanden wirklich stört. Man schafft etwas Ordnung und nimmt, ständig lachend, wieder Platz, um das Gelage fortzusetzen. „Ich muss mich bei ihnen entschuldigen", sagt von Hirschberg zu von Köslin, „die Parcoursbauer müssen nachlässig gewesen sein. Wir müssen das vor dem nächsten Ehrenritt besser kontrollieren."
So nimmt der Abend bis spät nach Mitternacht seinen Verlauf. Es wird gesungen, gelacht und natürlich ordentlich getrunken. Lange nach Mitternacht macht Pastor Lüder den Anfang. „Meine Herren", ruft er, „ich mache den Anfang. Ich bedanke mich bei unserem Gastgeber. Es war ein köstlicher Abend. Leider muss ich noch die Predigt vorbereiten. Wie ist es, Schulmeister, soll ich sie mitnehmen?" Adalbert Recke hat sich mühsam erhoben. „Natürlich", murmelt er, „irgendwann muss ja schließlich Schluss sein. Wir sollten aufhören, bevor das hier in ein Gelage ausartet. Wir sollten noch etwas zu trinken für unterwegs mitnehmen, Pastor." „Brauchen wir Namensschilder?" will Freiherr von Schomburg wissen. Wieder allgemeines Gelächter. Draußen haben die Kutscher schon alles für den Heimweg vorbereitet und die Laternen an den Kutschen angezündet. Dann verlassen sie nach und nach die Jagdhütte und machen sich auf den langen, holprigen Heimweg. Manch einer wird wohl erst im Morgengrauen zu Hause ankommen.
***
Wenn man durch die Provinz Preußen fährt, wechselt leicht gewelltes Ackerland, eingebettet in ausgedehnte, tiefe Wälder miteinander ab. Hin und wieder sieht man Seen, ganz selten Dörfer oder Bauernhöfe. Das Land scheint unbewohnt, man fühlt sich allein mit der Natur und der unbeschreiblich klaren Kristallluft. Seit den frühen Morgenstunden sind die jungen Leute schon unterwegs. Friedrich Wilhelm von Bernsdorf, der junge Baron und Sohn, seine Schwester, Marie Baroness von Bernsdorf und der Assessor, Friedrich von Korff, haben sich für heute vorgenommen, eine Bauernschaft zu besuchen. Sie sind mit einem Zweispänner unterwegs nach Norden, immer den Hauptforstweg entlang. Dann nach etwa zehn Kilometern müssen sie sich westwärts halten. Der Waldweg wird schmaler und führt nach weiteren fünf Kilometern zu einer ausgedehnten Lichtung, wo vier Bauernhöfe stehen und gemeinsam die Bauernschaft Erlengrund bilden. Ihr Besuch gilt dem Bauernschafts-Vorsteher Ludwig Arnold. Die Kutsche wird schon von weitem gesichtet und Bauer Arnold wurde bereits verständigt, dass Besuch kommt.
Bauer Arnold steht schon vor seinem Hof. Mit dem Hut in der Hand begrüßt er die Gäste: „Herzlich Willkommen, gnädiger Herr, welche Ehre, dass sie uns einmal besuchen." Friedrich Wilhelm von Bernsdorf ist als erster ausgestiegen und schüttelt dem Bauern die Hand. „Es gibt einen Grund, Bauer Arnold", sagt er gleich, „ein Mitglied der Regierung weilt zurzeit bei uns und sein Begleiter, Assessor von Korff, wollte sich einmal einen Eindruck von einer Bauernschaft verschaffen." „Das ist schön", sagt Bauer Arnold, „so hohen Besuch haben wir selten." Nachdem er auch die Baronesse und den Assessor begrüßt hat, deutet er mit einer umfassenden Handbewegung auf die umliegenden Bauerhöfe und sagt: „Wir vier hier sind die Bauernschaft Erlengrund. Sie sehen unseren Reichtum sofort, Erlenwälder, soweit das Auge reicht. Bitte kommen sie doch herein. Meine Frau wird uns einen Tee aufsetzen. Dann können wir alles besprechen."