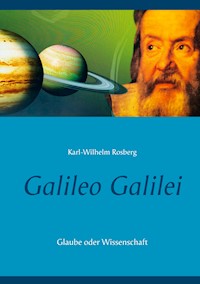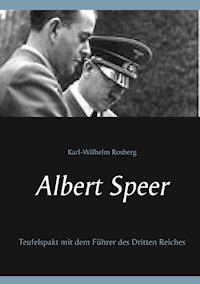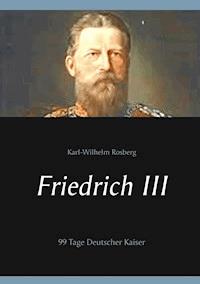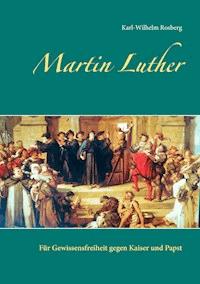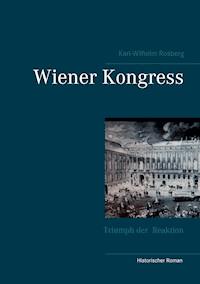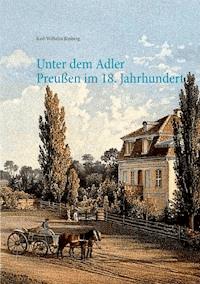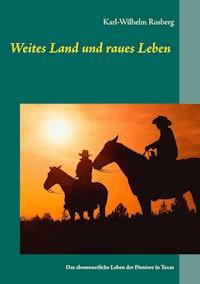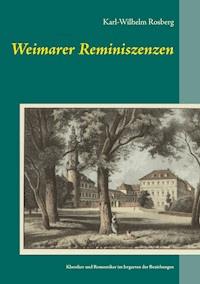
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende des 18. Jahrhunderts begegneten sich in Weimar, Jena und Gotha die größten Dichter, Philosophen und Naturwissenschaftler der damaligen Zeit: Goethe, Schiller, Herder, Hegel, Fichte, Schelling, die Brüder Schlegel, Novalis, die Brüder Humboldt. Sie wurden gefördert von Karl August Herzog von Sachsen - Weimar - Eisenach und begründeten eine wohl einmalige Epoche der deutschen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. So genial diese Männer und ihre Frauen waren, so menschlich waren sie auch. Ihre Beziehungen waren geprägt von starken Gefühlen in ihren extremsten Ausprägungen: Bewunderung und Neid, Liebe und Hass, Freundschaft und Feindschaft, Stolz und Depressionen. Vielleicht waren es gerade diese Gegensätze, die im Irrgarten der Beziehungen diese Genies zu Höchstleistungen anspornten, indem sie - jeder auf seine Weise - Lebenswerke hinterließen, die noch heute von unschätzbarem Wert sind. Eines zeigte sich aber bei allen: Auch die Großen waren nur Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Personen
Neubeginn in Weimar
Ich mag sie wohl beide
Demut kommt vor dem Fall
Wer ist Faustina?
Achten Sie mehr auf meinen Sohn
Liebesgeschichten
Ab mit Ihnen in das Jägerhaus
Dem französischen Spuk ein Ende machen
Wer ist Christiane?
Die Frühromantiker finden zusammen
Wozu Trauscheine?
Warum habe ich das nicht bemerkt?
Man müsste ihm ein Kind machen
Der Meister kommt nach Jena
Beginn einer Freundschaft
Romantiker Beziehungen sind anders
Ein eigenwilliger Professor macht Ärger
Eine Seelenverwandtschaft entsteht
Die haben es gerade nötig
Am Hof von Gotha ist sicher alles besser?
Man müsste ihr Gift geben
Welche von beiden soll es denn sein?
Eine Frau sieht Rot
Diese dilettantischen Schreiberlinge
Auch der Meister möchte in Jena dabei sein
Die Affäre um eine Minderjährige
Eine neue Hofsängerin in Weimar
Ein Balladensommer
Ist den Romantikern denn gar nichts heilig?
Das Maß ist voll
Wie schön wäre ein Rittergut
Stücke braucht Weimar: Wallensteins Lager
Ein Professor fliegt
Auch ein Poet muss mal an die frische Luft
Wozu braucht ein junger Professor ein Gehalt?
Warum musste ich nur nach Weimar ziehen?
Den Kopf abhacken geht gar nicht
Die Christenheit oder Europa
Kaum verheiratet, schon getrennt
Ein Skandal nimmt seinen Lauf
Dem Manne muss geholfen werden
Der Meister braucht Luftveränderung
Da fehlt noch ein Planet
Man lache nicht!
Unangenehme Nachbarschaft
Romantiker scheiden glücklich
Die verkörperte Intelligenz Weimars wird zu den Waffen gerufen
.
Kann diese Frau nicht irgendjemand totschlagen?
Deine natürliche Tochter gefällt mir besser, als dein natürlicher Sohn
Ausdrücklich verbitte ich mir jedes Andenken
Mein Herzogtum ist so groß, wie Sie befehlen, Sire
Alles Gute zum letzten Neujahrsfest
Ohne Aufhebens ist er gekommen und so auch wieder gegangen
Alles aufs Geratewohl ins Blaue gedichtet
Die Franzosen in Weimar
An Leib und Seele verderbliche Immoralität
Das er mit so einem geringen Menschen reden möge
Den unwürdigen Redereien ein Ende machen
Er ließ mich gleichsam gelten
Vom Untergang solch hoher Seelenkräfte kann in der Natur niemals die Rede sein
Freiheit ist eine Kunst, sich selbst treu zu bleiben
Ich will Gott bitten, dass ihm diese Stanzen verziehen werden
Ja wie meent er des?
Eine wahnsinnige Blutwurst
Magst du meine Jugend zieren mit gewaltiger Leidenschaft
Leere und Totenstille in und außer mir
Auf den Hund gekommen
Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide
Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend
Ich habe gewusst, dass ich einen Sterblichen gezeugt habe
Schau her: Über allen Wipfeln ist Ruh
Epilog
Prolog
Der Roman führt uns in das Ende des 18. Jahrhunderts nach Weimar, Jena und Gotha, genau genommen in das Herzogtum Sachsen- Weimar- Eisenach. Das politisch eher unbedeutende Herzogtum ragte zu dieser Zeit allerdings kulturell weit heraus. Der kulturfördernde Herzog Karl August hatte den schon in hohem Ansehen stehenden Dichter Johann Wolfgang Goethe aus Frankfurt nach Weimar geholt und ihn zeitlebens großzügig alimentiert.
Zudem existierte in Jena eine bedeutende Universität, an der die damals wohl größten Philosophen, Literaten und Naturwissenschaftler lehrten. Diese beiden Umstände führten dazu, dass sich in Weimar und Jena, auch im benachbarten Gotha, eine in der Geschichte wohl einmalige Mischung von bedeutenden Genies begegneten, miteinander lebten, stritten, gesellschaftlichen Umgang pflegten und die Kultur und Wissenschaft sprunghaft weiter entwickelten.
Es handelte sich unter anderen um: Goethe, Schiller, die Brüder Schlegel, Fichte, Schelling, Tieck, Schleiermacher, von Hardenberg (Novalis), Herder, Hegel, Wieland und aus Berlin regelmäßig kommend auch die Gebrüder von Humboldt. Diese Genies mit ihren Frauen, Kindern und Geliebten fanden sich im Geiste der Klassik und Romantik nennenden kurzen Epoche zusammen, liebten und begehrten sich, durchlebten aber auch alle Höhen und Tiefen des Zusammenlebens. Kein menschliches Gefühl war ihnen fremd: Liebe und Eifersucht, Anbetung und Verachtung, Treue und Intrigen, Anerkennung und Neid, Hoffnung und Verzweiflung, Stolz und Depressionen.
Die für die deutsche Kulturgeschichte so bedeutenden Frauen und Männer durchlebten einen wahren Irrgarten der Beziehungen und Gefühle. Der Episodenroman soll diese bedeutende Zeit und ihre herausragenden Menschen erneut zum Leben erwecken. Die Namen, Fakten und Überlieferungen werden möglichst wahrheitsgetreu wiedergegeben. Die Ereignisse waren so spannend und turbulent, dass kein Autor eine bessere Geschichte erfinden könnte.
Beim Verfassen des Episodenromans war es besonders hilfreich, dass die Zeit der Klassik, Romantik und des Idealismus von namhaften Historikern exzellent analysiert und nahezu widerspruchsfrei aufgearbeitet worden ist und als historische Analysen vorliegen. Beispielhaft genannt seien hier nur: Rüdiger Safranski: Romantik, Eine deutsche Affäre; Goethe, Kunstwerk des Lebens; Friedrich Schiller, Die Erfindung des Deutschen Idealismus; Goethe & Schiller, Geschichte einer Freundschaft; Richard Friedenthal: Goethe, Sein Leben und seine Zeit; Albert Bielschowsky: Goethe Sein Leben und seine Werke; Sabine Appel: Caroline Schlegel-Schelling, Das Wagnis der Freiheit; Ernst Wieneke: Caroline und Dorothea Schlegel in Briefen; Sigrid Damm: Goethes Freunde in Gotha und Weimar; Heinrich Döring: J.W.v.Goethes Biographie, Friedrich Schillers Biographie. Stefan Bollmann, Warum ein Leben ohne Goethe sinnlos ist. Historiker, die ich hier nicht nenne, mögen mir verzeihen, aber das Literaturangebot ist überwältigend.
Außerordentlich ergiebig, waren natürlich auch die Dichtungen, Romane, Schriften, Vorträge und Veröffentlichungen aller vorkommenden Akteure im Original, wie sie z.B. im Gutenberg Projekt der Zeitschrift DER SPIEGEL jeweils im Originaltext bereitgestellt werden, ein wunderbares und einmaliges Archiv.
Es soll daher auch gar nicht der Versuch unternommen werden, eine weitere historische Analyse dieser so gut dokumentierten Zeit hinzuzufügen. Vielmehr kommt es dem Autor darauf an, die Zeit der Klassiker, Romantiker und des Idealismus und ihre so wunderbaren Akteure in Form eines Romans wieder zum Leben zu erwecken, um den Leser am Denken und Handeln der großen Frauen und Männer dieser Zeit teilhaben zu lassen.
Bei der Gestaltung des Episodenromans besteht allerdings eine grundlegende Schwierigkeit. Die handelnden Personen gehörten zu den wirklichen Großen ihrer Zeit. Goethe war Jurist, Politiker, Dichter und Naturwissenschaftler. Schiller war Mediziner, Philosoph, Dichter und Professor. August Wilhelm Schlegel war Theologe, Philosophieprofessor, Literaturkritiker und Schriftsteller. Schelling war Theologe, Philosophieprofessor und Publizist. Alle – auch die an dieser Stelle noch nicht genannten - gehörten dem gehobenen Bildungsbürgertum an und pflegten eine entsprechende Sprache, die wir sowohl vom Ausdruck, als auch inhaltlich zum Teil heute nur schwer verstehen. Es werden Beispiele dazu gegeben.
Wir können ihre Sprache heute aus ihren Werken, Veröffentlichungen und Briefen nachempfinden. Die wörtliche Rede kennen wir nicht mehr. So muss im Episodenroman ein Weg gefunden werden, ihr Zusammenleben, ihre Probleme, Hoffnungen und Sorgen in eine heute verständliche Form zu bringen. Dabei darf der historische Kern der Ereignisse nicht verunstaltet und es muss versucht werden, sowohl den großen Figuren der Zeitgeschichte, als auch den Erwartungen der Leser gerecht zu werden. Am Ende wird man feststellen, dass die Genies auch nur Menschen waren. Das ist sicher keine neue Erkenntnis, soll aber mit Freude erneut bewiesen werden.
Personen
Der Roman beginnt im Jahr 1788. Soweit das Alter der Personen angegeben wird, bezieht es sich auf dieses Jahr. Die Handlung überdeckt einen Zeitraum bis 1832.
Johann Wolfgang von Goethe. 39 Jahre (1749-1832). Geheimer Rat und Minister am Hof des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach. Schon zu der Zeit berühmter und verehrter Dichter der Klassik, Theaterintendant und Schriftsteller. Seit 1782 geadelt.
Friedrich Schiller, 29 Jahre (1759-1805). Medizinstudium, Dichter der Klassik und des Idealismus, Schriftsteller und Theaterregisseur. Geht vor allem wegen Goethe nach Weimar, wird unbezahlter Professor an der Universität Jena und nach längeren Anlaufschwierigkeiten Goethes lebenslanger Freund. Schiller wird später geadelt.
Karl August Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, 31 Jahre (1757-1828). Bis 1775 unter der Vormundschaft der Herzoginmutter Anna Amalia, danach Herzog. Holte Goethe 1775 nach Weimar und förderte ihn lebenslang durch Staatsämter und durch eine großzügige Versorgung.
Luise von Hessen-Darmstadt, 31 Jahre (1757-1830). Gemahlin des Herzogs Karl August. Nach mehreren Frühtodesfällen ihrer Kinder wurde sie 1783 Mutter des Erbprinzen Carl Friedrich und 1792 des Prinzen Bernhard. Die Ehe mit dem Herzog verlief unglücklich.
Anna Amalia von Braunschweig- Wolfenbüttel, 49 Jahre (17391807). Mutter des Herzogs Karl August. Nach dem frühen Tod ihres Gemahls, des Herzogs Ernst August Konstantin Herzog von Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach (1758) führte sie als Regentin das Herzogtum und erzog den Erbprinzen Karl August. Zog sich nach 1775 zurück und lebte ein gesellschaftlich anspruchsvolles Leben auf den Schlössern Ettersburg und Tiefurt. Förderte Goethe, die Kunst, die Musik und das Theater.
Ernst II. Ludwig von Sachsen- Gotha- Altenburg. (1745-1804). Verheiratet mit Charlotte von Sachsen-Meinigen. Galt als aufgeklärter Landesfürst, förderte die Kunst, u.a. Goethe, den Maler Tischbein und die Wissenschaft, insbesondere die Astronomie.
Emil Leopold August Herzog von Sachsen- Gotha- Altenburg (1772-1822). Zweiter Sohn von Herzog Ernst von Sachsen- Gotha-Altenburg und Charlotte von Sachsen- Meinigen. Übernahm nach dem frühen Tod seines älteren Bruders Ernst bereits 1804 das Herzogtum. Großer Bewunderer Napoleon Bonapartes.
Charlotte Albertine Ernestine Freifrau von Stein, 46 Jahre (17421827). Verheiratet mit dem Oberstallmeister Josies von Stein, Hofdame der Herzoginmutter Anna Amalia und Vertraute der Herzogin Luise. Mit Goethe befreundet, von Goethe glühend geliebt, erhielt sie von ihm 1700 Briefe. Nach Goethes Zuwendung zu Christiane Vulpius kühlte die Verbindung ab, blieb aber als Freundschaft lebenslang erhalten.
Johanna Christiana Sophie Vulpius, 23 Jahre (1765-1816). Goethes Geliebte und Haushälterin, ab 1806 Ehefrau Goethes. Stammte aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und war Putzmacherin in Weimar, bekam 1789 ihren und Goethes Sohn August. Vier weitere Kinder mit Goethe verstarben frühzeitig.
Charlotte von Lengefeld, (1766-1826), Seit 1790 Schillers Frau. Schwester von Caroline von Lengefeld und Patentochter von Charlotte von Stein. Führte Schiller und Goethe zum ersten Mal ohne großen Erfolg zusammen.
August Wilhelm Schlegel, (1767-1845). Theologie- und Philosophiestudium, zieht 1796 nach Jena, wo er 1798 an der Jenaer Universität Philosophieprofessor wird. Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker und zusammen mit seinem Bruder Friedrich Schlegel Herausgeber der Literaturzeitschrift Athenäum. Heiratet 1796 Caroline Michaelis, verwitwete Böhmer. Sein Haus ist Mittelpunkt der Jenaer Romantiker.
Caroline Schlegel, geb. Michaelis, verw. Böhmer, (1763-1809). Bewegtes Vorleben der Professorentochter, mit mehreren früh gestorbenen Kindern aus einer unglücklichen Ehe, nur Auguste überlebte. Nach den Mainzer Unruhen Festungshaft und uneheliches Kind mit einem französischen Offizier. Von den Behörden verfolgt, fand sie schließlich Ruhe bei August Wilhelm Schlegel und gehörte zum Mittelpunkt der Frühromantiker in Jena, wo sie Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling kennen und lieben lernt.
Auguste Böhmer, (1781-1800). Tochter von Caroline Schlegel aus ihrer Ehe mit Böhmer. Spielte später im Hause Schlegel unter den Romantikern die Rolle der koketten, frühreifen Tochter. Starb früh 1800. Ihr Tod löste einen Skandal in Jena aus.
Friedrich Schlegel, (1772-1829), Bruder von August Wilhelm Schlegel, Schulabbrecher, dennoch Studium in Göttingen (Jura, Philologie, Geschichte, Philosophie). Ging mit seinem Bruder nach Jena, war Mitherausgeber des Athenäums, versuchte sich als Dichter und Schriftsteller, auch mit Vorlesungen in Jena. Lebte zunächst mit Dorothea Veit zusammen, die er 1804 heiratete. Aktives Mitglied des Kreises der Romantiker.
Dorothea Friederike Schlegel, geb. Brendel Mendelssohn, gesch. Veit, (1764-1839). Lebte mit Friedrich Schlegel zusammen, für den sie ihre Familie verließ, heiratete ihn 1804. Schriftstellerin und Literaturkritikerin. Mitglied des Kreises der Romantiker.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, (1775-1854), Theologe, Philosoph und Professor in Jena, Würzburg, München und Berlin. Seinetwegen trennte sich Caroline Schlegel 1800 und heiratete ihn nach der Scheidung von Schlegel 1803. Ihm wurde die Schuld an Augustes Tod gegeben.
Johann Gottlieb Fichte, 26 Jahre (1762-1814). Nicht abgeschlossenes Theologiestudium, Schüler Kants, verheiratet mit Johanna Maria Rahn, Nichte Klopstocks. Ab 1794 Philosophieprofessor in Jena. Fiel beim Herzog in Ungnade und wurde 1799 entlassen. Ging dann nach Königsberg und Berlin.
Johann Gottfried Herder, 44 Jahre (1744-1803). Studium in Königsberg der Medizin, Theologie, und Philosophie. Dichter und Philosoph. Generalsuperintendent in Weimar. Hochgeachteter Dichter und Denker. Wurde schon vom jungen Goethe sehr verehrt.
Christoph Martin Wieland, 55 Jahre (1733-1813). Studium der Philosophie und Jura. Professor für Philosophie in Erfurt, ab 1772 Prinzenerzieher in Weimar. Begründete als Dichter den ersten deutschen Bildungsroman.
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, (1768-1834).Studium der Theologie, Philosophie und Philologie in Halle, Hauslehrer der Familie des Grafen Dohna, Hofprediger. Professor für Theologie und Publizist. Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Prediger an der Dreifaltigkeitskirche. Mitglied des Schlegelschen Kreises der Romantiker.
Johann Ludwig Tieck, (1773-1853).Dichter, Schriftsteller, Herausgeber, Übersetzer und Dramaturg des Hoftheaters Dresden. Schuf das umstrittene Bühnenstück „Der gestiefelte Kater“ und gehörte zum Kreis der Romantiker.
Georg Friedrich Phillip Freiherr von Hardenberg (Novalis), (17721801). Rechtstudium in Jena, Tätigkeiten bei der Salinendirektion. Amtshauptmann für den Thüringischen Kreis. Dichter und Mitglied des Kreises der Romantiker.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, (1770-1831). Theologiestudium, Hauslehrer in Bern und Frankfurt am Main. Professor für Philosophie an der Universität Jena und an der Berliner Universität. Veröffentlichte u.a. wissenschaftliche Werke und Enzyklopädien.
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, (17691859). Studium der Naturwissenschaften und des Bergbaus. Zusammen mit dem französischen Botaniker Bonpland Weltreisender zur Erforschung der Geografie, Anthropologie und Botanik der Erde. Sammler und Publizist. Berater des Preußischen Königs. Hatte über seinen Bruder Wilhelm Kontakte zu den Romantikern in Jena.
Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt, (1767-1835). Studium der Naturwissenschaften, der Sprachen, Philosophie und Staatswissenschaften. Bekleidete im preußischen Staatsdienst hohe Ämter, war zeitweise in Jena Berater Goethes und Schillers. Leitete als Sektionsleiter im Kultusministerium die Preußische Bildungsreform ein, wurde Gesandter beim Wiener Kongress und im Bundestag in Frankfurt am Main. Wegen seines Widerstands gegen die Karlsbader Beschlüsse verlor er alle Ämter, unternahm Reisen und widmete sich bis zu seinem Lebensende sprachwissenschaftlicher Forschung in Berlin.
Karoline Jagemann, (1777-1848). Schauspielerin, Sängerin und Theaterintendantin. Ab 1797 Hofsängerin in Weimar und Geliebte des Herzogs Karl August. Überwarf sich mit Goethe, der daraufhin die Leitung des Weimarer Theaters niederlegte.
Anna Louise Germaine de Stael (1766-1817). Französische Schriftstellerin und Literaturkritikerin. Zweimal verheiratet, 5 Kinder von 3 Männern. War zweimal in Weimar und beschäftigte August Wilhelm Schlegel nach dessen Scheidung als Literaturberater.
Weitere Personen:
Hofbedienstete, Buchhändler, Verleger, entfernte Freunde und deren Frauen.
Neubeginn in Weimar
Goethe befindet sich auf der Heimreise nach einer längeren Italienreise. Die Kutsche ist nicht allzu schwer und daher schnell. Eine faltbare Abdeckung schützt ihn vor Regen und übermäßigem Sonnenschein. An die elend langen Tagesetappen hat er sich gewöhnt. Wer reisen will, muss das in Kauf nehmen. Immerhin kann er während der langen Fahrten etwas arbeiten. Notizen und Ideen werden bei stark rüttelnder Kutsche schnell hingeworfen. Nach Ankunft muss alles noch einmal abgeschrieben werden. Goethe hat seine Kutsche bestellt, um sich abholen zu lassen. Die ewigen Kutschfahrten mit der Postkutsche hat er satt. „Wie lange noch bis Gotha?“ Der Kutscher beugt sich etwas herunter: „Vielleicht noch zwei Stunden, wenn nichts dazwischen kommt.“
Während der langen Kutschfahrt bis Weimar hat Goethe viel Zeit, über seinen Aufenthalt in Italien, aber auch über sein zukünftiges Leben in Weimar nachzudenken. In Italien ist ihm klar geworden, dass er sein Künstlerleben verschwendet, wenn er sich in Weimar weiterhin vorwiegend mit weltlichen Dingen der Regierungsgeschäfte abgibt. Andererseits sichert ihm diese Tätigkeit sein Einkommen und seinen Lebensstandard. Außerdem hat er dem Herzog Karl August gegenüber Pflichtgefühle. Der Herzog finanziert ihm sein aufwendiges Leben großzügig und kann als Gegenleistung natürlich Dienste als Minister erwarten. Verlässt er Weimar, findet er Zeit für seine Berufung als Dichter, weiß aber nicht, ob die Honorare zum Leben ausreichen. Der Hof von Gotha wäre möglicherweise eine Alternative. Bleibt alles so, wie es vor seiner Abreise war – vielleicht war es auch eine Flucht - gefährdet er möglicherweise sein Lebenswerk. Eine wahrhaft schwere Entscheidung.
Hinzu kommt, dass Goethe auf der Reise festgestellt hat, dass er im Vergleich zu anderen gleichgesinnten Menschen völlig am Leben vorbei lebt. Zwei Ereignisse haben ihm in Italien die Augen geöffnet. In Neapel hat er den englischen Gesandten William Hamilton kennen gelernt. Dieser biedere Diplomat – wesentlich älter als Goethe – wohnte zusammen mit einer wunderschönen jungen Frau, Emma Harte. Diese Frau machte alle Besucher des Hauses verrückt, indem sie ihren Körper mehr oder weniger verhüllt darbot und vorgab, künstlerisch lebende Bilder darzustellen. Was Goethe aber besonders ärgerte war, dass Sir Hamilton die Frau als Mitbewohnerin ausgab, in Wirklichkeit aber mit ihr ein ausschweifendes Liebesleben führte. Emma Harte wurde später Lady Hamilton.
In Rom lernte er auf der Rückreise eine feurige Italienerin kennen, die er wahrscheinlich durch Entlohnung für sexuelle Dienstleistungen gewann. Das war wahrscheinlich seine erste wirkliche sexuelle Beziehung, die ihm Lust auf mehr machte.
Sein Plan war also ein zweifacher: Zum einen wollte er Weimar zu einem Zentrum der Dicht- und Bühnenkunst machen, ergänzt durch Maler, Bildhauer und Architekten. Zum zweiten wollte er Schluss machen mit seinen platonischen Frauenbeziehungen, von denen er jetzt genug hatte. In Weimar wollte er so schnell wie möglich eine richtige, junge Frau haben, die mit ihm freudig das Bett teilte. Die adeligen Damen der höheren Gesellschaft kamen dazu nicht in Frage.
Die Kutsche kommt in Gotha an. Das Städtchen ist Mittelpunkt des Herzogtums Sachsen- Gotha und Goethe kennt sich hier schon ganz gut aus, da er häufig auch zum herzoglichen Hof reisen musste. Hier erwartet ihn sein Hofbeamter und Vertreter, Christian Gottlob Voigt, und steigt für den Rest der Reise in seine Kutsche. So kann sich Goethe über den Lauf der Dinge am Hof ausführlich berichten lassen. Zuvor kehrt man aber noch ein. Schließlich halten Speise und Trank Leib und Seele zusammen. Dann geht es weiter nach Weimar, drei Stunden Fahrt. Viel Zeit, um sich zu informieren.
„Was gibt es neues, Voigt? In zwei Jahren dürfte sich doch einiges ereignet haben?“ Voigt, ein untersetzter Mann mit streng geordneter Kleidung eines Hofbeamten schaut auf seinen Vorgesetzten, den er jetzt zwei Jahre vertreten hat und weiß gar nicht so recht, womit er beginnen soll. Er räuspert sich etwas, beginnt aber mit einer Frage: „Darf ich mir erlauben zu fragen, wie lange die Fahrt in diesen Kutschen war?“ „Lassen sie mich nachdenken. Bis in die Schweiz sind es gut neunhundert Kilometer. Durch die Schweiz dann dreihundert bis zum Großglockner. Dann runter nach Italien und noch einmal gut dreihundert bis Florenz. Dann dreihundert – alles nur ganz grob geschätzt – bis Rom vierhundert bis Neapel und dann noch einmal so viel bis Sizilien. Wie viel Kilometer sind das bis jetzt?“ „Das sind ungefähr zweitausenddreihundert!“ ruft der Kutscher. „Richtig, und das ganze zurück sind dann viertausendsechshundert.“ „Mein Gott“, brummt Voigt ungläubig, „und wie lange fährt man da?“ „Das auszurechnen ist meine Sache“, lacht der Kutscher, „bei hundert Kilometer am Tag fährt man fast fünfzig Tage.“ Laut lacht der Kutscher: „Gottlob müssen wir das nicht laufen. Aber ich habe den Herrn Geheimrat ja nur auf dem letzten Teil der Reise gefahren. Die eigentliche Strecken wurden ja mit Postkutschen gefahren, manchmal auch mit der Nachtkutsche.“
„Was ist mit ihrem Bericht?“ möchte Goethe jetzt wissen. „Ich habe mir einige Notizen gemacht, Herr Minister. Also, die Amtsgeschäfte laufen normal, immer der gleiche Kleinkram. Den können wir wohl auslassen. Nur das wichtigste. Das Schloss ist teilweise ausgebrannt und muss wieder erneuert werden. Der Herzog wartet schon ganz ungeduldig auf sie. Er meint, das wäre auch eine Gelegenheit, manches etwas künstlerischer zu gestalten. Das sollen sie wohl machen, oder jedenfalls bestimmen.“ „Wie konnte das kommen?“ „Das weiß niemand so genau. Kerzen müssen wohl die Vorhänge angezündet habe, bei einem Windzug vielleicht.“ „Schön“, brummt Goethe, „das heißt natürlich, nicht schön. Was gibt es noch?“ „Die Herzoginmutter wünscht ein neues Theaterstück für Weimar. Sie meint, das Programm sei jetzt tödlich langweilig. Haben sie etwas mitgebracht?“ „Das kann schon sein, jedenfalls habe ich einiges fertiggeschrieben. Das ist wahrscheinlich kein Problem.“ „Der Bergbau in Ilmenau ist abgesoffen, Verzeihung, ich meine, wir hatten einen Wassereinbruch.“ „Wird da gearbeitet?“ „Nein, im Augenblick nicht. Man wartet auf ihre Anweisungen.“ „Soll ich das Wasser selber herausschöpfen?“ „Verzeihung?“ „Ist schon gut, Voigt. Ich habe sie verstanden.“ Goethe lehnt sich nachdenklich zurück, als Voigt fortfährt. „Die Straßen sind schlecht in Weimar. Die Besucher beklagen sich beim Herzog. Sie sagen, die Straßen seien nirgends so schlecht, wie in Weimar. Frauen in anderen Umständen könnten da gar nicht mehr mit der Kutsche fahren. Der Herzog sagt, das sollen sie sofort abstellen, wenn sie wieder da sind.“ „Kutscher“, ruft Goethe, „umdrehen. Wir fahren sofort zurück nach Italien!“ Der angesprochene dreht sich lächelnd um. Er hat das Gespräch mit angehört und weiß, was er von dem Zuruf zu halten hat.
Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Goethe sich für die Zeit nach seiner Rückkehr vorgenommen hat. Er wird dem Herzog vorschlagen, Voigt auch weiterhin ihn in allen Tagesgeschäften vertreten zu lassen, damit er sich mehr auf seine literarischen Ambitionen konzentrieren kann. Dazu muss Voigt aber mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Das mit dem Theater ist natürlich seine Angelegenheit, aber alles andere kann auch Voigt machen, wenn man ihn nur lässt, vielleicht bis auf den Bergbau.
Jetzt kehrt etwas Ruhe ein und jeder hängt den eigenen Gedanken nach. Die Kutsche fällt jetzt in ein tiefes Loch und schüttelt die Insassen kräftig durcheinander. „Sehen sie, Herr Minister, wir sind jetzt auf Weimarer Gebiet.“ Goethe sagt kein Wort. „Darf ich noch etwas bemerken?“ fragt Voigt vorsichtig an. „Was denn noch?“ „Da ist kurz nach ihrer Abreise ein junger Dichter aufgetaucht, der überall nach ihnen fragt. Schiller heißt der. Ich weiß nicht, was der von ihnen will, aber er sagt, dass sie zusammen mit ihm zu den großen Dichtern zählen. So ungefähr drückt er sich aus. Er möchte wohl mit ihnen zusammenarbeiten. Und da sie für die Kultur zuständig sind, musste er warten.“ „Begabter junger Mann“, brummt Goethe, „aber zum großen Dichter reicht es noch nicht. Der hat bisher nur ein Bühnenstück geschrieben, Die Räuber. Der Herzog mag das Stück überhaupt nicht. Das ist die reinste Volksverhetzung, sagt der Herzog.“ „Und was sagen sie?“ „Das Stück ist gut, aber wir werden es in Weimar nicht aufführen. Das können wir dem Herzog nicht antun. In Mannheim hatte es aber Erfolg. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Schiller nach Weimar gekommen ist. Bei seinem Herzog Ernst in Stuttgart kann er sich nicht mehr sehen lassen. Der wirft ihn ins Gefängnis wegen des Stückes.“ „Mein Gott“, bemerkt Voigt, „dichten ist ja lebensgefährlich. Ich bleibe lieber Bediensteter.“
Ich mag sie wohl beide
Zwei Reiter sind unterwegs von Volkstedt nach Rudolstadt. Sie sind in Mäntel eingehüllt, da es heute etwas kühler ist und sie erst am Abend zurückreiten werden, nach dem Besuch aufgrund einer Einladung im Hause Lengefeld. Beide sind erwartungsvoll, da sie sich auf das Zusammensein mit den beiden Töchtern des Hauses freuen.
Sie wählen den Weg durch das romantische Saaletal, das den Blick freigibt auf das Schiefergebirge und die nördlich des Saalebogens gelegene Kleinstadt Rudolstadt. Sie haben knapp fünf Kilometer zu reiten und lassen sich Zeit.
Während des Rittes unterhalten sie sich darüber, was wohl werden wird, nach der Rückkehr des Meisters Goethe, der in Weimar schon mit Spannung erwartet wird. Der eine Reiter ist Friedrich Schiller, der andere sein ehemaliger Studienfreund Wilhelm Wolzogen. Dieser lacht laut auf, als Schiller ihm von dem Gerücht erzählt, Goethe würde möglicherweise überhaupt nicht mehr nach Weimar zurückkehren. Er fragt Schiller, was er dann wohl machen würde, denn Goethes wegen, sei er schließlich hier. Schiller ist unsicher, denn trotz vielfacher Bemühungen, hat er es noch nicht geschafft, Goethe zu treffen. Das ist aber der Hauptgrund für seinen Aufenthalt in Weimar.
„Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Wilhelm, frage mich aber, wieso Goethe so lange verreisen kann. Ist er nicht im Dienst des Herzogs?“ Wilhelm Wolzogen lacht. „Das sind Verhältnisse, die wir niemals verstehen, Friedrich. Jeder weiß doch, dass Goethe vor allem für seine Anwesenheit in Weimar bezahlt wird. Er soll den Hof und das Herzogtum mit seinem Genius adeln und Kultur in diese Gegend bringen. Goethes wegen kommen andere Künstler, auch Wissenschaftler. Du bist ja auch seinetwegen hier.“ Schiller schüttelt kaum erkennbar den Kopf. „Mir geht das nicht in meinen Verstand, dass jemand nur für seine Anwesenheit bezahlt wird. Das ließe ich mir natürlich auch gefallen.“ „Na ja, ganz so ist es ja nun auch nicht. Goethe ist im geheimen Rat des Herzogs und soll sich um die Kultur und um die Universität in Jena kümmern. Dazu ist er Minister geworden. Und ein Minister verdient schon ganz ordentlich.“ „Und da kann er mal eben zwei Jahre Urlaub machen?“ „Goethe schon. Sieh mal, in Italien sammelt er Eindrücke über Kultur, Bauwesen und Malerei. Die bringt er mit nach Weimar. Das ist der eigentliche Wert der Reise. Aber im Ernst, man munkelt das es zu Anfang gar keine Dienstreise war, sondern eine Flucht. Er hat sich ja nicht einmal abgemeldet. Ist einfach von Karlsbad aus, wo er zur Kur war, nicht nach Weimar zurückgekehrt, sondern nach Italien abgereist.“
„Flucht vor wem?“ „Man sagt, vor den weltlichen Aufgaben die ihn am Dichten hindern. Vor allem aber vor einer Frau.“ „Charlotte von Stein?“ „Ja, genau die. Das muss ein merkwürdiges Verhältnis zwischen den beiden gewesen sein. Der Mann ist Oberstallmeister in Berlin, die Frau – im besten Alter und gut aussehend- immer allein zu Hause. Die hat doch noch Träume. Dann kommt dieser von der ganzen Künstlerwelt verehrte Goethe und macht ihr den Hof. Welche Frau könnte da nicht schwach werden?“ „Ist sie schwach geworden?“ „Woher soll ich das wissen? Charlotte von Stein ist eine äußerst tugendsame Frau, sagt man, die als Gesellschafterin der Herzoginmutter auf ihren Ruf achten muss. Sie wird sich geziert haben.“ „Und das spornt natürlich einen Mann wie Goethe erst recht an.“ „Genau, und deshalb ist er wahrscheinlich auch davongeeilt.“
Die beiden Reiter erreichen schließlich den Ortseingang von Rudolstadt, wo sie schon von den beiden Schwestern Karoline und Charlotte erwartet werden. Gemeinsam geht man zum Landgut der Lengefelds, macht aber noch einen kleinen Umweg, um den gemeinsamen Spaziergang auszudehnen.
Karoline ist die ältere von beiden, kess, quirlig und verheiratet. Charlotte ist die ruhigere, zurückhaltend und ein wenig scheu. Sie ist noch zu haben. Die beiden Schwestern haben sich schick gemacht und ihre besonders farbigen Kleider angelegt. Beide tragen Hüte von beeindruckendem Format. Charlotte trägt einen zierlichen Sonnenschirm und am Handgelenk baumelt ein Täschchen. Karoline hat sich sofort bei Schiller untergehakt und schaut ihn erwartungsvoll, auch ein bisschen neugierig an. „Welche Ehre, Herr Schiller. Sie wohnen in Volkstedt? Gefällt es ihnen dort?“ „Klein, aber fein. Was mir besonders gut gefällt, ist die Ruhe. Da kann ich wunderbar arbeiten.“ Charlotte geht zusammen mit Wolzogen, ist aber schweigsam. „Schreiben sie ein neues Bühnenstück?“ möchte Karoline jetzt wissen. „Ich schreibe immer irgendetwas. Im Augenblick befasse ich mich mit der traurigen Geschichte eines spanischen Prinzen, einer Königin, die er liebte und seinem eifersüchtigen Vater, der ihn hinrichten ließ. Don Carlos wird das Stück heißen.“ „Wie aufregend. Der Prinz war in die Königin verliebt?“ „Ja, ursprünglich sollte er sie sogar heiraten. Dann hat aber sein Vater sie selber zu seiner dritten Frau gemacht und damit war das Problem da.“ Charlotte beteiligt sich jetzt an dem Gespräch. „Woher nehmen sie den Stoff für solch ein Stück?“ „Aus der Geschichte. Sie ist voller tragischer Ereignisse für dramatischen Stoff.“
Sie erreichen das Landgut. Man begibt sich zu einer Kaffeetafel ins Haus, wo Frau von Lengefeld ihre Besucher schon erwartet. Der Vater, ehemaliger Oberforstmeister und alter Adel, ist schon vor Jahren gestorben. Karoline lebt in einer sich auflösenden Ehe und Charlotte, das Patenkind von Charlotte von Stein, ist noch frei. Die Mutter ist an einer baldigen, aber standesgemäßen Heirat von Charlotte durchaus interessiert. Sie hat aber klare Vorstellungen über den gesellschaftlichen Stand ihres künftigen Schwiegersohns.
Es wird Tee und Gebäck gereicht und nachdem die Diener sich zurückgezogen haben, spricht Frau von Lengefeld Schiller unmittelbar an: „Sie leben in Volkstedt, Herr Schiller? Kann man da als Künstler existieren?“ Das ist eine mehr als direkte Frage und Schiller ahnt worauf das hinaus laufen soll. „Ich bin erst seit kurzem hier, gnädige Frau und suche noch einen geeigneten Standort. Weimar wäre mir sehr angenehm. Ich warte auch auf die Rückkehr des Herzogs Karl August aus Berlin, der mir von Ferne eine Hofratsstelle angeboten hat.“ „Wollen sie nun Hofrat oder Dichter sein?“ Schiller räuspert sich, ihm wird sichtbar unwohl bei diesem einer Inquisition ähnelndem Gespräch.“ So versucht er, sich aus dieser Klammer zu lösen. „Dichtender Hofrat, so etwa wie der Minister und Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Man sagt, er komme demnächst aus Italien zurück.“ Schiller hofft, dem Gespräch eine andere Richtung gegeben zu haben und schaut Wolzogen verzweifelt an. Der hat sofort verstanden, was von ihm erwartet wird.
„Sie haben ein sehr schönes Landgut, gnädige Frau. Bewirtschaften sie das ganz alleine?“ „Mit einem Verwalter, Herr Wolzogen.“ „Ist der tüchtig? Ich meine, steht er seinen Mann?“ Schiller verschluckt sich fast an einem Keks und muss sehr darauf achten, nicht lauthals zu lachen. Er beobachtet Frau von Lengefeld, die erkennbar über den Sinn der Frage nachdenkt. Karoline senkt den Kopf und nimmt ein Taschentuch vor den Mund, Charlotte wirkt wie versteinert. „Er versteht etwas von der Verwaltung, wenn sie das meinen, oder haben sie etwas anderes gehört?“ „Beileibe nein. Ich meine, ein Verwalter muss sich um alles kümmern. Er ist schließlich der Mann im Haus.“
Jetzt entsteht eine fast schon peinlich werdende Pause, die von Karoline beendet wird. „Sollen wir sie noch ein Stück begleiten? An der Saale gibt es ein schönes Plätzchen, wo man noch etwas plaudern kann. Vielleicht kann uns Herr Schiller noch etwas aus seinen Werken vortragen?“ Dieser Eingriff war nötig, um die Beteiligten aus ihrer Umklammerung zu lösen. Die Tee Tafel wird aufgehoben und man verabschiedet sich höflich, nicht ohne sich bei der Hausherrin für die Einladung zu bedanken. Eine Folgeeinladung unterbleibt fürs erste. Die jungen Leute schlendern noch zur Saale und bleiben noch etwas beieinander, bis Schiller und Wolzogen sich auf den Weg machen.
Auf dem Heimweg fragt Wilhelm Wolzogen Schiller, welche der beiden Töchter er denn vorziehen würde. Schillers Antwort verblüfft ihn. Schiller mag beide. Noch einmal sprechen sie über das merkwürdige Gespräch mit Frau von Lengefeld und Wolzogen meint: „Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass Charlotte unter die Haube soll. Wenn du keine derartigen Absichten haben solltest, dann solltest du vom Haus Lengefeld in der nächsten Zeit fern bleiben.
Demut kommt vor dem Fall
Das barocke Schloss in Weimar ist Goethe schon sehr vertraut. Er nähert sich dem breiten Hauptflügel durch den Schlosspark. Die gelb getönten Fassaden zierten einst eine Sommerresidenz. Jetzt wird sie vom Herzog als Hauptresidenz genutzt. Goethe bleibt stehen und versucht Spuren des Brandes auszumachen, kann aber zumindest von außen nichts feststellen.
Er begibt sich in das Schloss, wo die Diener ihn freundlich empfangen und sofort zum Herzog Karl August vorlassen, wo er sich nach einer langen, fast zwei Jahre dauernden Italienreise, die der Herzog großzügig finanziert hat, zurückmelden möchte. Ganz wohl ist Goethe bei der Sache nicht. Die Abreise vor zwei Jahren glich eher einer Flucht aus dem Kurort Karlsbad. Es dauerte Wochen, bis er sich brieflich beim Herzog aus Italien meldete und eine Entschuldigung für sein Verhalten finden musste.
Beide sehen sich jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal wieder, und obwohl Goethe ihm regelmäßig geschrieben hat, gibt es viele Fragen, gibt es viel zu berichten. Karl August empfängt Goethe mit ausgebreiteten Armen, umschließt ihn und hält ihn fest. „Willkommen daheim, mein Freund. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich sie vermisst habe. Jeden Tag musste ich an sie denken. Am meisten habe ich mich aber gesorgt, dass ihnen etwas zustoßen könnte, auf dieser langen Reise. Kommen sie, setzen sie sich und erzählen mir alles. Aber lassen sie nichts aus. Ich bin sehr neugierig und habe heute alle Zeit der Welt. Niemand wird uns stören. Seien sie auch mein Gast zum Abenddiner.“
Goethe ist erleichtert. So einfach hat er sich das gar nicht vorgestellt, aber er ist natürlich zufrieden, wie der Herzog reagiert. Alles scheint wieder in bester Ordnung. Man setzt sich und Goethe berichtet ausführlich: über die langen Tagesreisen, die Alpen, seinen Aufenthalt in Florenz, in Rom, Neapel und Sizilien. Überall hat er wichtige Leute getroffen, Dichter, Maler, Baumeister, auch Adelige und Kirchenmänner. „Das eigenartige an Italien ist aber, dass man in eine vollkommen andere Welt eintaucht. Alles ist so leicht, so unbeschwert. In Italien lebt man, auch wenn man etwas arbeiten muss. Man lebt förmlich während der Arbeit. Ein Künstler ist in Italien hoch angesehen. Und überall stolpert man über Kunst. Das Land ist voll davon.“