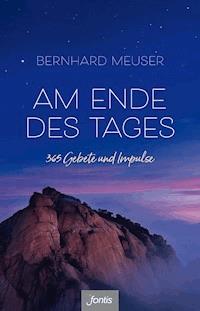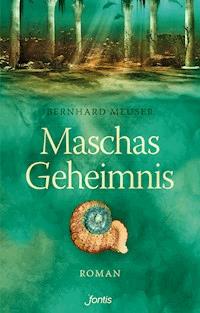
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die romantische Erzählung um die unmögliche Liebe der Mascha, einer vornehmen jungen Vineterin, weckt das mittelalterliche Vineta wieder auf: die Stadt der Händler und Seefahrer, der Gaukler und Narren, der Astronomen und Geometer, der Machthaber und der Intriganten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Meuser Maschas Geheimnis
Für Elisabeth, meine Frau
Bernhard Meuser
Maschas Geheimnis
Roman
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2015 by Fontis – Brunnen Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Foto: Atelier Sommerland, Rashevska Nataliia / Shutterstock.com Bild im Innenteil (Muschel): fotolia.de E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-756-2 ISBN (MOBI) 978-3-03848-757-9
www.fontis-verlag.com
Inhalt
1. Die Nacht am Meer
2. Der Muscheltraum
3. Die falsche Hochzeit
4. Die Geometer
5. Saturnische Konjunktion
6. Unterredung im Brunnenhaus
7. Farins Laute
8. Der Liebesbrief
9. Der Schrei
10. Das Fest
11. Der Wettstreit der Sänger
12. Heimliche Stunde
13. Die Hochzeit auf der Sandbank
14. Der große Regen
15. Godin
16. Der Gang ins Feuer
17. Leuchtende Nacht
18. Stille des Meeres, Tiefe der Welt
Über die Stadt Vineta
Von einer Stadt, «schöner und größer als irgendeine andere Stadt in Europa», berichten viele alte Legenden des Ostseeraumes, aber auch zahlreiche Chronisten und Geographen des Frühmittelalters, so Adam von Bremen (1057), der die Lage der Stadt Vineta genau beschreibt.
1. Die Nacht am Meer
Der Name des Mädchens, das die Muschel fand, war Mascha. Man hätte die Muschel übersehen können, denn das Licht eines neuen Morgens ließ den Meeressaum und die Gegenstände am Strand nur umrisshaft hervortreten. Nicht mehr als die oberste Spitze ihrer gewundenen Gänge ragte aus dem blank gespülten Sand.
Weit zog der Strand sich hin, unterhalb der Kreidefelsen bei Vineta, am oberen östlichen Meer. Mascha hielt im Gehen inne, bückte sich und grub die Muschel mit den Händen aus dem feuchten Schlick.
Sie reinigte sie in einer kleinen Wasserlache, bis die schöne Form leuchtend und rein in ihren Händen lag. Groß war diese Muschel, ein dunkel schattiertes, kunstvoll gewundenes Haus, dessen glatte Pforte wie aus Elfenbein geschliffen schien. Kein Künstler hatte sie erdacht und geschaffen. Nach einem geheimen Bauplan war sie in der Tiefe des Meeres gewachsen. Sand, Wasser und Salz hatten sie umspült und an ihrer Schönheit gearbeitet. Sie erschien Mascha vollkommen bewundernswert und außergewöhnlich. Es hätte gut sein können, dass sie keinem Menschen ins Auge gefallen wäre. Wie überhaupt die Menschen das Schönste in der Welt noch gar nicht gesehen haben.
Mascha sah die Muschel sofort.
Auch sie hätte die Muschel nicht entdeckt, hätten die Umstände sie nicht hinausgetrieben. Mascha hatte in der Nacht keinen Schlaf gefunden; deshalb war sie noch vor Mitternacht aufgestanden, hatte sich angekleidet und war durch die hohen Mauern zum Tor hinausgeschlichen und zum Strand hinuntergelaufen.
Sie ließ Vineta hinter sich, die hochberühmte, von drei Meeren umspülte Stadt, ließ auch die vorgelagerte Klippe hinter sich mit dem «griechischen Feuer», wie die Bewohner Vinetas den brodelnden Leuchttopf nannten, der den Schiffern zwischen Flussmündung und offenem Meer neuerdings den Weg in den Hafen wies.
Sie wusste es so einzurichten, dass sie von den Wächtern nicht entdeckt wurde. Es schickte sich nicht, dass eine Frau alleine durch die Nacht und durch die Dünen strich. Schon gar nicht für Godins älteste Tochter.
Ein frischer Wind blies ihr von Norden her ins Gesicht, und Mascha zog das Tuch fester um Kopf und Schultern. Unten am Strand leuchtete der feine Sand in fahlem Licht. Der Mond hing tief über der unruhigen See. Gleichmütiges Rauschen umfing Mascha und glättete ihre Empfindungen, während sie Stunde um Stunde am Saum des Meeres in Richtung Ramin hinaufwanderte. Die Hütten des Fischerdorfes lagen am oberen Ende der weiten Bucht. So sehr ihre Gedanken dort verweilen wollten, so wenig durfte Mascha daran denken, ihre Schritte wirklich dorthin zu lenken.
Es stand nicht zum Besten zwischen der mächtigen Handelsstadt Vineta und den Fischern von Ramin. Streitigkeiten ließen es in jenen Tagen nicht geraten sein, dass Vineter sich in Ramin und Raminer sich in Vineta blicken ließen.
Der Zwist zwischen Vineta und Ramin lief mitten durch Maschas Herz. In Ramin lebte Farin, ein junger Fischer, dem Mascha heimlich nahestand, seit sie ihn gehört und kurz mit ihm gesprochen hatte.
Mascha hörte. Es war, als wären alle ihre Sinne stumpf im Vergleich mit dem Hörsinn. Als sie noch ein Kind war, waren ihre Augen verklebt mit gelbem Grind. Mascha war ein Kind, das man vor der Sonne versteckte, um seine Augen zu schonen. Mascha weinte nicht und klagte nicht darüber; sie saß im Dämmerlicht und hörte.
Es bedurfte der Kunst vieler Ärzte, ihr die Augen zu reinigen und nach und nach den Sehsinn zu befreien. Godin, ihr Vater, der Erste der Ratsleute von Vineta, ließ damals sogar berufene Heilkundige übers Meer nach Vineta bringen, damit sie Mascha untersuchten und ihre Kunst an ihr versuchten. Sie spülten dem Kind die Augen mit heilsamen Wassern aus, rührten Tinkturen an und bestrichen die Augen mit immer neuen Salben. Godin liebte seine Kinder sehr – das struppige Schattenkind noch mehr als dessen jüngere Schwester Petrona.
Mascha hörte. Sie urteilte nicht nach dem Augenschein, sie bewertete die Dinge und Menschen nach ihrem Klang. Das Undeutliche, Geflüsterte und Geraunte ordnete sie dem Reich des Bösen zu, was immer die Worte im Einzelnen auch besagen mochten. Alles Zischende, Dröhnende und Knallende war ihr zuwider. Aus gebrochenen und harten Stimmen schloss sie auf Menschen, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Der klagende Ton einer fernen Flöte ließ ihren Atem stocken. Und einmal sahen Umstehende, wie ein kostbares Geschirr aus ihren Händen glitt: Im Garten sang die Nachtigall. Es kam vor, dass der feine Klang eines Lachens, das zufällig vom Markt zu ihrem Fenster emporschaute, sie über Tage hinweg in tiefsten Frieden und Einklang mit der Welt versetzte. Sie musste nicht einmal mit den Augen sehen, was da erklang; Mascha sah mit dem Gehör, urteilte mit dem Gehör, fühlte mit dem Gehör. Ja, es geschah, dass sie in Augenblicken, in denen zu viele sichtbare Dinge auf sie eindrangen und sie bedrängten, die Augen schloss, um das Wichtige vom Unwichtigen, das Gute vom Bösen, das Wesentliche vom Zufälligen zu unterscheiden.
Als Kind hing Mascha mit verklebten Augen an der Mutter und war glücklich, denn die Mutter sang, sang mit wunderbar warmer Stimme. Die Mutter hüllte ihr blindes Kind in ein Kleid aus Klang.
Eines Tages zerriss der Klang. Die Mutter verstummte, verstarb zu früh. Es war in dieser Zeit, dass Malena, die Großmutter, das Kind unter ihre strengen Augen nahm und Mascha von ihren Flausen befreite. Denn es war schon so weit gekommen, dass die Kleine der Wanda mitteilte, sie höre Stimmen.
Vor Wochen, als die Dinge zwischen Vineta und Ramin noch nicht verhärtet waren und die Fischer aus dem Dorf am oberen Ende der Bucht noch regelmäßig auf dem Markt von Vineta ihre Ware zum Verkauf anboten, war es gewesen, dass eine einzelne Stimme sich leise über das Marktgetön erhob und zu Mascha drang. Die nie zuvor gehörte Stimme berührte sie, ließ urplötzlich ihren Atem stocken, machte sie zittern – als sei ihre Mutter wieder da, als sänge sie. Aber die Stimme hatte keine Ähnlichkeit mit der Stimme ihrer Mutter; es war nicht die Stimme einer Frau. Es war die Stimme eines Mannes, eines jungen Mannes. Zum ersten Mal überfiel Mascha die Lust zu sehen. Sie rannte die Treppe hinunter, fiel fast über Wanda, die gerade mit einem Korb voll Fischen und Gemüse vom Markt hereingekommen war: «Wanda, ich muss sie sehen!»
«Was musst du sehen?»
«Die Stimme! Ich muss die Stimme sehen!»
Mascha hatte eigentlich unter den einfachen Leuten auf dem Markt nichts zu suchen. Ihr Kleid passte nicht zu den Kleidern der Leute, und die Hast, mit der sie, hier und dort anrempelnd, ihrem Gehör folgte, passte noch weniger zu ihr und ihrem Stand. Sie merkte nicht, dass Gespräche verstummten und Augen ihr folgten, als sie schließlich wie angewurzelt vor dem Stand eines jungen Fischers aus Ramin stehen blieb.
Der junge Fischer, der seine Fische auf dem Tisch ausgebreitet und dabei beiläufig vor sich hin gesungen hatte, wusste nicht, wie ihm geschah. Auch er verstummte und starrte die schöne und vornehme junge Frau an. «Sing!», stieß Mascha hervor. Der Fischer errötete. «Sing!», wiederholte Mascha.
«Ich kann nicht», stammelte der junge Mann und deutete schließlich auf seine Ware. «Da sind Fische. Ich habe Fische. Wollt Ihr Fische kaufen?»
«Fische …», stotterte Mascha, um irgendetwas zu sagen: «… ja, Fische, natürlich, ich will Fische kaufen!»
«Ihr habt ja gar keinen Korb!»
«Oh, ich habe den Korb vergessen, und Geld habe ich auch nicht dabei.»
Die Umstehenden schauten sich an, und sie begannen zu schmunzeln.
«Soll ich Euch die Fische bringen?», fragte der Fischer.
Mascha nickte heftig. «Dorthin! In das Haus von Godin!» Ohne sich um die Auswahl der Fische zu kümmern, drehte sie sich auf dem Absatz um und rannte quer über den Markt zurück in das Patrizierhaus, dessen nobler Giebel die Marktstände überragte.
Es war die Stimme von Farin, ja, Farin selbst, in den sich Mascha verliebt hatte. Es war Farin, dessen Name sie wieder und wieder zärtlich vor sich hin sagte, als sie am Strand des oberen östlichen Meeres entlangging und die Muschel fand.
2. Der Muscheltraum
Von Ramin her leuchteten die letzten Reste niedergebrannter Feuer herüber; die Fischer hatten sie die Nacht über nicht ausgehen lassen. Das Land brach an dieser Stelle schroff zum Meer hin ab und bildete eine Art schützenden Überhang.
Mit Hilfe von hölzernem Strandgut richtete sich Mascha an dieser vom Wind abgekehrten, trockenen Stelle einen Platz her, an dem sie sich geborgen fühlte und die aus dem Meer aufsteigende Sonne erwarten konnte. Mascha nahm die Muschel in beide Hände und hielt sie an ihr rechtes Ohr.
Es ist nicht sicher, ob sie hören wollte – gewiss wollte sie hören – oder ob das Gehörte sie einfach überfiel. Warum nimmt man eine Muschel und hält sie ans Ohr? Weil es die Alten sagen und sie es wiederum von den Alten haben, dass man aus den Windungen einer Muschel das Schicksal heraushören könne, wenn es nur der richtige Ort und die richtige Stunde ist? Man hält sie an das Ohr, weil man wissen will und etwas glauben möchte in der Nacht des Menschen, in der Nacht seiner endlosen Ungewissheiten. Man hört und spannt die Sinne an, spannt sie über den Horizont und die Begreiflichkeit hinweg, horcht in die Ewigkeit hinaus. Das Sehen stößt ja dumpf an die Dinge und Geschehnisse. Könnte nicht das Hören ihr Geheimnis verraten?
Die Sehnsucht führte die Muschel an Maschas Ohr. Denn sicher ist, dass man sich keinen sehnsüchtigeren Menschen vorstellen kann, als es Mascha an diesem Morgen war, am einsamen Ort, vor dem weiten Meer.
Und Mascha hörte: einen feinen Hauch zunächst, unter den sich von außen her das Geräusch der heranrollenden Wogen mischte; dann ein Rauschen, von dem nicht zu sagen war, ob es aus den Tiefen des Meeres oder aus dem Inneren der Muschel kam; dann (als sie mit feinerem Ohr in das Rauschen hineinhörte) war ihr, als wohne in seinem Inneren ein ozeanisch tiefes Murmeln. Ein Summen vielleicht, kaum hörbar, so fern, dann anwachsend im Bauch der Erde und immer stärker werdend, ein urhaftes Dröhnen auf einem einzigen, nach unten offenen, klaftertief ins Dunkel der Fluten sich verlierenden Ton.
Und wie der Ton sich in den gewaltigen Wassern wölbte und nicht aufhörte zu sein, da war es Mascha, als sei in dem einen Urton eine Entfaltung in die Breite zu vernehmen. Ihr war, als erhöben sich in unergründlichen Tiefen verankerte Säulen, deren unsichtbar aus dem Schweigen herauftönende Schemen sich, aus der Unendlichkeit auftauchend, fortwölbten und Meere und Kontinente zusammenhielten.
Mascha hörte sich immer tiefer hinein in die Abgründe, in ein Jenseits aller Untiefen, hörte das dumpfe Grollen unterirdischer Feuer, hörte sie wie verhangen und gedämpft durch einen Mantel aus zäher Kälte, hörte dies alles, bedeckt durch das fortwährende Gurgeln und Schmatzen gärenden Schlammes, hörte schaudernd sein gebärendes, verzehrendes Glucksen und Schlürfen, als dürfe man nicht versinken in das, woher man kommt.
Mascha erschrak und wandte ihr Ohr von den Gründen ab, hin zu den oberen Welten, wo sie ins Blaue sich lichtende Wasser zu vernehmen meinte. Und Mascha sah zwischen den Säulen der Erde Fische schwimmen, hörte das Flittern leichter Schwärme und ihr silbriges Glänzen, hörte, wie sie schwammen über versunkene Gärten, Gärten aus Musik, die da aus Tinte und Aquamarin auftauchten und auf zum Licht strebten.
Glockenklang platzender Knospen erfüllte sie und ein Harfenduft aus lauter Rosen, kunstvolle Figuren tanzender Gräser, Triller aus Akelei und Rittersporn. Durch Bäume fiel das Smaragd hingetupfter Lichter. Schatten tönten warm wie dunkler Samt alter Gamben. Quellen flüsterten ihren Silberklang und mischten sich mit dem Pizzikato von Tautropfen, die das Moos benetzten.
Mascha verwob ihr Gehör in das goldtiefe Grün fortschwärmender Fische, ließ sich einspinnen und mitziehen, folgte ihnen in atemloser Spannung über verzauberte Auen hinweg, über Teppiche aus reinem Klang, durch schattige Wälder und klaffende Grüfte.
Weiter, immer weiter! Wie erschrak sie aber, als sich plötzlich im Gewabere lichtenden Dunstes ein finsteres Massiv erhob, eine Felsenwand – nein, etwas von Menschenhand Gemauertes, aus groben Quadern titanisch Aufgetürmtes, ein menschlichen Hirnen entsprungenes Gebilde.
Näher und näher kam das trutzige Monument, zeigte Ecken und Kanten, Erker und Vorsprünge, Tore, Türme, Zinnen und Giebel. Eine hoch gebaute, herrliche Stadt ragte vor ihren Augen auf. Die Stadt ruhte tot, schön und ungeheuerlich im Meer. Wehende Algen hatten sich an die Mauern geheftet. Märkte und Straßen zitterten in gläserner Stille. An Häuserwänden robbten Krebse. Aale zuckten durch dämmrige Nischen. In den nassen Himmel stießen sinnlose Finger, Türme, die erstorbene Glocken bargen. Fische schwammen durch die toten Augen der Fenster und über bemooste Pflasterwege hinweg. Die Tür zu Godins Haus, die Mascha vor Stunden hinter sich geschlossen hatte, hing in den Angeln und bewegte sich leicht im strömenden Zug der Wasser. Mascha erstarrte. Sie schaute Vineta, das untergegangene Vineta.
Knochig hallte es aus der toten Stadt zu ihr herüber. In den überwölbten Straßen und hohlen Räumen kam ein Trappeln auf, verstärkte sich zu markigen Schritten einer Menge, die einem bestimmten Gesetz zu folgen schien.
Vom Burgberg herunter wallte es, als käme da gleich eine finstere Prozession, gar ein Pestzug um die Ecke. Und wirklich zeigten sich bald verschwommene düstere Wesen, schemenhafte Gestalten, Tänzer in finsterer Munterkeit, skeletthafte, spitzhütige Springteufel, die sich ekstatischen Gebärden hingaben. Sie mehrten sich, kamen näher und mischten sich mit dem, was in der Luft lag: Gemecker, Lachen, gekrähte Jubelrufe, fahle Hochgesänge.
Und waren es nicht Pferde, Schimmel, die da tänzelnd aus dem Dunst auftauchten und einen mächtigen Wagen hinter sich herzogen? Eine über und über mit fahlen Rosen geschmückte Hochzeitskutsche tauchte auf; ein gespenstischer Spitzhut auf dem Bock lenkte sie. Das Gefährt näherte sich in großer Geschwindigkeit, fuhr direkt auf Mascha zu. Mascha schrie auf vor Angst – Angst, überfahren oder gepackt zu werden von den wilden Schemen.
Doch schon war der Spuk vorüber, und Mascha blieb zurück mit dem, was sie gesehen hatte. Aus dem Fenster der Kutsche grinste die Braut, grinste Petrona, ihre Schwester.
Mascha fröstelte. Ihre Hände schlossen sich fester um die Muschel und ihr betäubendes Rauschen. Obwohl ihr wilde Schmerzen durch das Ohr schossen, war sie unfähig, die Muschel abzusetzen. Sie musste sich tiefer in das Geschaute einhören. Da waren sie wieder: die Stimmen. Die Stimmen, die sie bedrängt und an den Rand des Wahns getrieben hatten, damals, als ihr die Mutter weggerissen wurde, als der warme Klang ihrer Stimme für immer verstummte und die Geborgenheit der frühen Jahre in nichts zerfiel. Da waren sie wieder: die fortgewünschten, übertäubten, weggelegten Stimmen. «Mascha, Mascha», rief es.
«Ja, ich bin es, ich bin hier», flüsterte Mascha, indem sie die Muschel an den Mund hielt, um in die Unendlichkeit hineinzurufen. «Hier, hier …»
Aber nichts antwortete. Es wurden nur immer mehr Stimmen rund um die versunkene Stadt. Sie riefen andere Namen, riefen durcheinander, schwollen an zu einem verzweifelten Chor. Sterbestimmen, Totenstimmen, Stimmen der klagend Zurückgebliebenen.
Es war, als versammelten sich draußen vor den Toren der Stadt die Stimmen aller vom Tod Ergriffenen und in Bann Geschlagenen. Im Schoß der Fluten vereinigten sich die Stimmen ertrinkender Seeleute und die Stimmen ihrer Frauen und Kinder zu einem einzigen stummen Schrei, der sank und sank und sank, während von oben sich immer neue Schreie dazugesellten – sich dazugesellten und immerfort geschluckt wurden vom Hungerschlund der Tiefe.
Und das Schöne sank mit. Die Blumen sanken mit geneigten Köpfen. Die Vögel sanken mit zerfetzten Flügeln. Die Glocken schmolzen und sanken. Die Geigen sprangen und sanken. Mascha fühlte sich mit unwiderstehlicher Gewalt in die Tiefe gelockt, konnte sich dem Sog nach unten nicht entziehen, schwamm mit, sank mit, sang mit, im heißen Schwarm der Schreie, die in die Kälte, die ins Feuer sanken. Denn in der Tiefe war Feuer, ein vulkanisch brennendes Rasen, eine alles zermalmende Glutwoge, ein Inferno, das Menschen und Dinge erfasste und zerbrach. Unten, am Boden, brüllte der Scheiterhaufen zertretener Geigen.
Die Geigen brannten, aber sie verbrannten nicht. Es war, als ließe sich die Seele der Instrumente nicht hinraffen von der Sturmwut der Zerstörung. Es war, als könnte ein Hauch von a gegen die Feuerwand ansingen, als würde sich im Kern der Vernichtung ein Funke von e dazugetrauen, als würden a und e eine zarte Glaskugel bilden, in die sich ein zitterndes cis flüchten konnte. Es war, als stünden diese drei in großer Ruhe mitten im Nichts.
Und wie sich Mascha ebenfalls in den gläsernen Raum begab, da zerbrach ihr heiserer Schrei und verwandelte sich in etwas Neues. Ihre Stimme schmiegte sich an die zerbrechlichen Wände von a und e und cis, ließ sich nieder auf dem Grund unzerstörbarer Blumenblätter, rührte an verwegene Vogelstimmen und erstarkte am unverhofften Ton einer einsamen Glocke. Die Stimmen von Menschen gesellten sich dazu, Stimmen, die Namen riefen, doch ohne Schrecken und Angst, als sei ihnen die Nähe der im Tod Entrissenen gewiss.
«Mutter, Mutter», rief Mascha.
Die Mutter antwortete nicht. Aber ein Kinderlied antwortete ihr, fünf Töne nur, ein längst vergessenes, seltsam vertrautes Kinderlied. Ein Kinderlied, vielleicht am Bett gesungen oder hingesummt an einem dieser nicht enden wollenden Sommertage im Garten von Godins Haus in Vineta.
Jetzt stimmten es Geigen an, nahmen es Flöten auf, flüsterten es unsichtbare Engel zum Rauschen ihrer Flügel. Ein rein gestimmtes Sirren und Flirren lag in der Luft und trug das schlichte Lied hinauf in die hellen Regionen und hinab in die abgründigen. Es entzückte die Wolken, den Mond und die Sterne, drang in immer feinere Welten und noch hinter sie, wo nichts mehr war als Ewigkeit.
Die Unschuld des Liedes begab sich jedoch auch in das Meer der Leiden und der Bosheit, umwarb das heisere Gekeife, die Flüche und Lästerungen, all das Ächzen, Stöhnen und Seufzen, all die schreienden und klagenden Stimmen, band sie ein, eignete sie sich an, ohne das Moll und die Wahrheit ihrer Dissonanzen zu verraten, riss sie mit in die große Fuge, die schließlich alles, das Oben und Unten, die Länge und die Breite, das Innen und Außen, ohne Ausnahme ergriff.
Der bellende Donner einstürzender Himmel brach sich an der einen kleinen Melodie, vermochte nichts gegen die Gewalt ihres ruhigen und sanften Fortschreitens. Die zerbrochenen Himmel blieben zerbrochen. Aber aus fünf Tönen bauten sich neue, noch vollkommenere Himmel auf.
Mascha befand sich mitten im Meer des Vergehens und Neuwerdens und ertrank nicht darin. Sie trieb im Takt kommender und gehender Generationen, schwamm lauschend durch lichte und dunkle Gefilde. Schwamm zwischen den Resten längst versunkener Sprachen, durchmaß Litaneien untergegangener Kulte, wurde durch die Zeiten gespült, gesellte sich zu Scharen von Menschen und Tieren, zu Geistern, zu Cherubinen und Seraphen. Sie schwamm und hörte, hörte alle Stimmen, die irdischen und die himmlischen, und war doch ganz bei ihrer eigenen. Sie sang mit das große, das allgemeine Lied und verspürte doch keinen Unterschied zu ihrem eigenen, winzigen Part.
Sphärische Klangquader, strahlende Sonnentrompeten und die Posaunen des großen Gerichtes vermochten die Melodie ihrer Stille, das Lautwerden ihrer Sehnsucht nicht zu übertönen. Ja, der ihr selbst kaum vernehmbare Ton ihrer eigenen innersten Wünsche war da und bildete eine ganz unentbehrliche Notenfolge, die man nicht herausnehmen durfte, ohne im selben Augenblick den kosmischen Zusammenklang des allgemeinen Liedes heillos zu verwirren.
Mascha wagte es nicht, nach Farin zu rufen. Aber sie ließ nicht nach, suchte und fand endlich das beiläufige kleine Lied, das sie vernommen hatte, als sie am Fenster des väterlichen Hauses stand. Ganz deutlich hörte sie es heraus aus dem strahlenden Strömen all der Stimmen und Instrumente. Doch es war nicht in fernen Klängen. Als sie es endlich hörte, da fand sie es ganz nahe bei sich, hörte es wie ein zärtlich vertrautes Zwiegespräch, wie ein Antworten auf ihr Innerstes, wie einen Teil ihrer selbst.
Mascha nahm die Muschel vom Ohr und betrachtete sie. Blut klebte an den scharfkantigen Rändern; zu heftig hatte sie die Muschel an ihr Ohr gepresst. Mascha leckte das Blut ab.
Zart, doch bestimmt wagte sich die Sonne hinter dem Horizont des Ozeans hervor. Mascha erschien es wie die Vergewisserung einer versunkenen Erinnerung.
3. Die falsche Hochzeit
Die schläfrigen Wächter am großen Tor von Vineta staunten nicht schlecht, als ein hartes Klopfen sie herausrief und sie sahen, wer da Einlass begehrte. Mascha ließ sie ohne Erklärung stehen, drängte sich an ihnen vorbei und begab sich, während sie die kostbare Muschel an ihre Brust drückte, die verwinkelte Straße hinauf, die zum Marktplatz von Vineta führte.
Trotz der frühen Stunde waren schon viele Menschen auf den Beinen. Sie alle bereiteten sich mit großem Eifer auf die Festlichkeiten vor, die in den nächsten Tagen das Leben der Stadt bestimmen sollten. Überall wurden Blumen aufgestellt und die rot-weißen Fahnen mit dem Wappen der Stadt aus den Giebelfenstern herausgehängt. Fässer mit schwerem Bier und südlichem Wein rollte man die Straßen hinauf. Ochsen und Lämmer trieb man in die Stadt; sie sollten für das Festmahl aller Bürger geschlachtet werden.
Da und dort standen spitzhütige Geometer, gaben harsche Anweisungen und trieben die Leute zur Eile. Ritzlaff, der Narr, ein missgestaltetes Männlein, sprang ihnen zeternd zwischen den Füßen herum und wurde mit Knüffen und Schlägen vertrieben. In sicherer Entfernung spreizte der Gnom die zehn Finger, rollte mit den Augen und krähte: «Gericht, Gericht! Gericht über Vineta!»
Die Leute lachten über seinen Fluch. Einer der Geometer nahm einen Stein auf und warf ihn hinter dem Kleinen her, der schimpfend das Weite suchte.
Es war das Fest der ganzen Stadt, aber noch mehr war es das Fest der Geometer, die sich im sicheren Gefühl ihres Triumphes über den alten Adel der Stadt gefielen. Noch nicht lange war es her, da galten die Geometer nur als die bucklige Zunft der Schreiber und Rechenmeister. Nun sollte ihnen bald die Macht über die Stadt in die Hände fallen. Mascha schaute ihnen nicht ins Gesicht, und sie hörte auch nicht auf die spöttischen Bemerkungen, die sich bereits die jüngsten Geometer erlaubten, wenn sie Godins ältere Tochter erblickten.
«Wo warst du nur, Mascha?», fragte die alte Wanda besorgt. «Ich habe dich überall gesucht. Malena hat bereits nach dir geschickt. Ich musste sie hinhalten.»